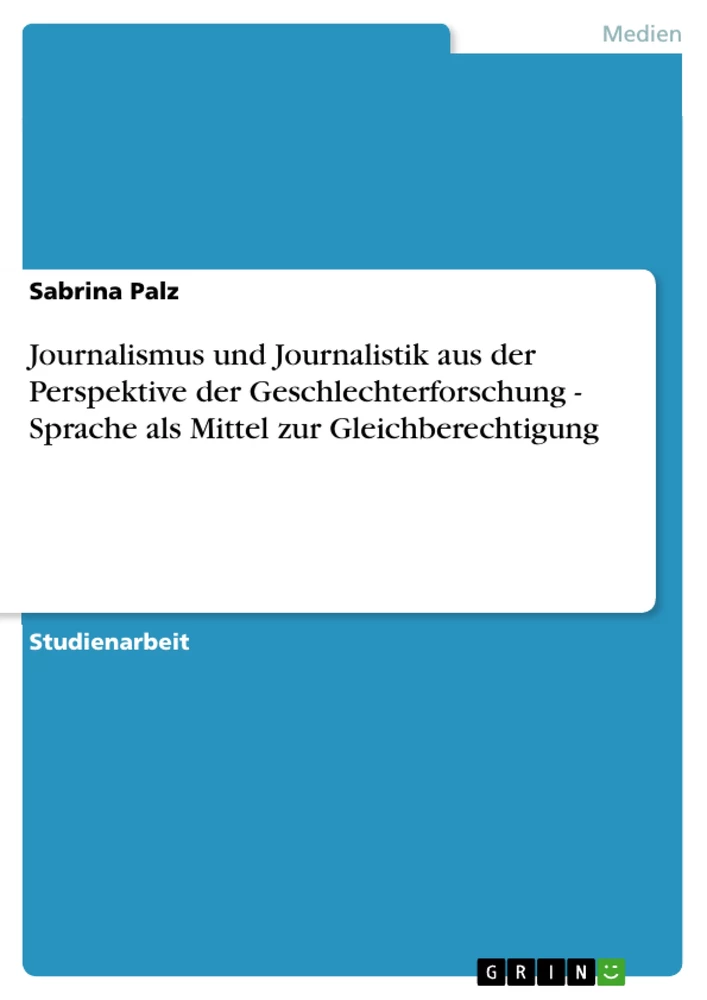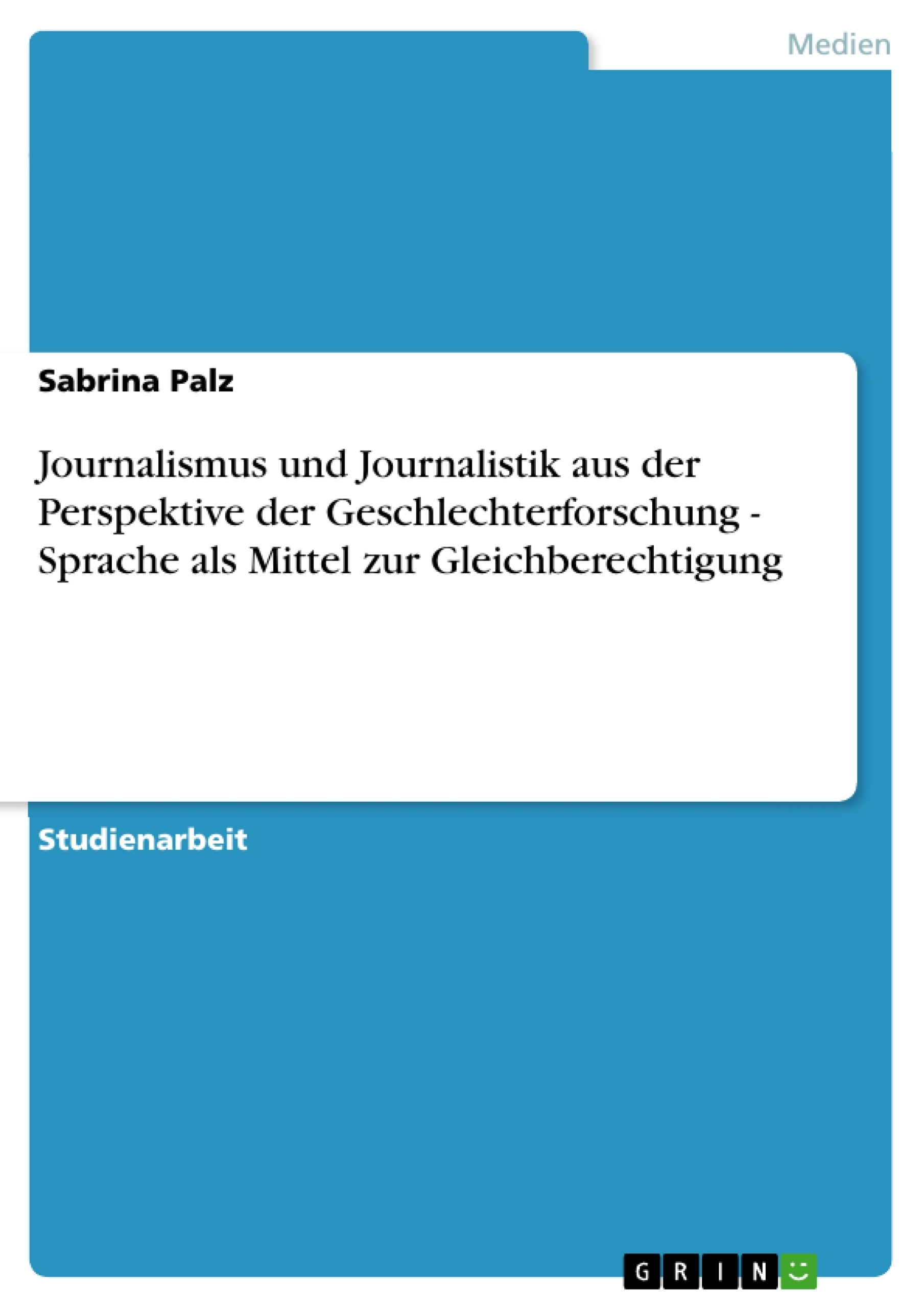Die Gesellschaft in Deutschland ist heute geprägt vom unterschwellig schwelenden Geschlechterkampf. Nach außen hat es den Anschein, Gleichberechtigung habe letztendlich Einzug gehalten in die deutsche Arbeitswelt. Unter der Oberfläche jedoch - oder hinter den Bürotüren - passiert es noch immer, dass Frauen diskriminiert, als minderwertig angesehen und von den Chefsesseln fern gehalten werden. Legt man als Kriterien für eine - als erfolgreich zu bezeichnende - berufliche Karriere die Höhe des Gehaltschecks und die Beteiligung an entscheidungsfindenden Positionen zugrunde, so stehen die Frauen den Männern noch immer nach. Auch im Journalismus und im massenmedialen System in Deutschland. Die Ursache hierfür wird im Folgenden in den bestehenden Geschlechterstereotypen, in den daraus abgeleiteten Vorurteilen und in der resultierenden Ungleichbewertung von Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen gesucht:
Der Schlüssel zur Gleichberechtigung liegt in der Sprache selbst. Der Journalismus hat in diesem Zusammenhang die besondere Aufgabe, den Schlüssel im Schloss zu drehen und sozusagen „Dietriche“ unters Volk zu bringen. Zunächst wird es nötig sein, die Stereotypen für ‚weiblich’ aufzuzeigen, sie gegen das männliche Pendant abzugrenzen, ihre Konstanz und Aktualität zu belegen und zu schlussfolgern, welche Auswirkungen diese Stereotypen auf die berufliche Verwirklichung der Frau haben. Im Anschluss daran folgen mögliche Lösungswege: Da gemutmaßt wird, den Erfolg versprechendsten Ansatzpunkt in der Sprache selbst zu finden, konzentriert sich der Hauptteil der Hausarbeit auf die Kommunikationsprozesse, die sprachlichen Bausteine von Stereotypen, deren Aufbrechen, Inhaltsneutralisierung und Umdeutung. Dem Journalismus kommen in diesem Zusammenhang zwei bedeutende Funktionen und Aufgaben zu: Zum einen müssen die neuen, vom Geschlechtinsbesondere dem männlichen als Referenzpunkt - gelösten Begriffe publiziert werden und, um auf Dauer eine Wirkung zu erzielen, muss sicher gestellt werden, dass die neuen, wertfreien Stereotypen in Umlauf bleiben und von der Gesellschaft durch ihre Permanenz und Penetranz verinnerlicht und akzeptiert werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechterforschung im Journalismus
- Geschlecht und Geschlechterrolle
- Gehaltsscheck und Entscheidungsfindung
- Journalismus als zweigeschlechtliches System
- Bezug zum Journalismus
- Der Konstruktivismus
- Stereotyp und Vorurteil
- Inhalte von Stereotypen
- Die Frau
- Ursachen, Antrieb und Folgen
- Verleugnen der weiblichen Identität
- Angriffspunkt Stereotyp und Sprache
- Die Rolle der Sprache
- Durchbrechen von Geschlechterstereotypen
- Entmannung bestehender Werturteile
- Neutralisierung von Sprache
- Frauenbegriffe
- Diskussion und Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle von Geschlechterstereotypen im Journalismus und analysiert die Auswirkungen dieser Stereotype auf die berufliche Verwirklichung von Frauen. Dabei wird insbesondere die Sprache als Instrument der Veränderung betrachtet und die Bedeutung der Neutralisierung von geschlechtsspezifischen Sprachgebrauchs für die Förderung von Gleichberechtigung herausgestellt.
- Die Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterrollen im Journalismus
- Die Auswirkungen von Geschlechterstereotypen auf die berufliche Situation von Frauen
- Die Rolle der Sprache in der Reproduktion und Überwindung von Stereotypen
- Die Bedeutung der Neutralisierung von Sprachgebrauch für die Gleichstellung der Geschlechter
- Der Journalismus als Motor für gesellschaftliche Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Geschlechtergleichstellung im Journalismus in der heutigen Gesellschaft beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird die Geschlechterforschung im Journalismus vorgestellt und der Fokus auf die Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterrollen im massenmedialen System gelegt. Im dritten Kapitel werden Stereotype und Vorurteile im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht analysiert und die Folgen für die berufliche Verwirklichung von Frauen beleuchtet. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Sprache bei der Reproduktion und Überwindung von Geschlechterstereotypen. Im fünften Kapitel wird der Ansatz der Neutralisierung von Sprache als Instrument der Gleichstellung vorgestellt und verschiedene Strategien zur Vermeidung von geschlechtsspezifischem Sprachgebrauch diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Diskussion und einem Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Geschlechterforschung, Journalismus, Stereotype, Vorurteile, Sprache, Neutralisierung, Gleichstellung, Frauen, Männer, Medien, Kommunikation, Systemtheorie, Rollenbilder.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Geschlechterstereotype den Journalismus?
Bestehende Vorurteile führen dazu, dass Frauen im massenmedialen System oft seltener in Führungspositionen vertreten sind und schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Gleichberechtigung?
Sprache ist ein Werkzeug der Konstruktion. Durch geschlechtsneutrale oder wertfreie Begriffe können veraltete Rollenbilder aufgebrochen und die gesellschaftliche Wahrnehmung verändert werden.
Was ist die Aufgabe des Journalismus im Kontext der Gleichstellung?
Journalisten sollen als Multiplikatoren fungieren, indem sie diskriminierungsfreie Begriffe publizieren und sicherstellen, dass diese durch ständige Präsenz in der Gesellschaft akzeptiert werden.
Was bedeutet „Neutralisierung von Sprache“?
Es bezeichnet Strategien zur Vermeidung von männlichen Referenzpunkten im Sprachgebrauch, um Frauen sprachlich sichtbar zu machen und Inhaltsneutralität zu erreichen.
Wie wirkt sich der Konstruktivismus auf die Geschlechterforschung aus?
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass Geschlechterrollen nicht naturgegeben, sondern durch soziale und kommunikative Prozesse (wie Medienberichterstattung) erschaffen werden.
- Quote paper
- Sabrina Palz (Author), 2004, Journalismus und Journalistik aus der Perspektive der Geschlechterforschung - Sprache als Mittel zur Gleichberechtigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61831