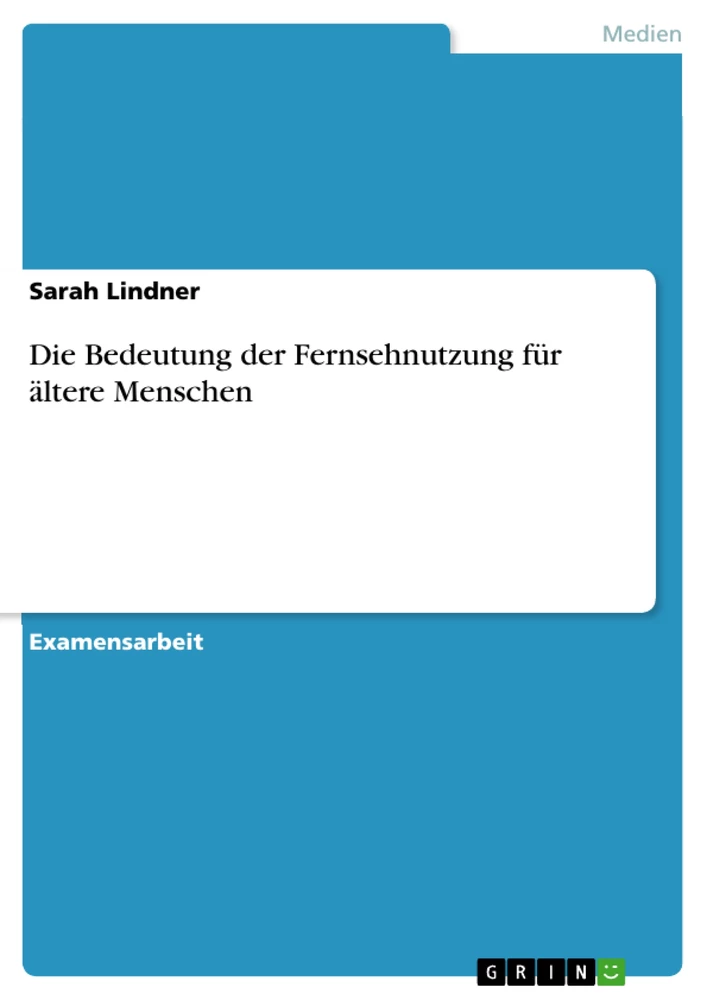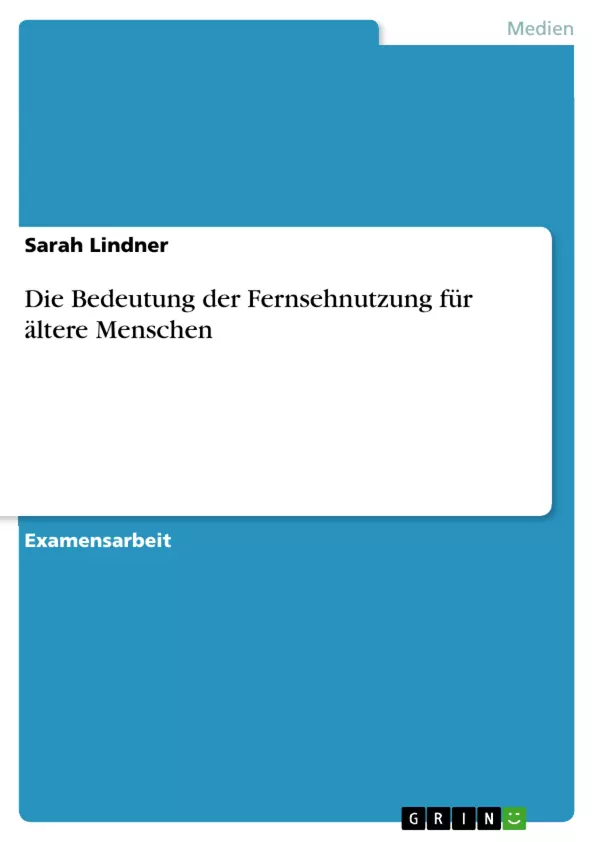Die Medienwelt hat nun auch die "ältere Zielgruppe" für sich entdeckt - nicht nur in der Werbung.
Doch wie nutzen ältere Menschen eigentlich das Fernsehen? Was schauen sie und mit welchen Bedürfnissen schauen sie sich die Sendungen an?
Bereits seit längerem ist bekannt, dass die ältere Bevölkerung die Massenmedien besonders intensiv nutzt. Auffallend ist die mit dem Alter stark ansteigende Fernsehnutzung, die einen hohen Stellenwert der Freizeitbeschäftigung älterer Menschen einnimmt.
Der demographische Wandel ist zum Thema der Medien geworden, egal ob bei "Schleichwerbung" in Fernsehsendungen, bei der Hintergrundmusik in Serien oder bei der Themenauswahl: Von der Rentenabsicherung bis zur Zunahme der älteren Bevölkerung und deren Probleme stehen die Themen auf der Medienagenda.
In der vorliegenden Arbeit steht diese steigende Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen im Mittelpunkt. Dabei wird vorangenommen, dass es im Altersprozess bestimmte Bedürfnisse gibt, die ältere Menschen mit dem Fernsehen befriedigen wollen.
Im Jahr 2040 werden mehr als die Hälfte der Deutschen über 50 Jahre alta sein (Koschnik 2004). Der Begriff der "Generation 50+" ist heute, da über 44 Prozent der Gesamtbevölkerung älter als 50 Jahre ist, aktueller denn je.
Diese Arbeit ist nicht nur geeignet für Interessierte der Medienforschung, wie Studenten der Publizistik-, Medien- und Journalistikwissenschaften, sondern auch für Menschen, die sich für die Altersforschung interessieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Forschung zur Lebensphase „Alter“
- 2.1 Überblick über die wichtigsten Veröffentlichungen
- 2.2 Konzepte des Alterns
- 2.3 Veränderungstheorien des Alterns
- 2.3.1 Biologische Alternstheorien
- 2.3.2 Theorie des „Disablement Process“
- 2.3.3 Disengagement-Theorie
- 2.3.4 Substitutions-Theorie
- 2.3.5 „Social Breakdown“-Ansatz
- 2.3.6 Sozio-emotionale Selektivitätstheorie
- 2.3.7 Theorie der Selektiven Optimierung und Kompensation
- 2.4 Kontinuitätstheorien des Alterns
- 2.4.1 Aktivitätstheorie
- 2.4.2 Kontinuitätstheorie
- 3 Empirische Befunde zum Fernsehnutzungsverhalten von Älteren
- 3.1 Ausstattung der Haushalte mit einem Fernsehgerät
- 3.2 Bewertung der Glaubwürdigkeit des Fernsehens
- 3.3 Fernsehen im Tagesverlauf
- 3.4 Mediennutzung im Kohortenvergleich
- 3.5 Programmwahl der älteren Zuschauer
- 3.5.1 Programmpräferenzen
- 3.5.2 Sendungspräferenzen
- 3.6 Festlegung von Nutzertypologien durch die Forschung
- 4 Anhaltspunkte zur Bedeutung des Fernsehens im Alter
- 4.1 Subjektive Wichtigkeit des Fernsehens für das betrachtete Publikum
- 4.2 Nutzungsmotive und Funktionszuweisungen an das Fernsehen
- 4.2.1 Informationsfunktion
- 4.2.2 Integrationsfunktion
- 4.2.3 Unterhaltungs- und Entspannungsfunktion
- 4.2.4 Fernsehen als Ersatz
- 4.2.5 Funktion der Zeitstrukturierung
- 4.2.6 Differenzierung nach öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen
- 4.2.7 Differenzierung nach formaler Bildung
- 4.3 Mediennutzung als soziales Handeln
- 4.4 Funktion der parasozialen Interaktion des Fernsehens
- 4.5 Bewertung von Zielgruppensendungen durch die Älteren
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen in Deutschland. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Alterungsprozess, den daraus resultierenden Bedürfnissen und der Befriedigung dieser Bedürfnisse durch das Fernsehen. Die Arbeit analysiert empirische Befunde zum Fernsehkonsum älterer Menschen und setzt diese in den Kontext verschiedener Alterstheorien.
- Der Einfluss des demografischen Wandels auf die Mediennutzung älterer Menschen
- Die verschiedenen Funktionen des Fernsehens im Leben älterer Menschen (z.B. Information, Unterhaltung, soziale Integration)
- Der Vergleich verschiedener Alterstheorien und ihre Relevanz für das Verständnis des Fernsehkonsums
- Empirische Befunde zur Programmwahl und den Nutzungsmotiven älterer Fernsehzuschauer
- Die Rolle des Fernsehens im Kontext sozialer Interaktion und im Umgang mit dem Alterungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die wachsende Bedeutung der älteren Bevölkerungsgruppe in Deutschland hervor, trotz des geringen Interesses der Medienplaner an dieser Zielgruppe. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen in den Mittelpunkt und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der demografische Wandel und die zunehmende Fernsehnutzung im Alter werden als Ausgangspunkte für die Untersuchung benannt.
2 Grundlagen der Forschung zur Lebensphase „Alter“: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Bezeichnungen für ältere Mediennutzer in der Literatur und gibt einen Überblick über wichtige Veröffentlichungen zum Thema Mediennutzung im Alter. Es diskutiert verschiedene Konzepte des Alterns, sowohl den demografischen Altersbegriff als auch das Alter als soziales Konstrukt und individuelle Erfahrung. Die Kapitelteil unterscheidet zwischen Veränderungstheorien und Kontinuitätstheorien des Alterns und bietet einen Einblick in verschiedene gerontologische Ansätze wie biologische Alternstheorien, die Disengagement-Theorie, und die Aktivitätstheorie.
3 Empirische Befunde zum Fernsehnutzungsverhalten von Älteren: Dieses Kapitel präsentiert empirische Befunde zum Fernsehkonsum älterer Menschen. Es analysiert Daten zur Fernsehausstattung der Haushalte, zur Glaubwürdigkeit des Fernsehens, zum Fernsehkonsum im Tagesverlauf und im Kohortenvergleich. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der Programm- und Sendungspräferenzen älterer Zuschauer, einschließlich der Entwicklung von Nutzertypologien auf Basis empirischer Forschungsergebnisse.
4 Anhaltspunkte zur Bedeutung des Fernsehens im Alter: Dieses Kapitel untersucht die subjektive Wichtigkeit des Fernsehens für ältere Menschen und deren Nutzungsmotive. Es analysiert verschiedene Funktionen des Fernsehens, wie die Informationsfunktion, die Integrationsfunktion, die Unterhaltungsfunktion und die Funktion als Ersatz für soziale Kontakte. Zusätzlich werden Aspekte wie Zeitstrukturierung, die Differenzierung nach öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen sowie nach formaler Bildung betrachtet, ebenso wie die Rolle des Fernsehens im Kontext sozialer Interaktion und parasozialer Beziehungen.
Schlüsselwörter
Fernsehnutzung, ältere Menschen, Mediennutzung, Alterungsprozess, demografischer Wandel, Alterstheorien, Medienforschung, Nutzungsmotive, Programmwahl, soziale Interaktion, Integration, Unterhaltung, Information.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen in Deutschland. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Alterungsprozess, den daraus resultierenden Bedürfnissen und der Befriedigung dieser Bedürfnisse durch das Fernsehen. Die Arbeit analysiert empirische Befunde zum Fernsehkonsum älterer Menschen und setzt diese in den Kontext verschiedener Alterstheorien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des demografischen Wandels auf die Mediennutzung älterer Menschen, den verschiedenen Funktionen des Fernsehens (Information, Unterhaltung, soziale Integration), dem Vergleich verschiedener Alterstheorien und deren Relevanz für das Verständnis des Fernsehkonsums, empirischen Befunden zur Programmwahl und den Nutzungsmotiven älterer Fernsehzuschauer sowie der Rolle des Fernsehens im Kontext sozialer Interaktion und im Umgang mit dem Alterungsprozess.
Welche Alterstheorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Veränderungstheorien (z.B. biologische Alternstheorien, die Disengagement-Theorie, die Substitutions-Theorie, der „Social Breakdown“-Ansatz, die Sozio-emotionale Selektivitätstheorie, die Theorie der Selektiven Optimierung und Kompensation) und Kontinuitätstheorien (z.B. die Aktivitätstheorie, die Kontinuitätstheorie) des Alterns.
Welche empirischen Befunde werden präsentiert?
Das Kapitel zu den empirischen Befunden analysiert Daten zur Fernsehausstattung der Haushalte, zur Glaubwürdigkeit des Fernsehens, zum Fernsehkonsum im Tagesverlauf und im Kohortenvergleich. Es untersucht die Programm- und Sendungspräferenzen älterer Zuschauer und entwickelt Nutzertypologien auf Basis empirischer Forschungsergebnisse.
Welche Funktionen des Fernsehens werden im Alter untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Funktionen des Fernsehens für ältere Menschen, darunter die Informationsfunktion, die Integrationsfunktion, die Unterhaltungs- und Entspannungsfunktion, die Funktion als Ersatz für soziale Kontakte, die Funktion der Zeitstrukturierung. Es wird auch die Differenzierung nach öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen sowie nach formaler Bildung betrachtet.
Welche Rolle spielt die soziale Interaktion im Zusammenhang mit der Fernsehnutzung?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Fernsehens im Kontext sozialer Interaktion und der parasozialen Interaktion. Es wird analysiert, wie das Fernsehen zur sozialen Integration beiträgt und welche Bedeutung parasoziale Beziehungen im Zusammenhang mit dem Fernsehkonsum haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehnutzung, ältere Menschen, Mediennutzung, Alterungsprozess, demografischer Wandel, Alterstheorien, Medienforschung, Nutzungsmotive, Programmwahl, soziale Interaktion, Integration, Unterhaltung, Information.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen der Forschung zur Lebensphase „Alter“, Empirische Befunde zum Fernsehnutzungsverhalten von Älteren, Anhaltspunkte zur Bedeutung des Fernsehens im Alter und Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
- Arbeit zitieren
- Sarah Lindner (Autor:in), 2005, Die Bedeutung der Fernsehnutzung für ältere Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61882