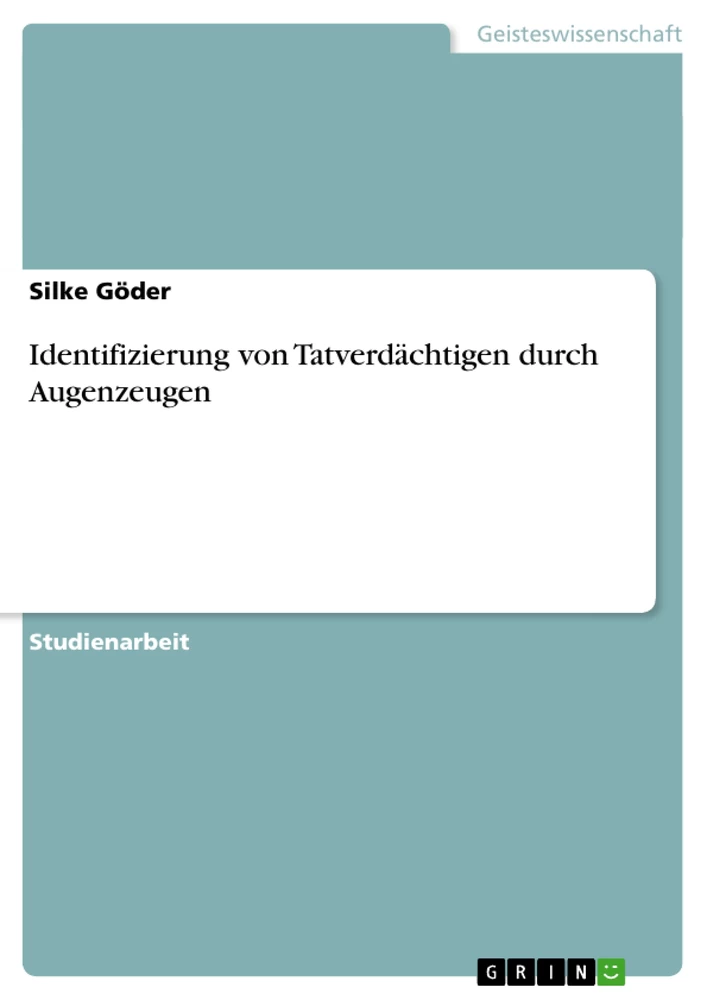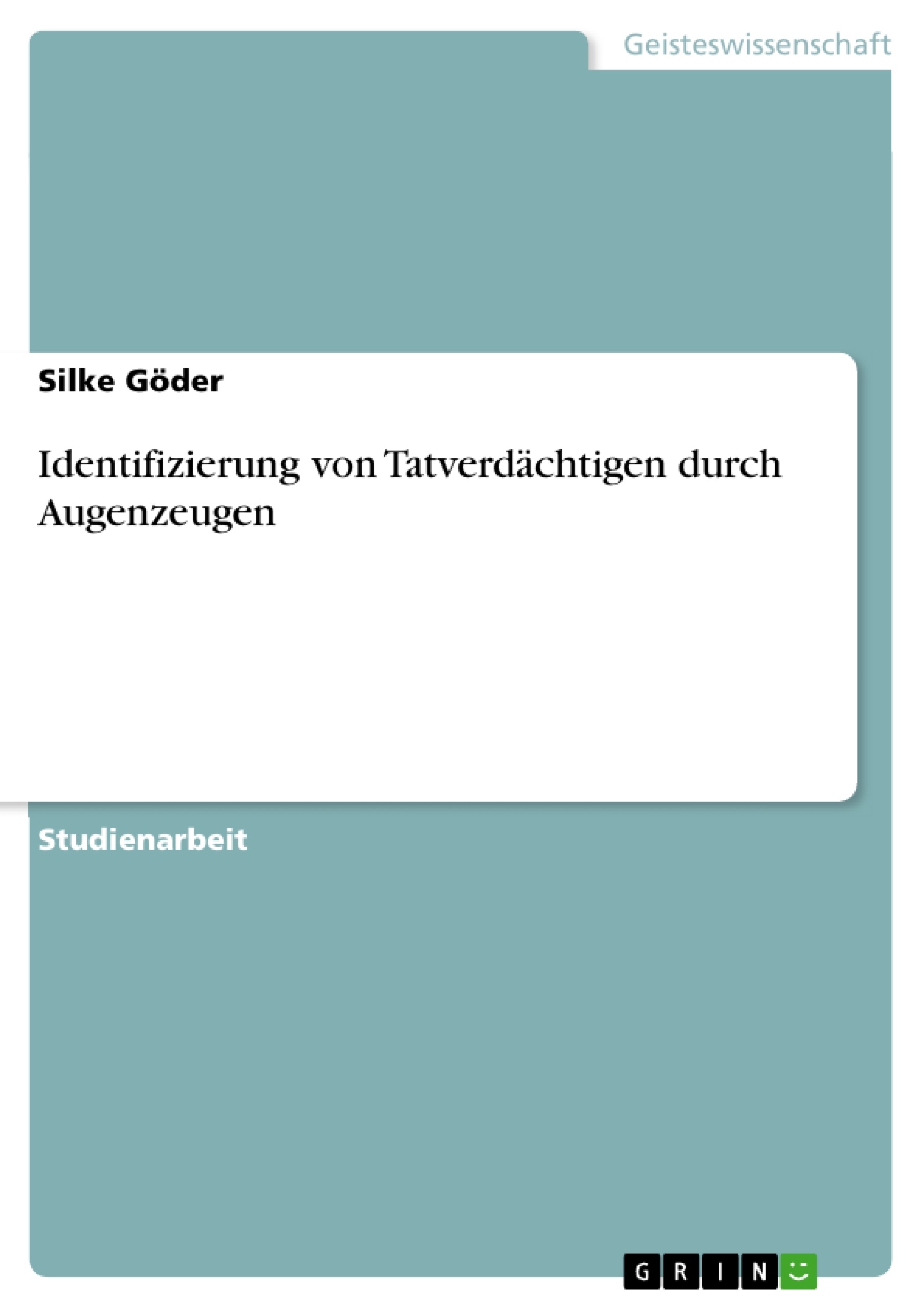In unserer Hausarbeit geht es um die Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen.
Eine solche Identifizierung erfolgt regelmäßig im Rahmen einer Gegenüberstellung.
Wie unter Punkt 2 noch genauer erläutert wird gibt es verschiedenen Formen der Gegenüberstellungen, wobei jede jeweils ihre Vor- und seine Nachteile hat.
Nun könnte man sich fragen, warum man dieses Thema in der Psychologie überhaupt behandelt. Gehört das nicht ausschließlich in das Fach "Kriminalistik" hinein?
Die Antwort ist ganz einfach.
In der Kriminalistik wird die Gegenüberstellung objektiv und sachlich dargestellt. Der Begriff wird erläutert und die verschiedenen Formen der Gegenüberstellung werden vorgestellt.
Die jeweiligen Vor- und Nachteile der bestimmten Gegenüberstellungsform beruhen jedoch meistens auf psychologischen Erkenntnissen.
Um in das Thema einzuführen und es verständlich zu machen wird auch in dieser Hausarbeit die Gegenüberstellung zunächst unter kriminalistischen Gesichtspunkten betrachtet
In der Psychologie muss man sich zu diesem Thema jedoch andere Fragen stellen, bzw. andere Probleme beachten.
Bei der korrekten Durchführung einer Gegenüberstellung sind sowohl kriminalistische als auch psychologische Aspekte zu beachten. Nur so hat der hohe Beweiswert einer Gegenüberstellung auch vor Gericht bestand.
Die Beurteilung der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit einer Täteridentifizierung durch Zeugen hängt von den verschiedensten psychologischen Kriterien, wie z.B. Intelligenz des Zeugen, Merkfähigkeit, Stress, Aussagequalität, Alter des Zeugen und noch vielem.
Wie behandeln in unserer Hausarbeit die Wichtigsten Themen zur Gegenüberstellung, indem wir zunächst den Begriff bestimmen, auf die Rechtsgrundlagen eingehen und schließlich die hauptsächlichen psychologische Aspekte ansprechen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Identifizierungsgegenüberstellung
- Die offene, gedeckte und verdeckte GGÜ
- Einzelgegenüberstellung
- Simultane und Sequenzielle Wahlgegenüberstellung
- Gegenüberstellung per Video
- Die akustische Gegenüberstellung
- Lichtbildvorlage und Lichtbildvorzeigekartei
- Rechtliche Aspekte und Probleme der Gegenüberstellung
- Gegenüberstellung von Kindern und Jugendlichen
- Wiedererkennen aus tatverdächtigen Gruppen
- Dokumentation der Wiedererkennungsverfahren
- Verfahren und Ablauf einer Gegenüberstellung
- Psychologie der Gegenüberstellung
- Zeugenfaktoren
- Kinder, Jugendliche und alte Personen als Zeugen
- Geschlecht des Zeugen
- Täterfaktoren
- Vermummung und Veränderung des Aussehens
- Geschlecht und Rasse der Zielperson
- Attraktivität und Auffälligkeit des Täters
- Situationsfaktoren
- Beleuchtungsverhältnisse
- Auffälligkeit des Täters im Wahrnehmungsfeld
- Bedrohung mit Waffen
- Stress, Erregung, Gewalt
- Zeitabstand zwischen Beobachtung und Identifizierung
- Suggestivwirkung
- Zeugenfaktoren
- Personenbeschreibung
- Grundsatz der Einmaligkeit
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen, wobei der Fokus auf der Gegenüberstellung als Verfahren liegt. Ziel ist es, die kriminalistischen und psychologischen Aspekte dieses Verfahrens zu beleuchten und deren Bedeutung für die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage zu verdeutlichen.
- Die verschiedenen Formen der Gegenüberstellung und deren Vor- und Nachteile.
- Die rechtlichen Aspekte und Probleme im Zusammenhang mit der Gegenüberstellung.
- Psychologische Faktoren, die die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage beeinflussen (Zeugenfaktoren, Täterfaktoren, Situationsfaktoren).
- Die Bedeutung der Personenbeschreibung für die Identifizierung.
- Der Grundsatz der Einmaligkeit einer Gegenüberstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen ein und begründet die Relevanz psychologischer Aspekte neben den kriminalistischen. Sie hebt die Bedeutung der korrekten Durchführung einer Gegenüberstellung für den Beweiswert vor Gericht hervor und benennt die zentralen Themen der Arbeit: Begriffsbestimmung, Rechtsgrundlagen und psychologische Aspekte.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Gegenüberstellung, unterscheidet zwischen Identifizierungs- und Vernehmungsgegenüberstellung und konzentriert sich auf die Identifizierungsgegenüberstellung als Kern des Themas. Es definiert die Identifizierungsgegenüberstellung als Verfahren zur Überprüfung der äußeren Erscheinung des Beschuldigten durch einen Zeugen und erwähnt die Möglichkeit sowohl optischer als auch akustischer Wiedererkennung.
Rechtliche Aspekte und Probleme der Gegenüberstellung: Dieser Abschnitt befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Gegenüberstellung. Er thematisiert spezifische Aspekte wie die Gegenüberstellung von Kindern und Jugendlichen, das Wiedererkennen aus Gruppen von Tatverdächtigen und die notwendige Dokumentation des Verfahrens. Der Fokus liegt auf den rechtlichen und prozeduralen Aspekten, um eine rechtssichere Durchführung zu gewährleisten.
Psychologie der Gegenüberstellung: Dieses Kapitel analysiert die psychologischen Einflüsse auf die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage. Es unterteilt diese Einflüsse in Zeugenfaktoren (z.B. Alter, Geschlecht), Täterfaktoren (z.B. Aussehen, Verhalten) und Situationsfaktoren (z.B. Lichtverhältnisse, Stress). Die detaillierte Betrachtung dieser Faktoren verdeutlicht die Komplexität der Zeugenaussage und deren potentielle Fehlerquellen.
Personenbeschreibung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Personenbeschreibung für die Identifizierung von Tatverdächtigen. Es wird die Relevanz genauer Beschreibungen der Merkmale des Täters hervorgehoben, um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Identifizierung durch Augenzeugen zu verbessern.
Grundsatz der Einmaligkeit: Dieser Abschnitt widmet sich dem Grundsatz der Einmaligkeit von Gegenüberstellungen, der die Durchführung nur einmalig zulässt, um die Objektivität und Glaubwürdigkeit des Verfahrens zu wahren und Suggestivwirkungen zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Augenzeugenidentifizierung, Gegenüberstellung, Zeugenpsychologie, Täterfaktoren, Situationsfaktoren, Rechtliche Aspekte, Wiedererkennung, Beweiswert, Glaubwürdigkeit, Personenbeschreibung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen: Die Gegenüberstellung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen, wobei der Schwerpunkt auf dem Verfahren der Gegenüberstellung liegt. Sie beleuchtet die kriminalistischen und psychologischen Aspekte dieses Verfahrens und deren Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Formen der Gegenüberstellung (z.B. offen, verdeckt, akustisch, mit Video) und deren Vor- und Nachteile, die rechtlichen Aspekte und Probleme (z.B. bei Kindern, Jugendlichen, Gruppen von Tatverdächtigen), psychologische Einflussfaktoren (Zeugenfaktoren, Täterfaktoren, Situationsfaktoren), die Bedeutung der Personenbeschreibung und den Grundsatz der Einmaligkeit einer Gegenüberstellung.
Welche Arten von Gegenüberstellungen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Gegenüberstellungen, inklusive offener, gedeckter und verdeckter Gegenüberstellungen, Einzelgegenüberstellungen, simultaner und sequenzieller Wahlgegenüberstellungen, Video- und akustischen Gegenüberstellungen sowie der Verwendung von Lichtbildvorlagen und Lichtbildvorzeigekarteien.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Gegenüberstellung, insbesondere mit der Gegenüberstellung von Kindern und Jugendlichen, dem Wiedererkennen aus Gruppen von Tatverdächtigen und der notwendigen Dokumentation des Verfahrens. Es wird auf die rechtssichere Durchführung des Verfahrens geachtet.
Welche psychologischen Faktoren beeinflussen die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage?
Die Arbeit analysiert Zeugenfaktoren (Alter, Geschlecht, etc.), Täterfaktoren (Aussehen, Verhalten, etc.) und Situationsfaktoren (Lichtverhältnisse, Stress, etc.), die die Zuverlässigkeit der Zeugenaussage beeinflussen können. Die Komplexität der Zeugenaussage und potentielle Fehlerquellen werden detailliert betrachtet.
Welche Rolle spielt die Personenbeschreibung?
Die Arbeit hebt die Bedeutung genauer Personenbeschreibungen für die erfolgreiche Identifizierung von Tatverdächtigen hervor. Genaue Beschreibungen der Merkmale des Täters erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Identifizierung.
Was versteht man unter dem Grundsatz der Einmaligkeit?
Der Grundsatz der Einmaligkeit besagt, dass eine Gegenüberstellung nur einmalig durchgeführt werden sollte, um die Objektivität und Glaubwürdigkeit des Verfahrens zu gewährleisten und Suggestivwirkungen zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Augenzeugenidentifizierung, Gegenüberstellung, Zeugenpsychologie, Täterfaktoren, Situationsfaktoren, Rechtliche Aspekte, Wiedererkennung, Beweiswert, Glaubwürdigkeit, Personenbeschreibung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Begriffsbestimmung, einen Abschnitt zu rechtlichen Aspekten und Problemen, einen Abschnitt zur Psychologie der Gegenüberstellung, einen Abschnitt zur Personenbeschreibung, einen Abschnitt zum Grundsatz der Einmaligkeit und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
- Citation du texte
- Silke Göder (Auteur), 2002, Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6189