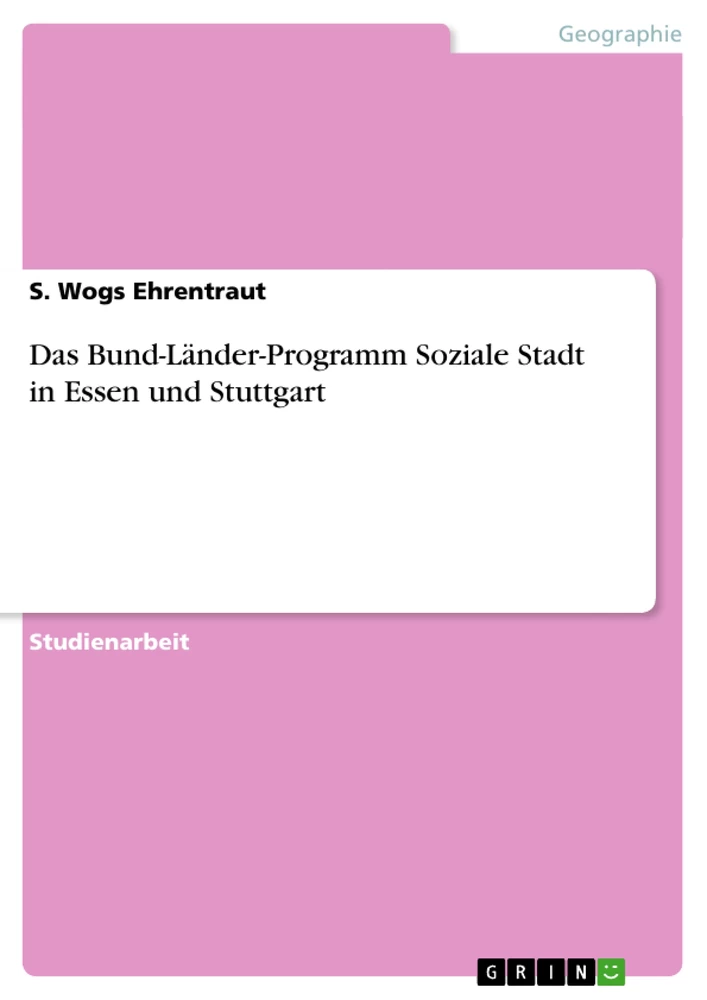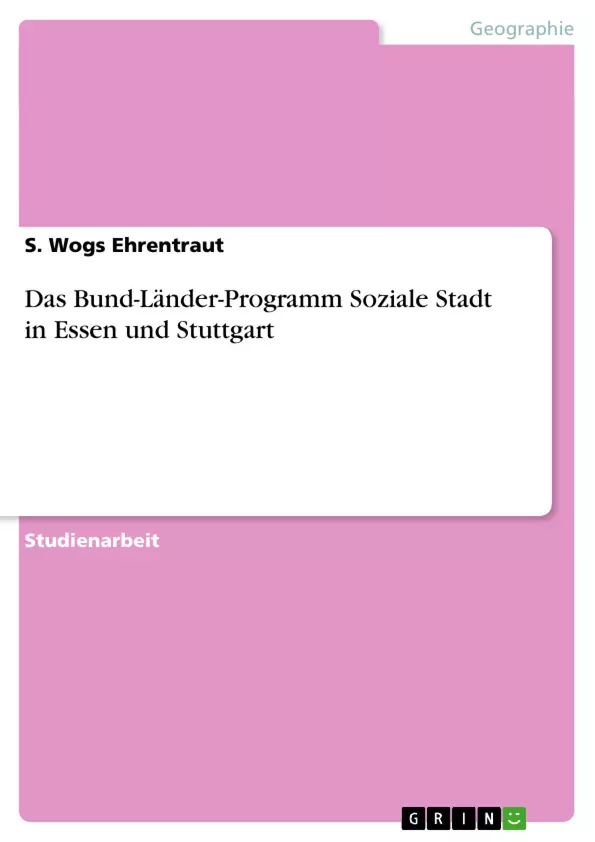Das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt“, im folgenden der Kürze halber „Soziale Stadt“ oder BLP genannt, wurde auf Bundesebene im Jahr 1999 gestartet, um der zunehmenden sozialen und räumlichen Spaltung in den Städten entgegenzuwirken. Dazu wurde der Paragraph §171e als Ergänzung zum „Stadtumbau“ neben den „Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen“, und den „Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen“ in das Baugesetzbuch (BauGB) aufgenommen. Ausgangssituation waren soziale Mißstände in benachteiligten Stadtquartieren. Durch den wirtschaftlichen Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, den Transformationsprozessen in den Neuen Bundesländern und durch die Globalisierung wurde in Deutschland im Verlauf der 1990er Jahre eine soziale Polarisierung begünstigt, die sich auch räumlich, etwa in Form von Segregation der Wohnbevölkerung in Städten, niederschlug. Dieser Trend wurde z.B. in Berlin durch das geschaffene Überangebot an Wohnraum noch weiter verschärft, insofern es die Mobilität von solventen Haushalten begünstigt. Die Entwicklung eines Stadtteils ist dann besonders problematisch, wenn einerseits durch selektive Abwanderung Bewohner der mittleren und oberen Einkommensschichten verloren gehen und andererseits, etwa infolge der städtischen Belegungspolitik, einkommensschwache Haushalte, deren Mitglieder am Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind, einquartiert werden. Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind vorprogrammiert, ein „sozialer Brennpunkt“ entsteht. Um ein Kippen des Stadtteils zu verhindern, die vielzitierte „Abwärtsspirale“ zu stoppen und die neuen sozialen Mißstände wenigstens abzumildern, wurde nach Vorbild von Programmen in den Niederlanden und nach Experimenten einzelner Bundesländer die Soziale Stadt auch auf Bundesebene umgesetzt. In dieser Arbeit wird weder eine quantitative Auswertung von Daten zum Themenkreis ‚Wohnen’ gegeben, noch werden Aussagen getroffen, welche auf alle Programmgebiete des BLP verallgemeinert werden könnten. Alles, was hier geleistet werden kann, ist eine gründliche Materialzusammenstellung zu den zwei ausgewählten Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der in ihnen durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt. Allerdings erlaube ich mir jeweils zum Abschluß der Fallbeispiele eine vorsichtige Einschätzung der künftigen Entwicklung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beispiel Essen-Altendorf
- 2.1. Vorstellung des Programmgebiets
- 2.2. Institutionalisierung der Sozialen Stadt
- 2.3. Maßnahmen der Sozialen Stadt
- 2.4. Ausblick
- 3. Beispiel Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld
- 3.1. Vorstellung des Programmgebiets
- 3.2. Institutionalisierung der Sozialen Stadt
- 3.3. Maßnahmen der Sozialen Stadt
- 3.4. Ausblick
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in den Beispielgebieten Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld. Ziel ist es, die Maßnahmen und die Institutionalisierung des Programms in diesen beiden Gebieten zu analysieren und eine vorsichtige Einschätzung der zukünftigen Entwicklung zu geben. Eine quantitative Datenanalyse oder Verallgemeinerung auf alle Programmgebiete wird nicht angestrebt.
- Institutionalisierung des Programms „Soziale Stadt“
- Maßnahmen zur sozialen Stadtentwicklung in Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld
- Analyse der sozialen Probleme in den ausgewählten Stadtteilen
- Bewertung der Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen
- Vorschau auf die zukünftige Entwicklung der Stadtteile
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ (BLP), dessen Ziel die Bekämpfung der sozialen und räumlichen Spaltung in Städten ist. Es erläutert die Hintergründe des Programms, die durch den wirtschaftlichen Strukturwandel und die Globalisierung verschärfte soziale Polarisierung und die Entstehung sozialer Brennpunkte. Die Arbeit fokussiert auf eine detaillierte Analyse der Maßnahmen in Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld, ohne quantitative Auswertungen oder Verallgemeinerungen.
2. Beispiel Essen-Altendorf: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Stadtteils Essen-Altendorf, seiner sozialen Probleme (Einkommensschwäche, Kriminalität etc.) und der Maßnahmen im Rahmen des BLP. Es wird die Institutionalisierung des Programms mit dem Quartiermanagement, den verschiedenen Akteuren (Stadt, ISSAB, Bürgerverein etc.) und ihren Rollen detailliert beschrieben. Die konkreten Maßnahmen, wie das Projekt „Fassadenkunst“ und die Neugestaltung der Grünanlage am Jahnplatz, werden erläutert und deren Bedeutung für die Bewohner hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und deren Beitrag zur sozialen Stadtentwicklung.
Schlüsselwörter
Soziale Stadt, Bund-Länder-Programm, Stadtentwicklung, soziale Spaltung, Quartiermanagement, Essen-Altendorf, Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld, Maßnahmen, soziale Probleme, soziale Brennpunkte, Stadtteilsanierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Sozialen Stadt in Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in den Beispielgebieten Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld. Der Fokus liegt auf der Analyse der Maßnahmen und der Institutionalisierung des Programms in diesen beiden Gebieten, um eine vorsichtige Einschätzung der zukünftigen Entwicklung zu geben. Quantitative Datenanalysen oder Verallgemeinerungen auf alle Programmgebiete werden nicht angestrebt.
Welche Gebiete werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Gebiete: Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld. Für jedes Gebiet werden die sozialen Probleme, die Maßnahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ und die beteiligten Akteure detailliert beschrieben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Institutionalisierung des Programms „Soziale Stadt“, die Maßnahmen zur sozialen Stadtentwicklung in den beiden Beispielgebieten, die Analyse der sozialen Probleme in den Stadtteilen, die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen und eine Vorschau auf die zukünftige Entwicklung der Stadtteile. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und deren Beitrag zur sozialen Stadtentwicklung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ und seine Hintergründe erläutert. Es folgen detaillierte Kapitel zu Essen-Altendorf und Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld, die jeweils die Vorstellung des Gebiets, die Institutionalisierung des Programms und die durchgeführten Maßnahmen behandeln. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse der Maßnahmen und der Institutionalisierung des Programms „Soziale Stadt“. Quantitative Datenanalysen oder Verallgemeinerungen werden explizit vermieden. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung und Analyse der Fallbeispiele.
Welche konkreten Maßnahmen werden in der Arbeit genannt?
Als Beispiel wird das Projekt „Fassadenkunst“ und die Neugestaltung der Grünanlage am Jahnplatz in Essen-Altendorf genannt. Weitere Maßnahmen in beiden Gebieten werden detailliert im jeweiligen Kapitel beschrieben.
Welche Akteure sind an der Umsetzung des Programms beteiligt?
An der Umsetzung des Programms sind verschiedene Akteure beteiligt, darunter die Stadtverwaltung, das Quartiermanagement (z.B. ISSAB in Essen-Altendorf), Bürgervereine und weitere lokale Organisationen. Die Rollen und die Zusammenarbeit der Akteure werden in der Arbeit analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Stadt, Bund-Länder-Programm, Stadtentwicklung, soziale Spaltung, Quartiermanagement, Essen-Altendorf, Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld, Maßnahmen, soziale Probleme, soziale Brennpunkte, Stadtteilsanierung.
- Quote paper
- S. Wogs Ehrentraut (Author), 2006, Das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt in Essen und Stuttgart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62059