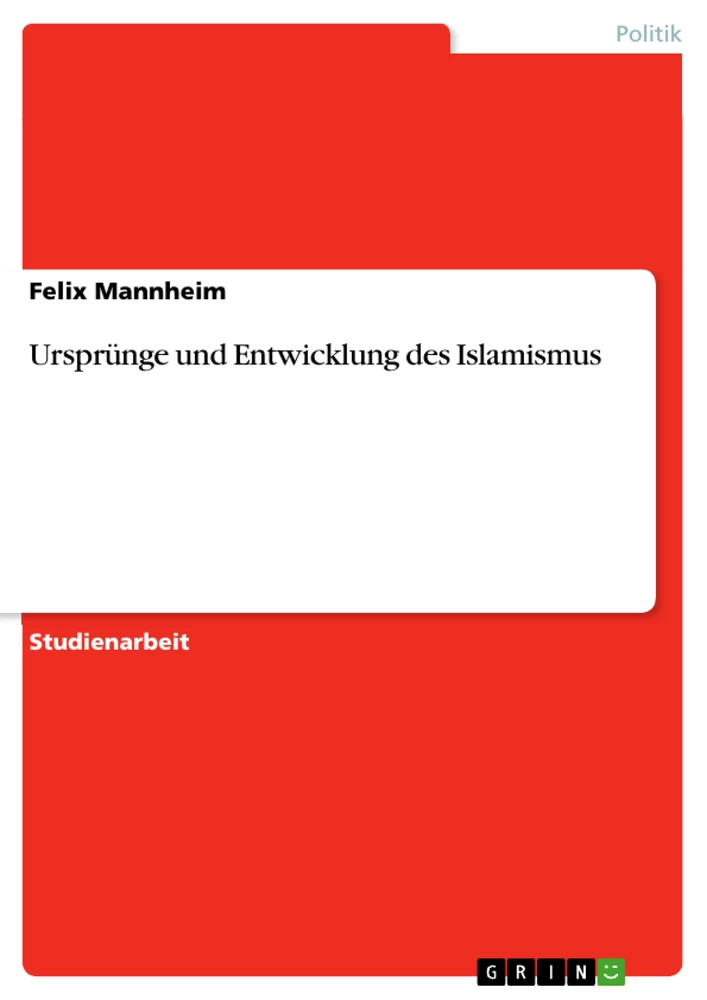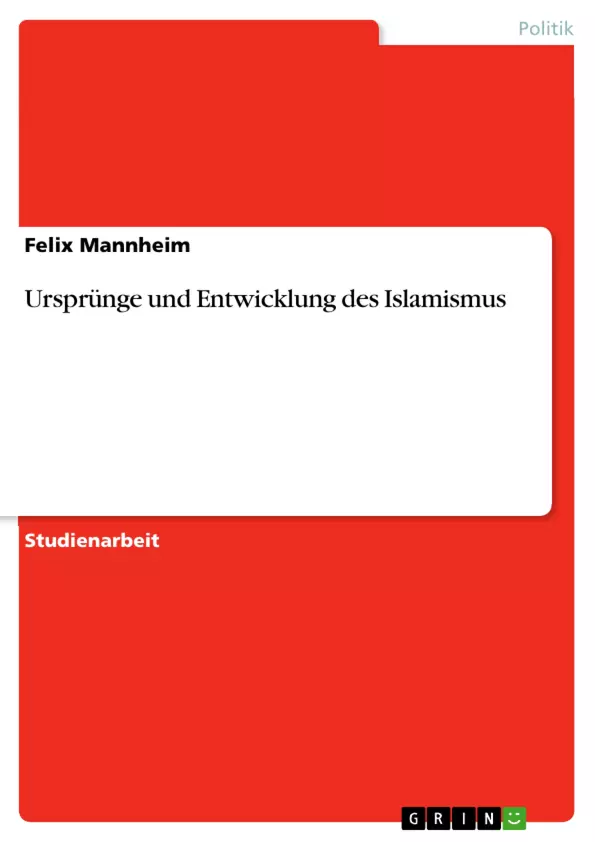Nie war das Thema Fundamentalismus aktueller als in Folge auf den 11. September – und nie war es schwerer, darüber zu schreiben. Politiker argumentierten in Reaktion auf die Terroranschläge weltweit, dass der islamistische Terrorismus eine transkontinentale Bedrohung sei und bekämpft werden müsse. Der amerikanische Präsident George W. Bush sprach vom Kampf Gut gegen Böse, den Amerika gewinnen werde. Immer wieder wurde in Folge des Terroranschlags Samuel Huntington zitiert, der einen „Kampf der Kulturen“ voraussagte.
Doch was ist der Nährboden für die Radikalisierung und Politisierung des Islams? Wie groß ist der Beitrag des Westens? Ist das Problem der Islam selbst, oder ist die Radikalisierung eine Folge der Bedrängung durch die christliche Vormachtstellung im 20. Jahrhundert? Dafür spräche, dass der Islam eine tolerante Religionsgemeinschaft war, als er im Mittelalter die vorherrschende Institution darstellte. Und: Steht Ussama Bin Ladens Al-Quaida, die für die Eskalation der Gewalt verantwortlich gemacht wird, isoliert da oder folgt sie einem weit verbreiteten, ursprünglich religiös motivierten Gedankengut? In diesem Zusammenhang stellt sich zwangsläufig die Frage, wie die Bilder jubelnder Muslime ob der schrecklichen Bilder des brennenden Weltwirtschaftszentrums zu erklären sind.
Kaum einer der Kommentatoren zur Entwicklung nach dem 11. September kam ohne die Worte: „Jetzt ist alles anders“ aus. Ist wirklich alles anders? Muss jetzt alles anders sein? Und: Wie kann dieses „Anders“ aussehen? Wie könnte für ein friedvolleres Miteinander gesorgt werden? Durch Interventionen, Liquidierungen und Truppenstationierungen? Oder doch eher durch den entschlosseneren Versuch dem Islam seinen Raum zuzugestehen, seine politische Kultur zu respektieren und für einen faireren Welthandel zu sorgen, der scheinbare Globalisierungsverlierer aus ihrem aufgestauten Frust befreien könnte?
Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen, den Begriff des Islamismus zu klären und seinen Ursprung zu ergründen. Dann werde ich mich an die heutige Zeit und die aktuelle Entwicklung heranarbeiten, versuchen, den Gründen für den Zulauf zu fundamentalistischen Vereinigungen nachzugehen und Ansätze aufzuzeigen, die zu einem Zusammenrücken der Kulturen führen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktuelle Schwierigkeiten im Umgang mit dem Thema
- Die Fragen im Angesicht von „Ground Zero“
- Vorgehensweise
- Hauptteil
- Begriffsklärung
- Ursprünge des Islamismus
- Ein Abwehrkampf
- Wiederaufleben des Islamismus in den 60ern
- Islamismus um die Jahrhundertwende
- Islamismus in Deutschland
- Schlussfolgerungen
- Kein „Kampf der Kulturen“
- Nachhaltige Politik ist nötig
- Christen brauchen keine Zuflucht
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Phänomen des Islamismus und analysiert die Hintergründe und Ursachen für seine Entwicklung. Sie strebt eine umfassende Erörterung des Themas an, um die aktuelle Situation besser zu verstehen und mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten.
- Die Entstehung und Entwicklung des Islamismus
- Die Radikalisierung des Islams und seine Ursachen
- Der Einfluss des Westens und der globale Kontext
- Die Rolle des Islamismus in der heutigen Welt
- Mögliche Ansätze für ein friedliches Miteinander der Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte über den Islamismus im Kontext der Ereignisse vom 11. September 2001. Sie stellt die Herausforderung dar, die es für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema in dieser Zeit gibt, da die aktuelle Situation die Debatte dominiert und erschwert. Der Text stellt die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Islamismus und der Rolle des Westens in diesem Konflikt.
Hauptteil
Der Hauptteil beginnt mit einer Begriffsklärung, die verschiedene Begriffsbedeutungen und Perspektiven auf den Islamismus beleuchtet. Anschließend werden die historischen Ursprünge des Islamismus und seine Entwicklung im Laufe der Zeit untersucht. Der Text beleuchtet die verschiedenen Formen des Islamismus, von der politischen Partizipation bis hin zu militanten Bewegungen.
Schlüsselwörter
Islamismus, Fundamentalismus, Radikalisierung, Terrorismus, Islam, Westen, Kulturen, Globalisierung, Politik, Geschichte, Toleranz, Gewalt, Religion, Kultur, Politik, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Nährboden für Islamismus?
Radikalisierung entsteht oft aus Frust über Globalisierungsverluste, politische Unterdrückung und die Reaktion auf die christlich-westliche Vormachtstellung.
Gibt es einen „Kampf der Kulturen“?
Die Arbeit diskutiert Huntingtons These kritisch und plädiert stattdessen für einen faireren Welthandel und Respekt vor politischen Kulturen des Islams.
Wann erlebte der Islamismus ein Wiederaufleben?
Ein bedeutendes Wiederaufleben fand in den 1960er Jahren statt, sowie verstärkt um die Jahrhundertwende.
Ist der Islam von Natur aus intolerant?
Nein, die Arbeit verweist darauf, dass der Islam im Mittelalter eine sehr tolerante Religionsgemeinschaft war, als er die vorherrschende Institution darstellte.
Welche Rolle spielt die Politik des Westens?
Interventionen und Truppenstationierungen werden oft als Provokation wahrgenommen; nachhaltige Politik und fairer Handel könnten zur Deeskalation beitragen.
- Citation du texte
- Felix Mannheim (Auteur), 2001, Ursprünge und Entwicklung des Islamismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6214