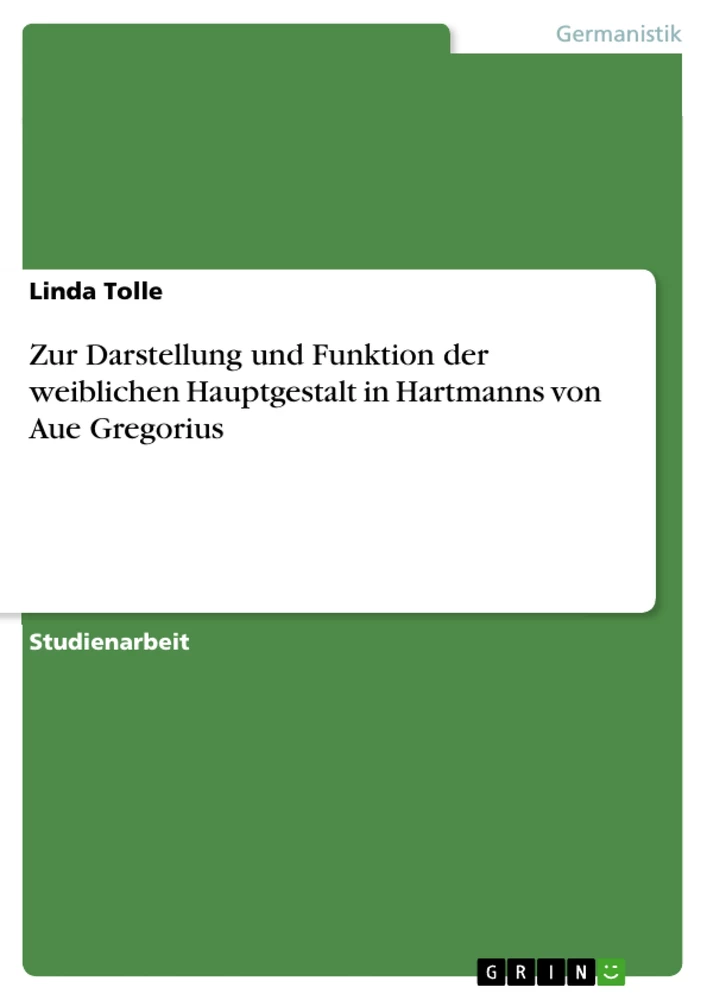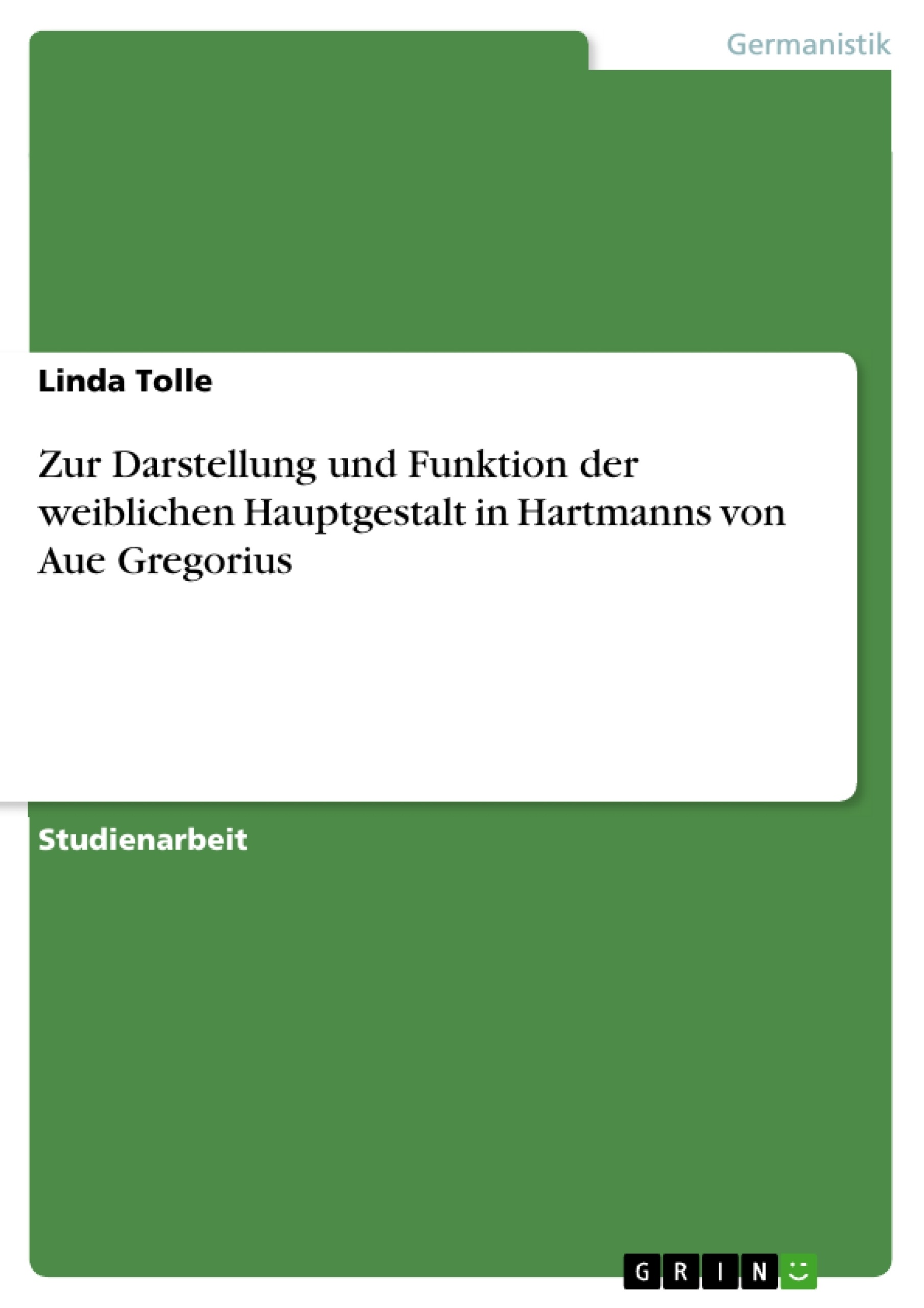Im Hochmittelalter, das sich etwa vom zehnten bis zum dreizehnten Jahrhundert erstreckte, war die rechtliche wie auch die gesellschaftliche Stellung der Frau eine völlig andere als heutzutage. Grundsätzlich hatte die Frau dieser Zeit eine schwächere Rechtsstellung als der Mann und war diesem, ob es nun der Ehemann oder die männlichen Verwandten waren, unterworfen. So hatte der Vater einer unverheirateten Frau die Befugnis diese mit einem Mann zu verheiraten, um so z.B. seine gesellschaftliche Stellung zu heben oder zu sichern. Trotz allem durften die Männer nicht willkürlich über die Frauen entscheiden. Ihnen waren, auch wenn die Frau erst relativ spät in die öffentliche Gesetzgebung aufgenommen wurde, rechtliche Schranken gesetzt. Beispielsweise waren Tötung und Verstoßung nur in Ausnahmefällen erlaubt, der Inzest verboten und der Ehemann musste sich an die vertragliche Bindung an die Familie seiner Ehefrau halten. Trotz der vielen allgemeingültigen Regeln und Normen für Frauen, gab es in dieser Zeit erhebliche Unterschiede in deren Leben, die gesellschaftlichen Stände betreffend. Einer Dame aus adliger Gesellschaft war es z.B. möglich einen Anteil an der Machtausübung zu erlangen. Vor allem in kriegerischen Zeiten war sie als Repräsentantin ihres Mannes Landesherrin und verfügte über Macht. Auch durfte die Adlige über ihren Besitz und ihr Vermögen selbst bestimmen, wozu auch Grundbesitz gehörte, obwohl sie, streng genommen, ihrem Ehemann oder Vater unterworfen war. Die Rolle der Frau erfüllt in den Epen Hartmann von Aues (im Folgenden Hartmann genannt) eine zentrale Funktion in der Entwicklung des Protagonisten. Im Folgenden möchte ich auf diese Funktion und die Darstellung der Frau im Gregorius eingehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptgestalt
- 2.1 Zusammenfassung Gregorius
- 2.2 Die Schwester-Mutter-Gattin
- 2.2.1 Der erste Inzest
- 2.2.2 Der zweite Inzest
- 2.2.3 Wiedersehen in Rom
- 2.3 Die Namenlosigkeit
- 3. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptgestalt im Epos „Gregorius“ von Hartmann von Aue. Sie analysiert, wie die Frau in den verschiedenen Handlungsphasen des Werkes dargestellt wird und welche Rolle sie für die Entwicklung des Protagonisten spielt. Besonderes Augenmerk wird auf die Ambivalenz der weiblichen Hauptgestalt als Schwester, Mutter und Gattin gelegt.
- Darstellung der weiblichen Hauptgestalt im „Gregorius“
- Funktion der Frau für die Entwicklung des Protagonisten
- Die Ambivalenz der weiblichen Hauptgestalt als Schwester, Mutter und Gattin
- Die Bedeutung der Namenlosigkeit für die weibliche Hauptgestalt
- Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Hochmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die gesellschaftliche Stellung der Frau im Hochmittelalter und führt in die Thematik der Arbeit ein. Kapitel 2 analysiert die Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptgestalt in „Gregorius“. Es werden die verschiedenen Handlungsphasen des Werkes betrachtet, in denen die Frau auftritt, und ihre Rolle für die Entwicklung des Protagonisten untersucht.
Kapitel 2.1 bietet eine Zusammenfassung der Geschichte des „Gregorius“. In Kapitel 2.2 werden die drei Handlungsorte, an denen die Frau auftritt, genauer betrachtet: der erste Inzest in Aquitanien, der zweite Inzest in Aquitanien und das Wiedersehen in Rom.
Kapitel 2.3 befasst sich mit der Namenlosigkeit der weiblichen Hauptgestalt und deren Bedeutung im Kontext der Geschichte.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Gregorius, Epos, Hochmittelalter, Frau, Gesellschaftliche Stellung, Darstellung, Funktion, Schwester, Mutter, Gattin, Inzest, Namenlosigkeit, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Frau in Hartmanns „Gregorius“?
Die weibliche Hauptgestalt erfüllt eine zentrale Funktion für die Entwicklung und die Sühne des Protagonisten Gregorius.
Was bedeutet die Ambivalenz als Schwester, Mutter und Gattin?
Durch die Inzest-Thematik nimmt die Frau gleichzeitig widersprüchliche Rollen ein, was die moralische Komplexität des Epos ausmacht.
Warum bleibt die weibliche Hauptgestalt namenlos?
Die Namenlosigkeit unterstreicht ihre funktionale Rolle im Werk und spiegelt die gesellschaftliche Unterordnung der Frau im Hochmittelalter wider.
Wie war die rechtliche Stellung der Frau im Hochmittelalter?
Frauen waren rechtlich meist ihrem Ehemann oder Vater unterworfen, besaßen aber je nach Stand (z. B. Adel) durchaus Einflussmöglichkeiten.
Was sind die drei zentralen Handlungsorte der Frau im Werk?
Die Handlung konzentriert sich auf den ersten Inzest, den zweiten Inzest in Aquitanien und das abschließende Wiedersehen in Rom.
- Arbeit zitieren
- Linda Tolle (Autor:in), 2006, Zur Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptgestalt in Hartmanns von Aue Gregorius, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62206