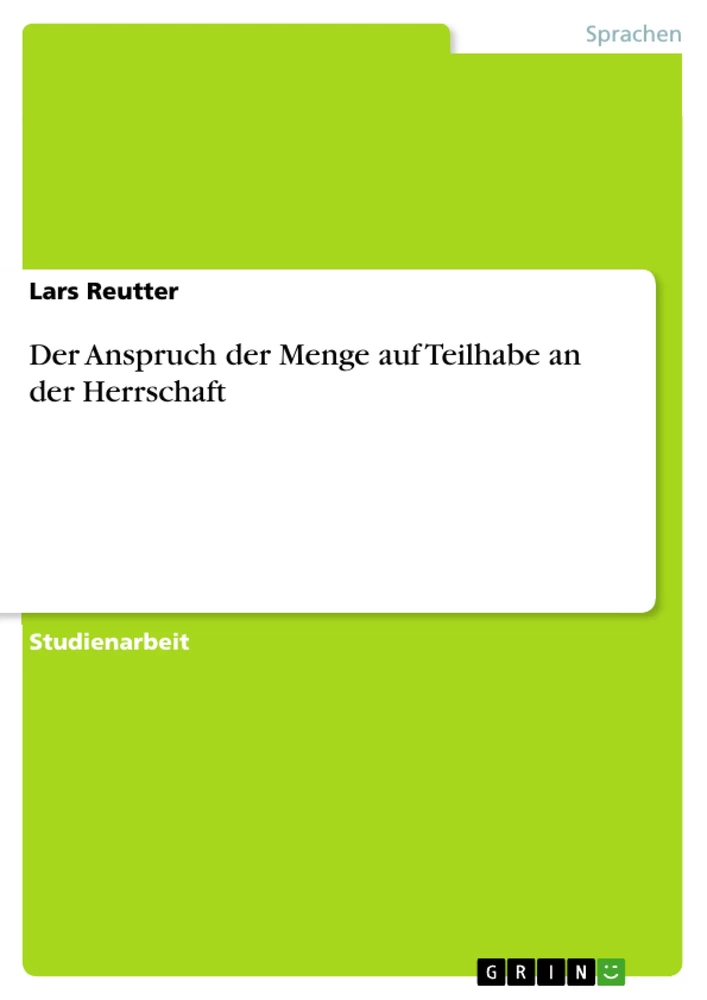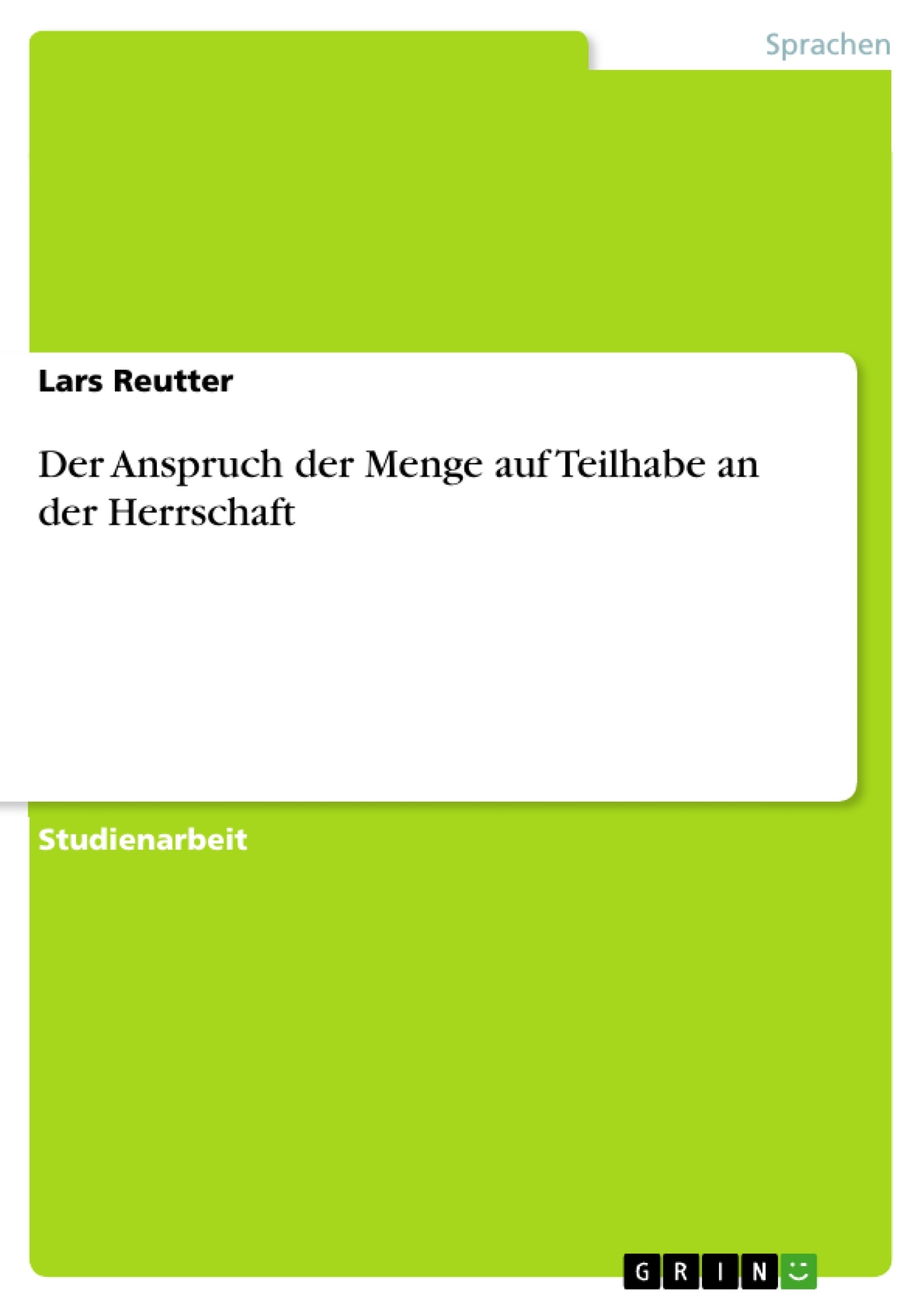Die folgende Arbeit ist im Rahmen des von Herrn Prof. Dr. Gert Ueding geleiteten Rhetorik-Hauptseminars „Der Begriff des Politischen bei Platon und Aristoteles“ entstanden. Dabei dient das von mir im Verlauf dieses Seminars gehaltene Referat zum Thema „Die Kapitel sechs bis elf im dritten Buch der „Politik“ Aristoteles“ als Grundlage“. Im Gegensatz zum Referat werden jedoch nicht alle Kapitel im gleichen Umfang behandelt, sondern der Schwerpunkt auf die Frage der Teilhabe der Menge an der Herrschaft gesetzt. Insofern hier nun nur ein kurzer Überblick über die Kapitel in deren Kontext die Fragestellung eingebettet ist. Zu Beginn des sechsten Kapitels steht eine Verfassungsdefinition. Im Anschluss daran bemerkt Aristoteles, dass eine gute Verfassung vorliegt, wenn das Gemeinwohl gewahrt wird und eine schlechte, entartete Verfassung, wenn der Herrscher nur den eigenen Nutzen im Sinn hat. Auf dieser Grundlage stellt er im siebten Kapitel ein Verfassungsschema von guten und entarteten Verfassungen auf. Auf der Seite der Guten nennt er dabei die Monarchie, die Aristokratie und die Politeia und auf der Seite der entarteten die Tyranis, die Oligarchie und die Demokratie. Im achten Kapitel erfolgt eine nähere Definition der entarteten Verfassungen, die jedoch für die weitere Thematik der Arbeit nicht von belang ist. Im neunten Kapitel illustriert Aristoteles anhand des Streits zwischen Anhängern der Oligarchie und Anhängern der Demokratie, welche Gründe vorgebracht werden, um den eigenen Anspruch auf Herrschaft zu legitimieren. Auch das zehnte Kapitel widmet sich der Thematik des Herrschaftsanspruchs. Da der Frage nach dem Recht zu Herrschen im Anschluss an diese Einleitung weiter nachgegangen wird, soll an dieser Stelle auf eine Wiedergabe der Argumente verzichtet werden. Schließlich stellt Aristoteles im elfen Kapitel das Summierungsprinzip vor, mit dessen Hilfe er die Teilhabe der Menge an der Herrschaft begründet. Auf der Vorstellung, den Einwänden und den Folgen dieses Prinzips wird der Schwerpunkt dieser Abhandlung liegen. Mit der Ankündigung, dass im nächsten Kapitel der Frage nach dem Anspruch zu herrschen nachgegangen wird und sich der Hauptteil mit der Behandlung des Summierungsprinzips beschäftigt, ist auch schon die grobe Gliederung der Arbeit gegeben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wer hat das Recht zu herrschen
- Durch das Summierungsverfahren zur Herrschaft
- Das Prinzip des Summierungsverfahrens
- Wie kommt es zur Summierung
- Einwände
- Die Kompetenzen der „Menge“ nach der Summierung
- Fazit: „Wir wollen mehr Demokratie wagen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Frage der Teilhabe der „Menge“ an der Herrschaft im Kontext des dritten Buches der „Politik“ von Aristoteles. Sie befasst sich insbesondere mit den Kapiteln sechs bis elf, wobei das Summierungsprinzip im Zentrum steht. Das Ziel ist es, Aristoteles’ Argumentation für die Teilhabe der „Menge“ an der Herrschaft zu verstehen und zu analysieren.
- Das Recht zu herrschen
- Das Summierungsprinzip
- Die Kompetenzen der „Menge“
- Die Bedeutung von Tugend und Fähigkeiten
- Die Anwendung des Summierungsprinzips auf moderne Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Arbeit im Rahmen des Rhetorik-Hauptseminars „Der Begriff des Politischen bei Platon und Aristoteles“ erläutert. Anschließend wird die Frage nach dem Recht zu herrschen im Werk der „Politik“ von Aristoteles untersucht, wobei insbesondere die Rolle von Tugend und Fähigkeiten als Anspruchsgrundlage hervorgehoben wird. Im Anschluss an diese grundlegende Erörterung wird das Summierungsprinzip als Mittel zur Begründung der Teilhabe der „Menge“ an der Herrschaft vorgestellt und analysiert.
Das Summierungsprinzip wird in mehreren Schritten erklärt, wobei auch Einwände gegen dieses Prinzip berücksichtigt werden. Schließlich werden die Kompetenzen der „Menge“ im Kontext der Herrschaft diskutiert. Im Fazit wird die Frage aufgeworfen, ob und wie das Summierungsprinzip auf den Ausbau der Kompetenzen des deutschen Volks in politischen Angelegenheiten angewandt werden könnte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die „Politik“ von Aristoteles, das Recht zu herrschen, das Summierungsprinzip, die Teilhabe der „Menge“ an der Herrschaft, Tugend, Fähigkeiten, Demokratie und politische Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Aristoteles unter dem Summierungsprinzip?
Das Summierungsprinzip besagt, dass eine Menge von Menschen, obwohl jeder Einzelne vielleicht nicht hervorragend ist, in der Summe über mehr Tugend und Einsicht verfügen kann als ein einzelner Bestmöglicher.
Welche Verfassungsformen unterscheidet Aristoteles?
Er unterscheidet gute Verfassungen (Monarchie, Aristokratie, Politeia) von entarteten Verfassungen (Tyrannis, Oligarchie, Demokratie), wobei das Gemeinwohl das entscheidende Kriterium ist.
Wer hat laut Aristoteles das Recht zu herrschen?
Aristoteles untersucht verschiedene Ansprüche, wobei Tugend und politische Fähigkeiten als zentrale Grundlagen für den Herrschaftsanspruch gelten.
Welche Kompetenzen gesteht Aristoteles der „Menge“ zu?
Durch die Summierung kann die Menge berechtigt sein, an Beratungen und gerichtlichen Entscheidungen teilzunehmen, auch wenn sie nicht für die höchsten Einzelämter geeignet ist.
Ist das Summierungsprinzip auf die moderne Demokratie anwendbar?
Die Arbeit zieht Parallelen zur heutigen Zeit und fragt, ob dieses Prinzip eine stärkere politische Teilhabe des Volkes rechtfertigen könnte.
- Quote paper
- Lars Reutter (Author), 2005, Der Anspruch der Menge auf Teilhabe an der Herrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62221