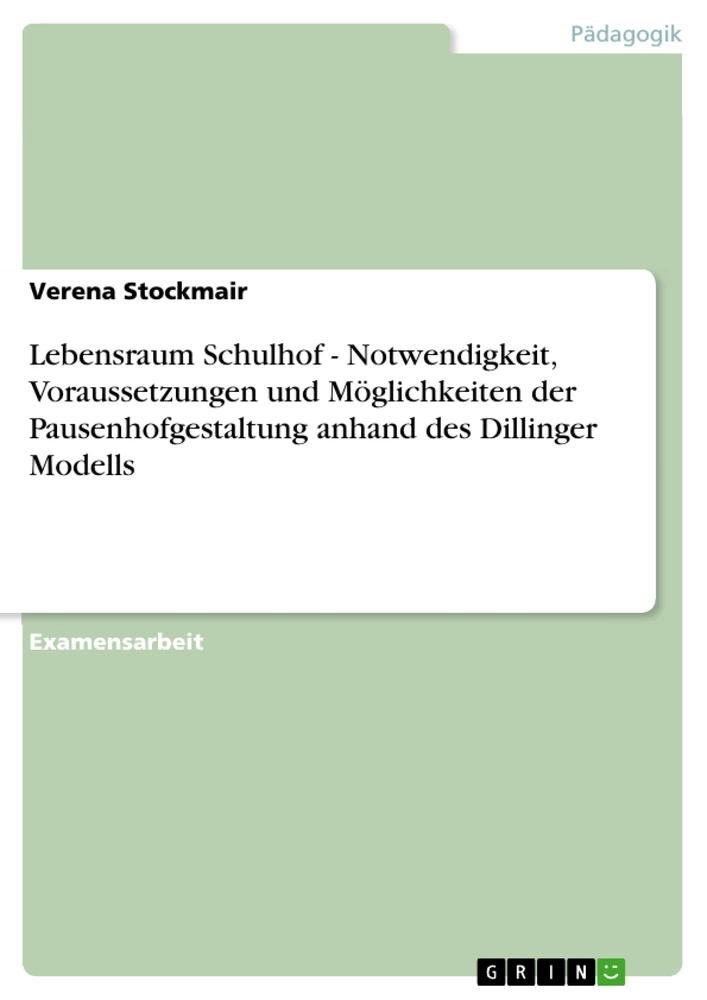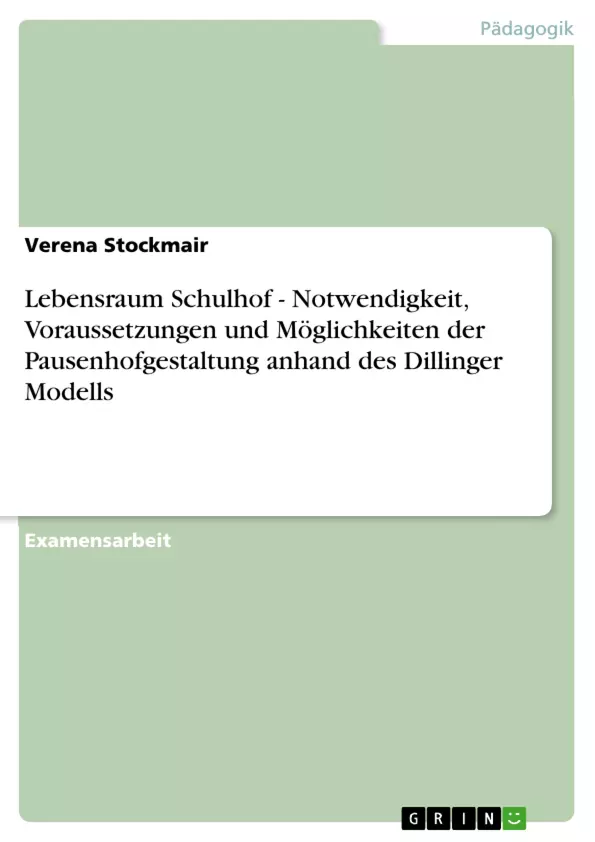Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, fällt mir eine Situation ganz zu Beginn meines ersten Schuljahres ein. Ich stand mit meiner neuen Freundin an den dicken Stamm des mehr oder weniger einzigen auf dem Pausenhof zugänglichen Baumes gelehnt. Während ansonsten der gesamte Pausenhof asphaltiert war, gab es an einem Ende ein kleines Wiesenfleckchen inmitten dessen dieser Baum stand. Im Nachhinein nehme ich an, dass ich noch ganz neu in der Schule mit dem großen, grauen leblosen Platz nichts anzufangen wusste. Später habe ich dann gelernt mich mit dem Vorhandenen zu arrangieren, den Sitzgelegenheiten, dem für die Fahrradprüfung aufgezeichneten Straßennetz, sowie den aufgemalten Hüpfspielen. Da ich mir keinen anderen Pausenhof vorstellen konnte, war ich mit dem meiner Schule durchaus zufrieden. Trotzdem wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, jemals meine Freizeit auf dem Schulhof zu verbringen, denn jede natürliche Umgebung, wie Wiesen, der Waldrand, unser Garten, jeder noch so einfach ausgestattete Spielplatz erschien mir attraktiver.
Als ich anfing für diese Arbeit zu recherchieren, war ich sofort begeistert von den für mich zu dieser Zeit völlig neuen Ideen, mit Hilfe derer Pausenhöfe geschaffen wurden, wie ich sie mir als Kind gewünscht hätte, die es schaffen, eine Verbindung zwischen Schulzeit und Freizeit herzustellen.
Aus der Zeitung entnahm ich, dass sich auch meine alte Grundschule entschlossen hatte, den Pausenhof umzugestalten und sofort entschloss ich mich das Vorhaben mitzuverfolgen und die ersten Reaktionen und Bewertungen der Schüler mit in meine Arbeit zu integrieren. Dass die Schüler vor der Umgestaltung denselben, mir noch sehr vertrauten Schulhof genutzt hatten, wie ich zu meiner Schulzeit, machte die Sache für mich persönlich umso spannender.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Lebensraum Schulhof. Notwendigkeit, Voraussetzungen und Möglichkeiten der Pausenhofgestaltung anhand des Dillinger Modells.
- Historischer Überblick
- Das Schulgebäude als Teil des Kirchenkomplexes
- Die Pausen dienen der Erholung
- Asphalt und Beton dominieren
- Ein Umdenken setzt ein
- Das Schulkind aus erziehungswissenschaftlicher Sicht
- Bedeutung der Bewegung
- Bedeutung des Spiels
- Bedeutung der Kreativität
- Bedeutung der Natur
- Zusammenfassung
- Anforderungen an einen kindgemäßen Pausenhof
- Funktionen der Schulpause
- Sicherheit auf dem Pausenhof
- Nutzung des Schulhofes
- Das Dillinger Modell
- Das 100-Schulhöfe-Programm
- Das Konzept
- Der Projektplan
- Zusammenfassung
- Ergebnisse der Umgestaltung am Beispiel der Josef-Dosch-Grundschule Gauting
- Die Gegebenheiten und die Vorgehensweise der Schule
- Der Fragebogen und dessen Auswertung
- Ergebnisse der Befragung
- Zusammenfassung und Transfer
- Inwieweit entspricht das Dillinger Modell dem derzeitigen Stand der Wissenschaft?
- Ist das Dillinger Modell strikt durchführbar?
- Welche Konsequenzen können andere Schulen aus den Erfahrungen in Gauting ziehen?
- Historische Entwicklung des Pausenhofes
- Bedürfnisse des Schulkindes: Bewegung, Spiel, Kreativität, Natur
- Anforderungen an einen kindgemäßen Pausenhof
- Das Dillinger Modell: Konzept, Projektplan, Ergebnisse
- Wissenschaftliche Grundlagen, Durchführbarkeit und Transfer des Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Arbeit ist es, die Notwendigkeit, Voraussetzungen und Möglichkeiten der Pausenhofgestaltung anhand des Dillinger Modells zu beleuchten. Dazu wird zunächst ein historischer Überblick über die Entwicklung des Pausenhofes gegeben. Anschließend werden die Bedürfnisse des Schulkindes aus erziehungswissenschaftlicher Sicht betrachtet, insbesondere die Bedeutung von Bewegung, Spiel, Kreativität und Natur. Im Anschluss daran werden Anforderungen an einen kindgemäßen Pausenhof erörtert, wie z.B. die Funktionen der Schulpause, die Sicherheit auf dem Pausenhof und die optimale Nutzung des Schulgeländes. Die Arbeit stellt dann das Dillinger Modell vor und analysiert dessen Konzept, den Projektplan und die Ergebnisse der Umgestaltung an der Josef-Dosch-Grundschule Gauting. Schließlich werden die wissenschaftlichen Grundlagen des Modells, die Durchführbarkeit und der Transfer auf andere Schulen diskutiert.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das Kapitel „Lebensraum Schulhof“ beginnt mit einem historischen Überblick über die Entwicklung des Pausenhofes vom Kirchenkomplex zur heutigen Betonwüste. Es werden die verschiedenen Ansätze und Forderungen zur Pausenhofgestaltung im Laufe der Geschichte aufgezeigt. Im Kapitel „Das Schulkind“ werden die erziehungswissenschaftlichen Aspekte der Bewegung, des Spiels, der Kreativität und der Natur als zentrale Momente in der Entwicklung des Kindes beleuchtet. Das Kapitel „Anforderungen an einen kindgemäßen Pausenhof“ beleuchtet die Funktionen der Schulpause, die Sicherheitsbedenken und die optimale Nutzung des Schulhofes.
Das Kapitel „Das Dillinger Modell“ stellt das Konzept und den Projektplan des Dillinger Modells vor, das eine naturnahe und kindgerechte Gestaltung schulischer Außenanlagen mit aktiver Benutzerbeteiligung zum Ziel hat. Es wird das 100-Schulhöfe-Programm der bayerischen Regierung vorgestellt und die zentralen Elemente des Dillinger Modells, wie Benutzerbeteiligung, Lokale Agenda 21, Entsiegelung, Natürliche Modellierung, Raumgliederung und Prozessgedanke, erörtert.
Das Kapitel „Ergebnisse der Umgestaltung“ beschreibt die Umgestaltung des Pausenhofes an der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting, die sich an das Dillinger Modell anlehnte, aber nicht am 100-Schulhöfe-Programm teilnahm. Es wird die Vorgehensweise der Schule, die Durchführung des Projekts und die Ergebnisse einer Fragebogenaktion unter den Schülern vorgestellt.
Das Kapitel „Zusammenfassung und Transfer“ analysiert das Dillinger Modell im Hinblick auf seine wissenschaftlichen Grundlagen und die Durchführbarkeit des Konzeptes. Es werden die Erfahrungen der Josef-Dosch-Grundschule Gauting aufgezeigt und die Konsequenzen für andere Schulen erörtert, die eine Pausenhofumgestaltung planen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Pausenhofgestaltung, Dillinger Modell, Benutzerbeteiligung, Lokale Agenda 21, Entsiegelung, Natürliche Modellierung, Raumgliederung, Prozessgedanke, Bewegung, Spiel, Kreativität, Natur, Schulpause, Sicherheit, Nutzung, Freiluftklasse, Schulgarten, Umwelterziehung.
- Citation du texte
- Verena Stockmair (Auteur), 2005, Lebensraum Schulhof - Notwendigkeit, Voraussetzungen und Möglichkeiten der Pausenhofgestaltung anhand des Dillinger Modells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62277