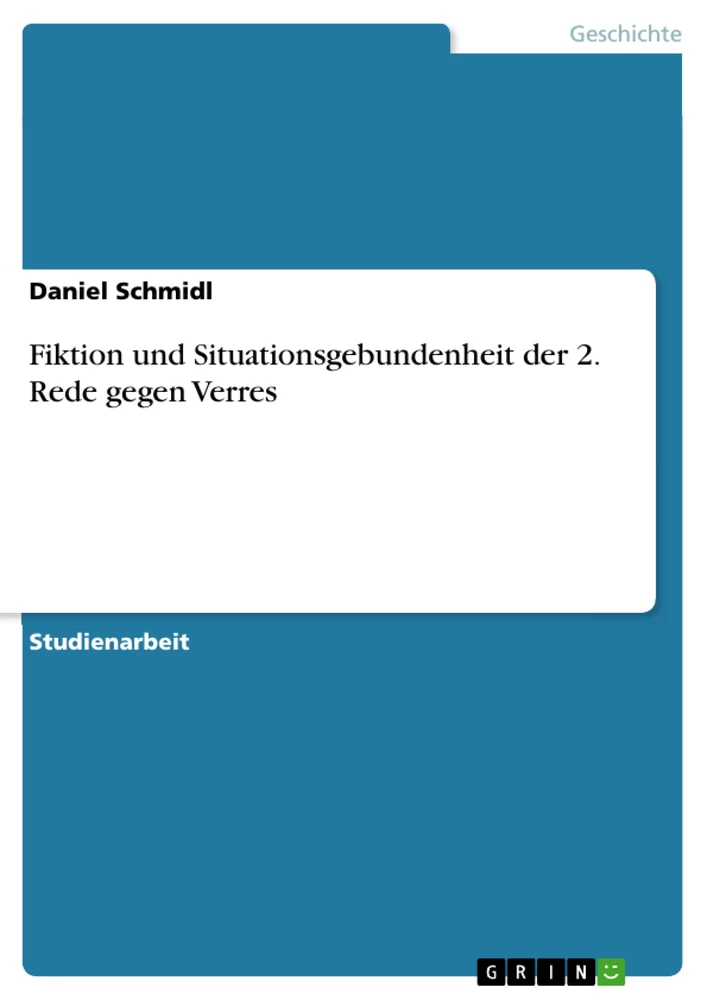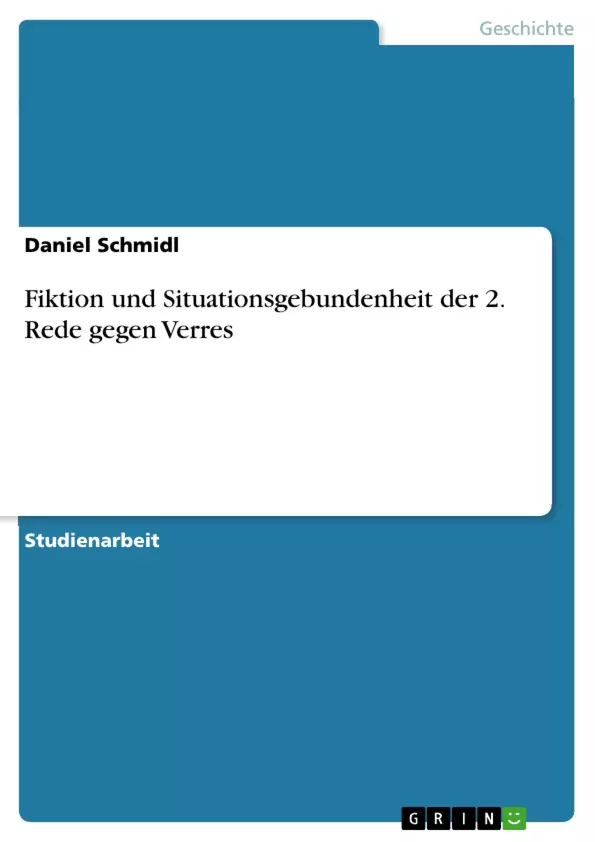Als im Jahr 70 v. Chr. der Prozess gegen Gaius Verres, den „Ausbeuter Siziliens“, geführt wurde, befand sich das römische Gerichtssystem in einer Zeit des Umbruchs. Die sullanischen Reformen hatten den Rittern den Vorsitz der Repetundengerichte entzogen und ihn ausschließlich an die Senatoren übertragen. Diese Maßnahme hatte zur Folge, dass Vergehen der Provinzstatthalter häufig kaum noch geahndet wurden, da die senatorisch besetzten Gerichte nur selten etwas gegen ihre Standesgenossen unternahmen, zumal sich die Richter oftmals als bestechlich erwiesen. Die Konsuln des Jahres 70 strebten daher deutliche Reformen an, wozu als wichtiges Merkmal die Beseitigung der ausschließlichen Besetzung der Strafgerichtshöfe mit Senatoren zählte. Als Ergebnis wurde am Ende des Jahres das Richteramt zu je einem Drittel auf Senatoren, Ritter und Ärartribunen verteilt.
Der Prozess gegen Verres fand jedoch schon im Sommer statt, einem Zeitpunkt, an dem die Reformen noch nicht umgesetzt waren, aber bereits ihre Schatten vorauswarfen. Die Anklage führte Marcus Tullius Cicero, der diese Aufgabe auf Bitten der Sizilier übernommen hatte. Nach der ersten Verhandlung, in der Cicero das allgemein übliche Verfahren dahingehend abgeändert hatte, das er anstatt einer großen zusammenhängenden Anklagerede nur eine kurze Einführungsrede hielt und anschließend gleich mit der Zeugenvernehmung begann, galt Verres bereits als verurteilt. Dieser zog die Konsequenz und wartete nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene zweite Verhandlung ab, sondern entzog sich dem Gericht durch freiwilliges Exil.5 Die zweite Verhandlung fand dennoch statt, Verres wurde schuldig gesprochen. Normalerweise war für die zweite Verhandlung ein kompletter nochmaliger Durchgang der Zeugen und eine zweite Anklagerede, die auch das Schlussplädoyer bildet, vorgesehen. Nun wird allgemein in der Forschung angenommen, dass Cicero aus dem Grund, das Verres sich dem Gericht entzog, keine zweite Rede hatte halten können. Diese Annahme ist gut belegt und abgesichert, es scheinen dahingehend keinerlei Zweifel zu bestehen und dies soll auch im Rahmen dieser Arbeit nicht angezweifelt werden. Da Cicero jedoch eine zweite Rede veröffentlicht hat, steht somit eine weitere Frage im Raum.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbetrachtung – Darlegung des bisherigen Forschungsstandes und Formulierung der Arbeitshypothese
- Interpretation ausgewählter Elemente der zweiten Rede hinsichtlich Fiktion und Situationsgebundenheit
- Analyse des ersten Buches
- Analyse des zweiten Buches
- Analyse des dritten Buches
- Analyse des vierten Buches
- Analyse des fünften Buches
- Stellung und Mengenverhältnis fiktiver und situationsgebundener Elemente zueinander
- Bewertung der Arbeitshypothesen und Stellungnahme
- Anhang
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der 2. Rede gegen Verres unter dem Aspekt der Fiktion und Situationsgebundenheit. Dabei soll geklärt werden, ob Cicero diese Rede tatsächlich in der zweiten Verhandlung gehalten hat oder ob er sie nachträglich verfasst hat. Es sollen sowohl fiktive als auch situationsgebundene Elemente der Rede identifiziert und analysiert werden.
- Analyse der Situationsgebundenheit der Reden
- Untersuchung der Fiktion in der 2. Rede gegen Verres
- Bewertung der Forschungsliteratur zum Thema
- Rekonstruktion der historischen Situation des Prozesses gegen Verres
- Überprüfung der Arbeitshypothese
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die historische Situation des Prozesses gegen Verres und stellt die Forschungsfrage nach der Faktizität der 2. Rede gegen Verres. Es werden die zentralen Begriffe "Fiktion" und "Situationsgebundenheit" definiert.
- Die Vorbetrachtung fasst den bisherigen Forschungsstand zu der Frage zusammen, ob Cicero die 2. Rede gegen Verres tatsächlich gehalten hat oder ob er sie nachträglich geschrieben hat. Es werden die wichtigsten Argumente der Vertreter beider Positionen dargestellt.
- Die Interpretation ausgewählter Elemente der zweiten Rede analysiert verschiedene Textstellen der Rede unter dem Aspekt der Fiktion und Situationsgebundenheit. Die Analyse konzentriert sich auf die fünf Bücher der Rede.
- Das Kapitel "Stellung und Mengenverhältnis fiktiver und situationsgebundener Elemente zueinander" bewertet die Ergebnisse der Analyse und stellt das Verhältnis von fiktiven und situationsgebundenen Elementen in der 2. Rede gegen Verres dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen der antiken römischen Rechtsgeschichte, der Rhetorik, der historischen Quellenkritik, der Fiktionsforschung, der Interpretation antiker Texte und der Analyse der Reden Ciceros. Im Zentrum stehen die Begriffe Fiktion, Situationsgebundenheit, Prozessrede, zweite Rede gegen Verres, Marcus Tullius Cicero, Gaius Verres und die römische Republik.
- Citation du texte
- Daniel Schmidl (Auteur), 2003, Fiktion und Situationsgebundenheit der 2. Rede gegen Verres, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62374