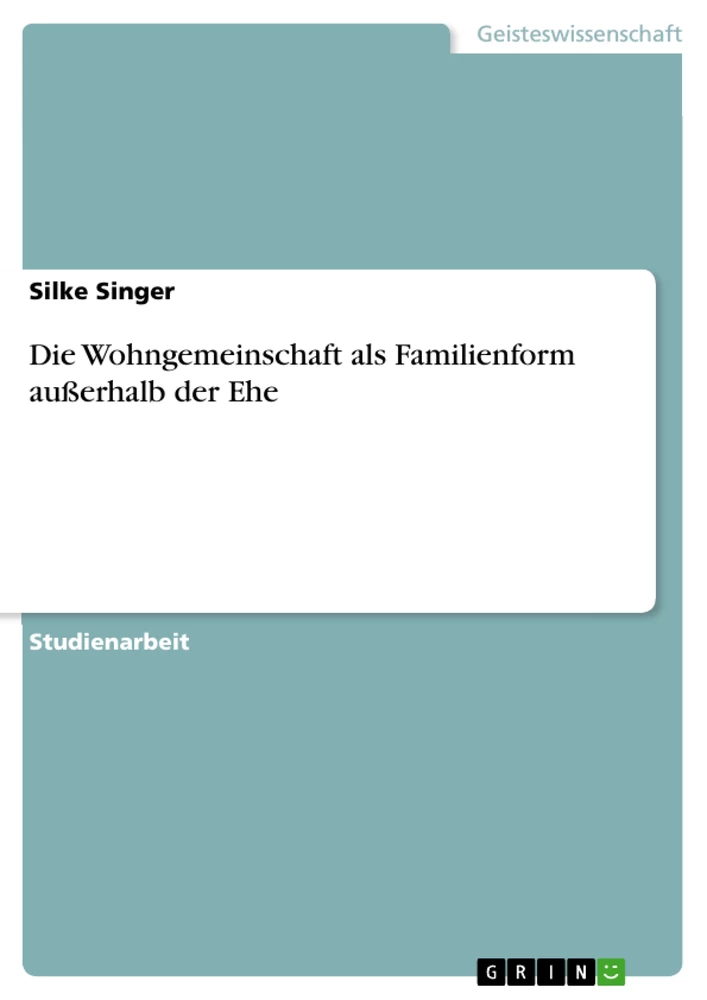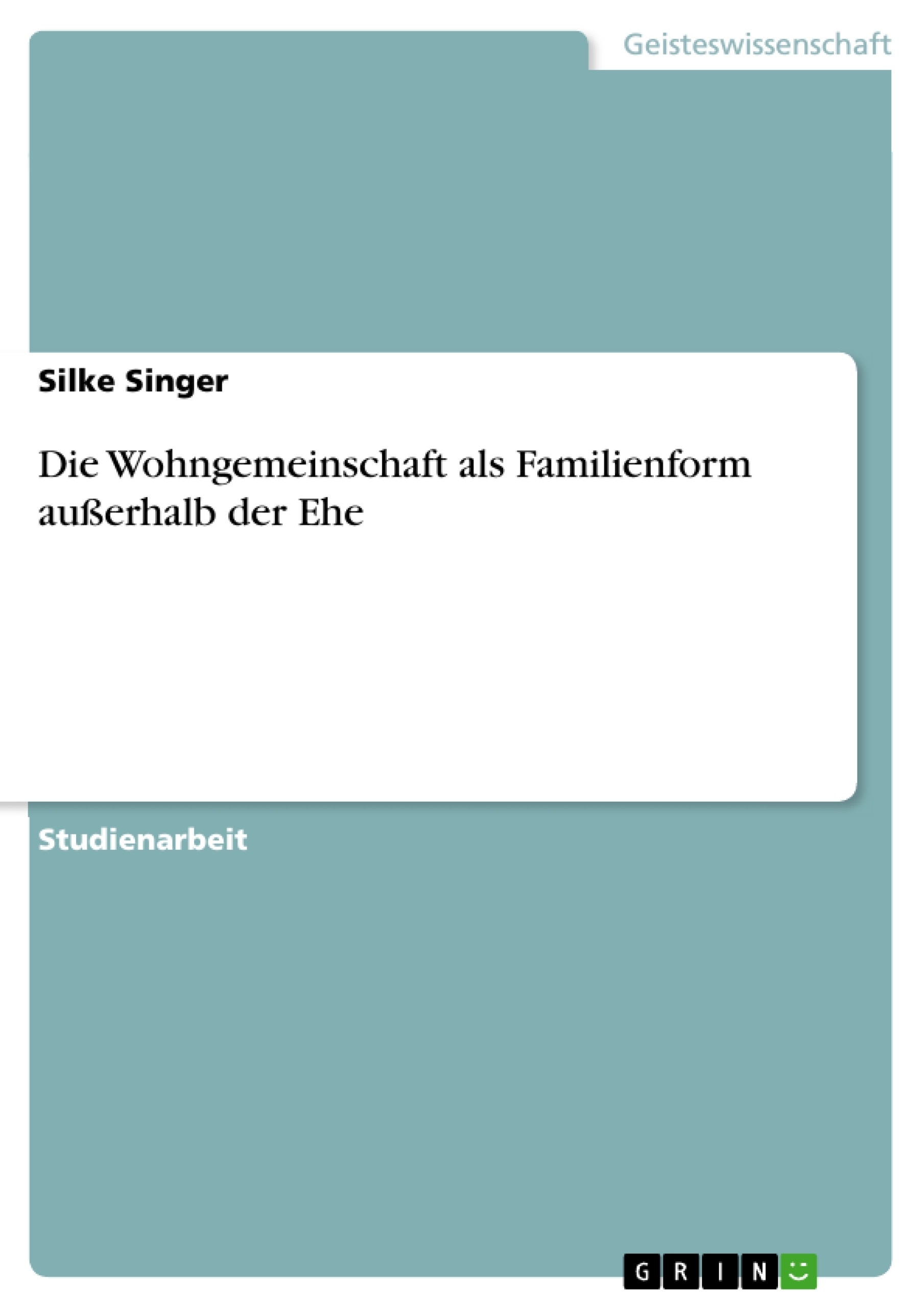Die typische Familie ist heute immer noch die Kernfamilie. Darunter versteht man ein verheiratetes Elternpaar mit seinen minderjährigen Kindern. Die meisten Menschen leben in einer solchen Familie. Doch aufgrund einer immer höheren Scheidungsrate und die Abneigung gegen die Heirat entwickeln sich immer mehr verschiedene Familienformen heraus. Daher steht hier im Vordergrund die Wohngemeinschaft als eine Familienform außerhalb der Ehe. Es werden Antworten auf die folgenden Fragen gegeben: 1. Wie ist eine Wohngemeinschaft aufgebaut? 2. Wie gestaltet sich das Leben bzw. die Betreuungssituation? 3. Welche Rechte und Pflichten hat der Einzelne? An den Fragen ist ersichtlich, dass die Wohngemeinschaft anhand verschiedener Kriterien untersucht werden kann. Zu Beginn steht hier daher die Struktur einer Wohngemeinschaft. Die Struktur unterteilt sich in den Aufbau der Wohnung und die Mitgliedschaft. Der Aufbau der Wohnung gliedert sich in zwei verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite sind die Gemeinschaftsräume und auf der anderen Seite die Einzelzimmer. In dieser Wohnungsaufteilung leben die Mitglieder einer Wohngemeinschaft zusammen. Unter den Mitgliedern müssen sich mindestens drei Erwachsene befinden. Diese Mitgliedschaft basiert nur auf Sympathiebeziehungen zwischen den Mitgliedern und nicht auf einen Verwandtschaftsgrad.
Ein anderes Kriterium sind die Motive, warum heute viele Menschen in einer Wohngemeinschaft leben. Die meisten Menschen wollen hauptsächlich ihre Isolation überwinden, da sie das Bedürfnis nach Kontakt zu ihren Mitmenschen haben oder sie wollen nur ihre emotionale Belastung durch zuviel Arbeit minimieren bzw. aufheben durch die Arbeitsaufteilung in einer Wohngemeinschaft.
Im Haushalt werden die Aufgaben unter den Mitgliedern gerecht aufgeteilt. Dies erfolgt meist in einer Rotation, d.h. das jedes Mitglied nach einer Zeit (meist nach einer Woche) eine andere Aufgabe erledigen muss, so dass jeder alle Haushaltsbereiche durchläuft. Die Mitglieder mit Kindern werden durch die Mitgliedschaft in einer Wohngemeinschaft entlastet, weil alle Mitglieder gleichmäßig in die Kindererziehung einbezogen werden. Die Kinder sind aufgrund der hohen Mitgliederzahlen nie allein und haben immer einen Ansprechpartner.
In einer Wohngemeinschaft gibt es drei verschiedene Arten von Mietverträgen. Die erste Vertragsart ist, das alle Mitglieder in dem Mietvertrag stehen, so dass sie alle die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber dem Vermieter haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Struktur und Motive
- 2.1. Aufbau
- 2.2. Mitgliedschaft und Mitgliedersuche
- 2.3. Motive zur Bildung einer Wohngemeinschaft
- 3. Aufgaben und Funktionen
- 3.1. Haushalt
- 3.2. Kindererziehung
- 4. Mietvertragsarten
- 4.1. Vertrag 1: Alle unterschreiben einen Vertrag
- 4.2. Vertrag 2: Nur einer unterschreibt den Mietvertrag und die anderen werden Untermieter
- 4.3. Vertrag 3: Jeder unterschreibt seinen eigenen Mietvertrag
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wohngemeinschaft als einer alternativen Familienform außerhalb der Ehe. Sie untersucht die Struktur und die Motive zur Bildung einer Wohngemeinschaft, die Aufgaben und Funktionen, die in ihr erfüllt werden, sowie die verschiedenen Arten von Mietverträgen, die in diesem Kontext möglich sind.
- Struktur und Aufbau von Wohngemeinschaften
- Motive für die Bildung von Wohngemeinschaften
- Aufgaben und Funktionen von Wohngemeinschaften im Haushalt und in der Kindererziehung
- Mietvertragsarten in Wohngemeinschaften
- Wohngemeinschaften als alternatives Familienmodell
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Wohngemeinschaft als eine alternative Familienform außerhalb der Ehe vorgestellt und die Forschungsfrage formuliert. Das zweite Kapitel behandelt die Struktur und die Motive zur Bildung einer Wohngemeinschaft. Dabei werden der Aufbau der Wohnung, die Mitgliedschaft und die Gründe für die Wahl dieser Lebensform betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Aufgaben und Funktionen, die in einer Wohngemeinschaft erfüllt werden. Es werden insbesondere die Bereiche Haushalt und Kindererziehung beleuchtet. Im vierten Kapitel werden verschiedene Arten von Mietverträgen in Wohngemeinschaften vorgestellt, wobei die Rechte und Pflichten der Mitglieder gegenüber dem Vermieter im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Wohngemeinschaft, Familienform, Ehe, Struktur, Motive, Aufgaben, Funktionen, Haushalt, Kindererziehung, Mietvertrag, Untermieter, Rechte, Pflichten.
Häufig gestellte Fragen
Warum wählen Menschen eine Wohngemeinschaft als Familienform?
Häufige Motive sind die Überwindung von Isolation, das Bedürfnis nach sozialem Kontakt und die Arbeitsaufteilung im Haushalt zur Entlastung im Alltag.
Wie ist eine typische Wohngemeinschaft strukturell aufgebaut?
Eine WG besteht meist aus privaten Einzelzimmern und gemeinsam genutzten Räumen. In der Regel leben mindestens drei Erwachsene zusammen, deren Beziehung auf Sympathie statt auf Verwandtschaft basiert.
Wie funktioniert die Kindererziehung in einer WG?
In vielen WGs werden alle Mitglieder in die Betreuung einbezogen, wodurch Eltern entlastet werden und Kinder stets Ansprechpartner haben.
Welche Arten von Mietverträgen gibt es für WGs?
Es gibt drei Modelle: Alle Bewohner unterschreiben den Hauptvertrag, einer ist Hauptmieter und schließt Untermietverträge ab, oder jeder Bewohner hat einen eigenen Einzelvertrag mit dem Vermieter.
Wie werden Haushaltsaufgaben in einer WG geregelt?
Oft wird ein Rotationsprinzip angewendet, bei dem die Aufgaben wöchentlich wechseln, damit jedes Mitglied alle Bereiche des Haushalts übernimmt.
- Citation du texte
- Silke Singer (Auteur), 2004, Die Wohngemeinschaft als Familienform außerhalb der Ehe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62447