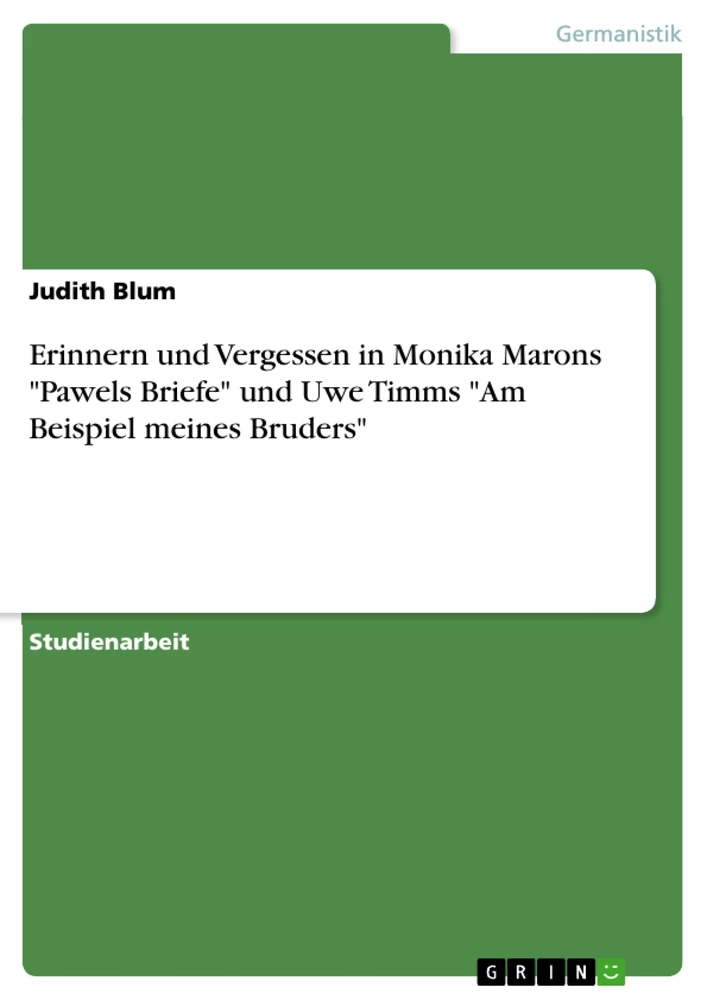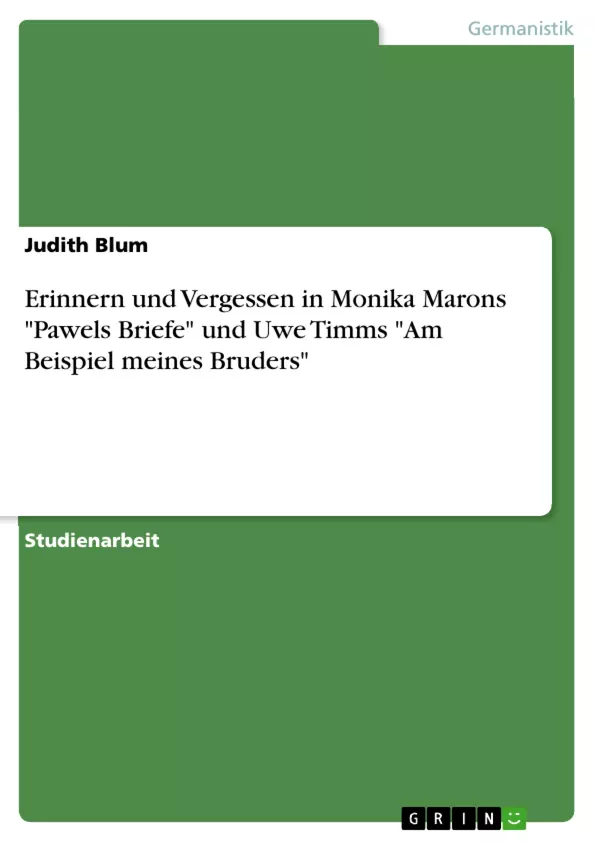Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen zwei Texte der deutschen Gegenwartsliteratur, in denen die Autoren sich mit der Vergangenheit ihrer Familien auseinandersetzen. Monika Maron fragt in "Pawels Briefe. Eine Familiengeschichte" (1999) nach dem Schicksal ihres aus einer jüdischen Familie stammenden Großvaters und seiner Frau im Nationalsozialismus. Uwe Timm beschäftigt sich in "Am Beispiel meines Bruders" (2003) primär mit der Geschichte seines im Zweiten Weltkrieg als Mitglied der Waffen-SS gefallenen Bruders. Beide Autoren sind bei ihrer Spurensuche in der Vergangenheit auf Quellen wie Briefe, Tagebucheinträge und Berichte angewiesen, da sie die betreffenden Personen nie bzw. nur als Kleinkind kennen gelernt haben und so über keine originären Erinnerungen an sie verfügen.
Mit ihrer Suche nach der eigenen Herkunft befinden sich Maron und Timm im Trend: Friederike Eigler konstatiert eine Flut familiengeschichtlicher Erkundungen und eine neue Popularität von Generationenromanen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Diesen Texten sei gemeinsam, dass die Autoren sich mit dem vielfach gestörten Generationengedächtnis auseinandersetzen und hierbei Dokumenten der Familiengeschichte wie Briefen, Tagebüchern und Fotos großes Interesse entgegengebracht wird. Die Möglichkeit eines direkten Zugangs zur Familiengeschichte wird als illusorisch angesehen, an die Stelle der Authenzität rückt die Medialität von Erinnerung. Bestandteil dieser Familiengeschichten sind ihr zufolge sowohl Aspekte der Geschichte des 20. Jahrhunderts als auch die Thematisierung des Prozesses der Erinnerung selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Gedächtnismodelle
- II. Erinnern und Vergessen in Monika Marons Pawels Briefe
- 1. Anlass der Erinnerungsarbeit
- 2. Quellen der Erinnerung
- 3. Erinnerungsarbeit
- 4. Vergessen
- III. Erinnern und Vergessen in Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders
- 1. Anlass der Erinnerungsarbeit
- 2. Quellen der Erinnerung
- 3. Erinnerungsarbeit
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Erinnerung und Vergessen in zwei Werken der deutschen Gegenwartsliteratur – Monika Marons „Pawels Briefe“ und Uwe Timms „Am Beispiel meines Bruders“ – dargestellt werden. Die Analyse fokussiert auf die Auseinandersetzung der Autoren mit der Familiengeschichte und den damit verbundenen Herausforderungen der Erinnerungsarbeit. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Quellen, die zur Rekonstruktion der Vergangenheit herangezogen werden, und analysiert die Prozesse des Erinnerns und Vergessens im Kontext der jeweiligen Familiengeschichten.
- Die Rolle von Quellen (Briefe, Tagebucheinträge etc.) in der Rekonstruktion der Familiengeschichte
- Die subjektive und konstruktive Natur von Erinnerungen
- Der Einfluss des Kontextes (zeitgeschichtlicher Hintergrund, persönliche Umstände) auf das Erinnern
- Vergleichende Analyse der Erinnerungsarbeit in beiden Texten
- Theoretische Einbettung der Analyse in verschiedene Gedächtnismodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden ausgewählten Texte von Monika Maron ("Pawels Briefe") und Uwe Timm ("Am Beispiel meines Bruders") vor. Sie betont die Auseinandersetzung beider Autoren mit der Familiengeschichte im Kontext des 20. Jahrhunderts und den Herausforderungen der Rekonstruktion der Vergangenheit aufgrund fehlender direkter Erinnerungen. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf die Analyse von Erinnern und Vergessen in den beiden Texten fokussiert und verschiedene Gedächtnismodelle heranzieht.
I. Gedächtnismodelle: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Gedächtnismodelle aus psychologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Es hebt die Komplexität des Themas hervor und betont den konstruktiven und subjektiven Charakter von Erinnerungen, die als selektive Rekonstruktionen vergangener Wahrnehmungen verstanden werden. Das Kapitel unterstreicht, dass Erinnerungen nicht objektive Abbildungen der Vergangenheit sind, sondern von der Gegenwart geprägt werden und sich im Laufe der Zeit verändern können. Es dient als theoretische Grundlage für die anschließende Analyse der literarischen Texte.
II. Erinnern und Vergessen in Monika Marons Pawels Briefe: Dieses Kapitel analysiert Monika Marons "Pawels Briefe" im Hinblick auf Erinnern und Vergessen. Es untersucht die Motive der Autorin, sich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen, und beleuchtet die Quellen, die sie zur Rekonstruktion der Geschichte ihres Großvaters und dessen Frau nutzt. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Erinnerungsarbeit selbst, den Herausforderungen und Schwierigkeiten, auf die die Autorin stößt, und den Reflexionen über das Wesen von Erinnern und Vergessen, die sich im Text zeigen. Die Analyse verbindet die im ersten Kapitel vorgestellten Gedächtnismodelle mit der konkreten Darstellung des Erinnerns im Roman.
III. Erinnern und Vergessen in Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders: Analog zum vorherigen Kapitel analysiert dieses Kapitel Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders" in Bezug auf Erinnern und Vergessen. Es untersucht die Gründe für Timms Beschäftigung mit der Geschichte seines Bruders, der im Zweiten Weltkrieg als Mitglied der Waffen-SS fiel. Die Analyse beleuchtet die Quellen, die Timm nutzt, und analysiert den Prozess der Erinnerungsarbeit, die damit verbundenen Schwierigkeiten und die Reflexionen über Erinnern und Vergessen. Der Vergleich mit Marons Text und die Einbettung in die theoretischen Überlegungen des ersten Kapitels stehen im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Erinnerung, Vergessen, Gedächtnismodelle, Familiengeschichte, 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Monika Maron, Pawels Briefe, Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders, literarische Textanalyse, Generationengedächtnis, Quellen, Subjektivität, Konstruktion von Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen zu „Erinnern und Vergessen in Monika Marons Pawels Briefe und Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders“
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie Erinnerung und Vergessen in Monika Marons „Pawels Briefe“ und Uwe Timms „Am Beispiel meines Bruders“ dargestellt werden. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung der Autoren mit der Familiengeschichte und den damit verbundenen Herausforderungen der Erinnerungsarbeit. Analysiert werden die Quellen der Erinnerung, die Prozesse des Erinnerns und Vergessens im Kontext der jeweiligen Familiengeschichten, sowie die subjektive und konstruktive Natur von Erinnerungen und der Einfluss des historischen Kontextes.
Welche Gedächtnismodelle werden verwendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene Gedächtnismodelle aus psychologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven ein. Diese dienen als theoretische Grundlage zur Analyse der literarischen Texte und helfen, die Komplexität des Erinnerns und Vergessens zu beleuchten. Die Modelle unterstreichen den konstruktiven und subjektiven Charakter von Erinnerungen als selektive Rekonstruktionen der Vergangenheit.
Wie wird in der Arbeit vorgegangen?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der Erinnerungsarbeit in beiden Texten. Sie untersucht die Rolle von Quellen wie Briefe und Tagebucheinträge in der Rekonstruktion der Familiengeschichte und analysiert die Prozesse des Erinnerns und Vergessens in den jeweiligen Kontexten (20. Jahrhundert, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg). Der Vergleich der beiden Texte ermöglicht es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung von Erinnerung und Vergessen herauszuarbeiten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Gedächtnismodellen, je ein Kapitel zur Analyse von „Pawels Briefe“ und „Am Beispiel meines Bruders“, einen Schluss und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung stellt die Thematik und die ausgewählten Texte vor. Das Kapitel zu den Gedächtnismodellen liefert die theoretische Grundlage. Die beiden folgenden Kapitel analysieren die jeweiligen Romane im Hinblick auf Erinnerung und Vergessen. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielen die Quellen in der Rekonstruktion der Familiengeschichte?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Quellen wie Briefe, Tagebucheinträge etc. für die Rekonstruktion der Familiengeschichten in beiden Romanen. Sie untersucht, wie die Autoren diese Quellen verwenden und welche Rolle sie für die Gestaltung der Erinnerung spielen. Die Analyse beleuchtet, wie die Auswahl und Interpretation dieser Quellen die subjektive Konstruktion der Erinnerung beeinflussen.
Wie wird die Subjektivität von Erinnerungen berücksichtigt?
Die Arbeit betont die subjektive und konstruktive Natur von Erinnerungen. Sie zeigt, wie Erinnerungen nicht objektive Abbilder der Vergangenheit sind, sondern von der Gegenwart geprägt werden und sich im Laufe der Zeit verändern können. Die Analyse berücksichtigt die individuelle Perspektive der Autoren und die Einflüsse des jeweiligen Kontextes auf ihre Erinnerungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erinnerung, Vergessen, Gedächtnismodelle, Familiengeschichte, 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Monika Maron, Pawels Briefe, Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders, literarische Textanalyse, Generationengedächtnis, Quellen, Subjektivität, Konstruktion von Erinnerung.
- Quote paper
- Judith Blum (Author), 2006, Erinnern und Vergessen in Monika Marons "Pawels Briefe" und Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62499