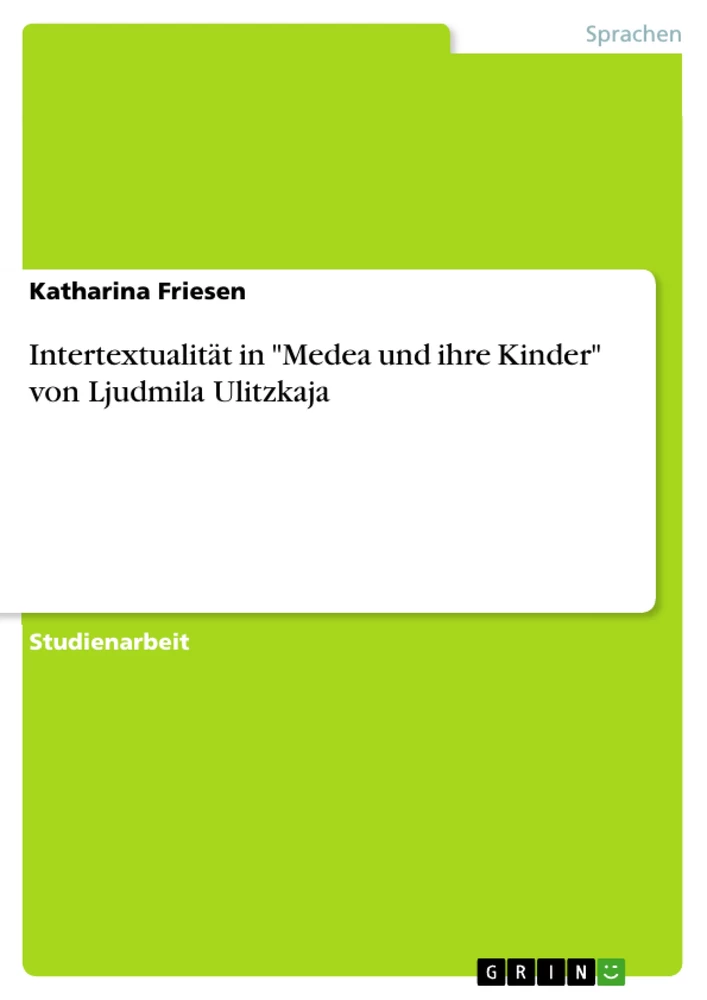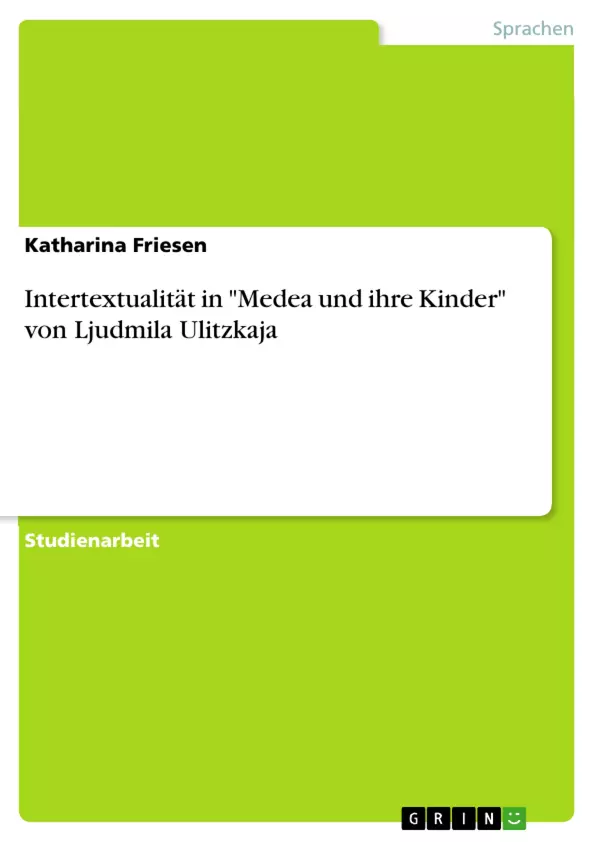Diese Arbeit hat zwei Teile: Im ersten Teil möchte ich aufzeigen, wie auf der Ebene der Narration und auf der Ebene der Geschichte das Erzählen und damit auch Intertextualität thematisiert wird, und im zweiten Teil möchte ich intertextuelle Bezüge zwischen „Medea und ihre Kinder“ von Ulitzkaja und dem 1. Buch Mose2 und zwischen „Medea und ihre Kinder“ von Ulitzkaja und „Medea“ von Euripides aufzeigen. Ich möchte zeigen, dass das Erzählen im 1. Buch Mose den gleichen Zweck verfolgt, wie er auf der Ebene der Narration in „Medea und ihre Kinder“ thematisiert wird. Um deutlicher differenzieren zu können, werde ich mich in meiner Arbeit des drei-Ebenen-Modells und der Terminologie Gérard Genettes bedienen.3
2 1. Mose, 11.10 – 1. Mose, 50.26
3 Genette, Gérard: Die Erzählung die Termini „Erzählung“, „Geschichte“ und „Narration“ stammen aus ebendiesem Werk
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I
- Textualität und Intertextualität als Thema von „Medea und ihre Kinder“
- Figur der Medea als Fiktion auf allen drei Ebenen der Erzählung
- Erinnerung als Legitimation des Erzählens
- Medea als Integrationsfigur
- Medea als intertextueller Text
- Teil II
- Thematische intertextuelle Bezüge zwischen „Medea und ihre Kinder“ von Ulitzkaja, 1. Mose und „Medea“ von Euripides
- Intertextuelle Bezüge
- Integrationsfiguren
- Das gelobte Land
- Motiv der Kinderlosigkeit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Intertextualität in Ljudmila Ulitzkajas Roman „Medea und ihre Kinder“. Die Arbeit analysiert die Thematik des Erzählens im Roman und untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Ulitzkajas Werk und dem 1. Buch Mose sowie Euripides‘ „Medea“. Sie zielt darauf ab, den Zweck des Erzählens in „Medea und ihre Kinder“ aufzuzeigen und dessen Verbindung zu anderen Texten aufzudecken.
- Die Rolle der Intertextualität in der Erzählung
- Die Figur der Medea als multidimensionale Figur
- Die Verbindung zwischen Erzählung und Erinnerung
- Die Bedeutung der Geschichte und ihre Auswirkungen auf den Erzählprozess
- Der Vergleich von Ulitzkajas „Medea und ihre Kinder“ mit dem 1. Buch Mose und Euripides' „Medea“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit befasst sich mit der Figur der Medea im Roman. Es analysiert die Darstellung von Medea auf den Ebenen der Geschichte, der Narration und des Erzählens. Das zweite Kapitel untersucht die intertextuellen Verbindungen zwischen „Medea und ihre Kinder“ und dem 1. Buch Mose. Es geht auf Gemeinsamkeiten in den Erzählformen und -funktionen beider Texte ein und beleuchtet die Rolle des „gelobten Landes“ und des Motivs der Kinderlosigkeit.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit widmet sich der Intertextualität in der russischen Literatur, besonders in Ljudmila Ulitzkajas Roman „Medea und ihre Kinder“. Die Arbeit analysiert die Figur der Medea, die Thematik des Erzählens und die Verbindung zu intertextuellen Referenzen wie dem 1. Buch Mose und Euripides' „Medea“. Wichtige Schlüsselwörter sind: Intertextualität, Erzählen, Fiktion, Geschichte, Narration, Integrationsfiguren, Familie, Kinderlosigkeit, das gelobte Land.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Ulitzkajas „Medea und ihre Kinder“?
Der Roman thematisiert Intertextualität, Erinnerung als Legitimation des Erzählens und die Figur der Medea als Integrationsfigur einer Familie.
Welche intertextuellen Bezüge gibt es zur Bibel?
Es werden Parallelen zum 1. Buch Mose (Genesis) aufgezeigt, insbesondere hinsichtlich der Struktur von Familiengeschichten und dem Motiv des „gelobten Landes“.
Wie unterscheidet sich Ulitzkajas Medea von Euripides' Medea?
Während die antike Medea ihre Kinder tötet, fungiert Ulitzkajas Medea als kinderlose, aber verbindende Figur für ihre weitverzweigte Familie.
Welches Modell nutzt die Arbeit zur Analyse der Erzählung?
Die Arbeit bedient sich des Drei-Ebenen-Modells und der Terminologie von Gérard Genette (Erzählung, Geschichte, Narration).
Welche Rolle spielt die Kinderlosigkeit im Roman?
Kinderlosigkeit ist ein zentrales Motiv, das intertextuell sowohl auf die antike Medea als auch auf biblische Erzählungen verweist.
- Citation du texte
- Katharina Friesen (Auteur), 2002, Intertextualität in "Medea und ihre Kinder" von Ljudmila Ulitzkaja, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62580