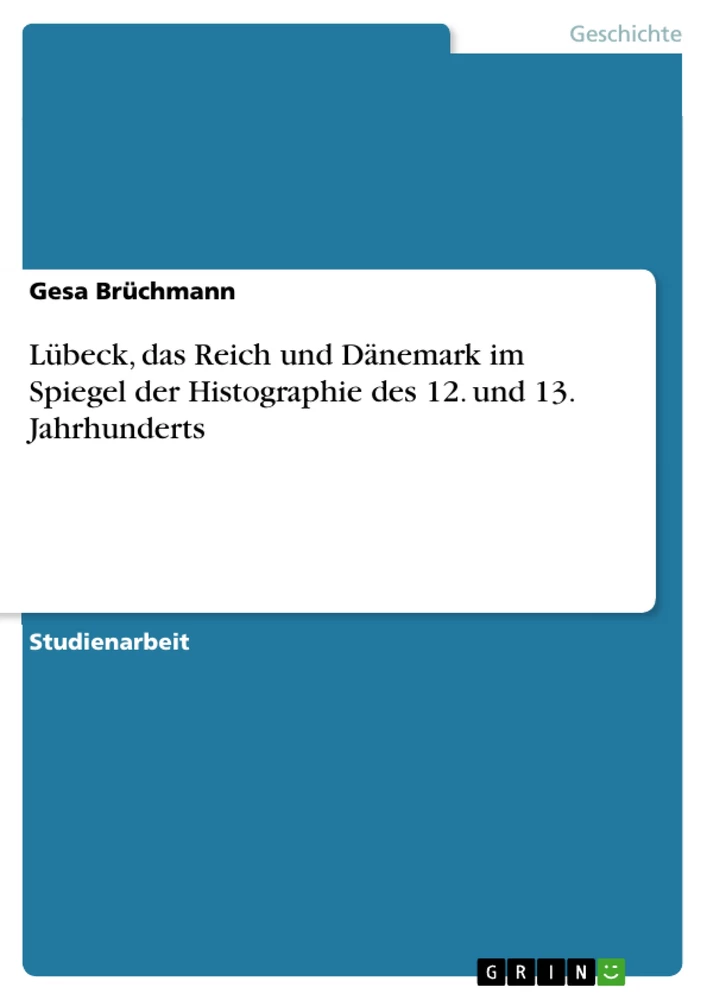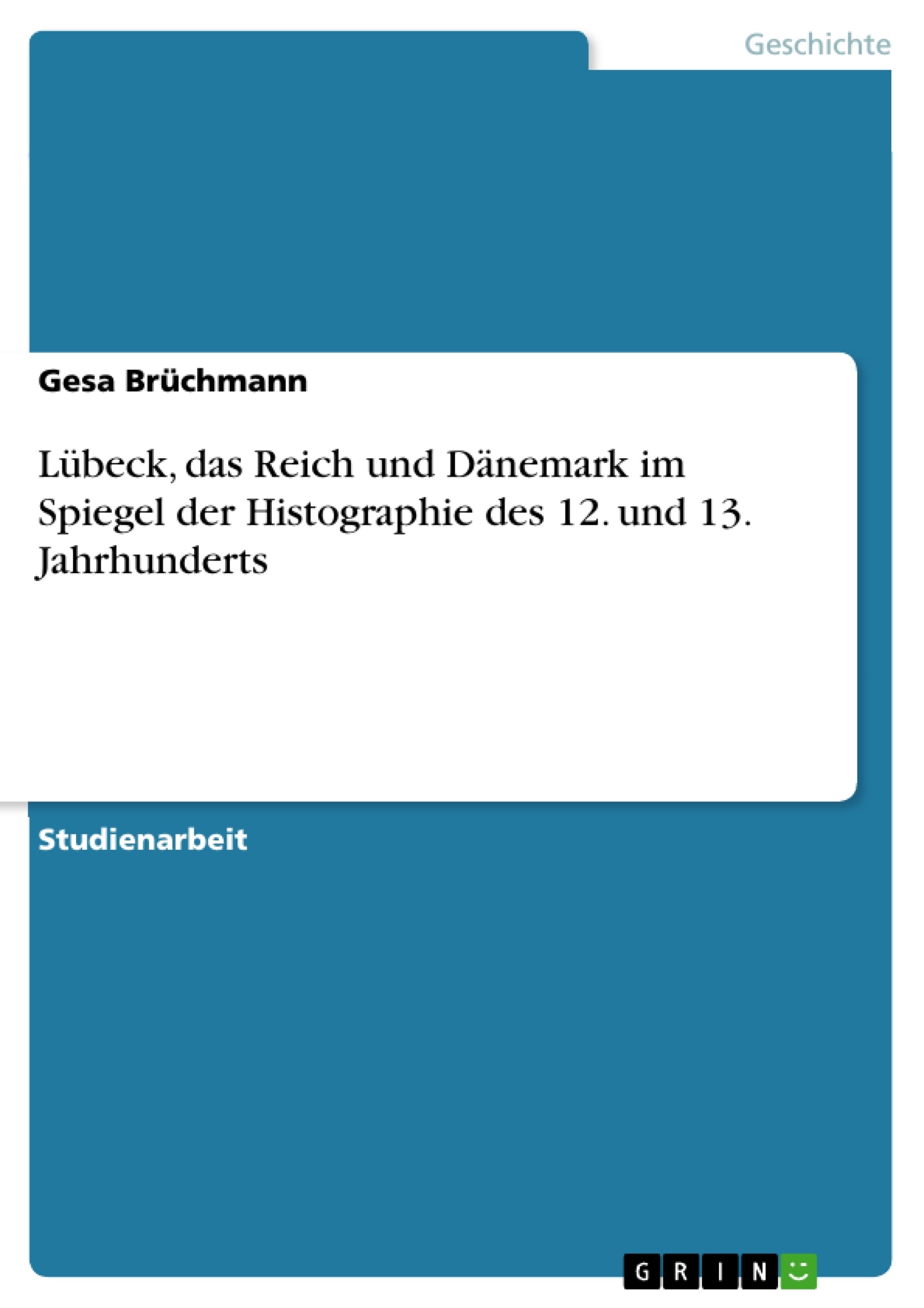I. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand von verschiedenen historisch wichtigen Ereignissen und in Bezug auf die vorhandenen Quellen und Urkunden die Voraussetzungen aufzeigen, die es möglich machten, dass Lübeck im Verlauf zweier Jahrhunderte zum Haupt norddeutscher Handelsstädte wurde. Die Arbeit steht unter dem vorgegebenen Rahmenthema „Lübeck, das Reich und Dänemark im Spiegel der Histographie des 12. und 13. Jahrhunderts“.
Ich möchte bei meiner Bearbeitung auch darauf eingehen, wie sich die Vertreter der Stadt im Verhältnis zu ihren verschiedenen Landesherren selbst eingeordnet haben. Dies erscheint mir sinnvoll, da meiner Ansicht nach gerade die Lübecker Kaufleute und Bürger im Verlauf der Entwicklung ihrer Stadt einen entscheidenden Einfluss auf die Verhältnisse, wie zum den Reichsfreiheitsbrief von 1226, gehabt haben. Sie haben es zumeist geschafft, durch geschicktes Handeln oder diplomatisches Verhalten in Auseinandersetzungen mit den Stadtherren Schaden von ihrer Stadt abzuwenden.
Hierzu werde ich, neben der Beschreibung des Verlaufs der historischen Entwicklung, vor allem die Berichte Helmolds von Bosau 1 aus seiner Slawenchronik sowie die des Chronisten Arnold von Lübeck heranziehen. Wichtige Einblicke gewähren ebenfalls die von Rolf Sprandel bearbeiteten Quellen zur Hansegeschichte, das Hansische Urkundenbuch und die Übersetzung der Reichsfreiheit und des Barbarossaprivileges von Lorenz Weinrich.
Die Geschichte der Hanse hat im Laufe der Jahre zu einer Vielzahl von fach- und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen geführt. Das Standardwerk als chronologische Einführung in die Hanse-Geschichte mit vielen zentralen Quellen, Statistiken und Karten stammt von Philippe Dollinger. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Alt-Lübeck unter Heinrich dem Slawenfürsten
- 2. Adolf II. von Schauenburg und die erste Gründung Lübecks 1143
- 3. Lübeck unter Heinrich dem Löwen
- 4. Friedrich Barbarossa als neuer Stadtherr 1181
- 5. Lübeck unter wechselnder Stadtherrschaft
- 6. Die kaiserlichen Urkunden von 1226
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung Lübecks zu einer der wichtigsten norddeutschen Handelsstädte im 12. und 13. Jahrhundert. Analysiert werden die historischen Ereignisse und Quellen, die zu diesem Aufstieg beitrugen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis der Lübecker Bürger und Kaufleute zu ihren Landesherren und deren Einfluss auf die politische Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf den Reichsfreiheitsbrief von 1226.
- Die Rolle Lübecks im Kontext des norddeutschen Handels
- Das Verhältnis zwischen Lübeck, dem Reich und Dänemark
- Der Einfluss der Lübecker Bevölkerung auf die Stadtentwicklung
- Die Bedeutung historischer Quellen und Chroniken
- Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit: die Darstellung der Voraussetzungen für den Aufstieg Lübecks zu einer bedeutenden Handelsstadt im 12. und 13. Jahrhundert anhand historischer Ereignisse und Quellen. Besonderes Augenmerk wird auf das Verhältnis der Lübecker Bürger zu ihren Landesherren gelegt und der Einfluss der Bürger auf wichtige Ereignisse wie den Erhalt des Reichsfreiheitsbriefs von 1226 hervorgehoben. Die verwendeten Quellen, darunter die Chroniken von Helmold von Bosau und Arnold von Lübeck sowie Werke zur Hansegeschichte, werden vorgestellt.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Alt-Lübeck unter Heinrich dem Slawenfürsten: Dieses Kapitel behandelt die Besiedlung Lübecks vor der offiziellen Gründung 1143, beginnend mit einer slawischen Siedlung namens „Liubice“ im 9. Jahrhundert. Es wird diskutiert, ob die Burg aufgrund innerabotritischer Konflikte, als Verteidigung gegen die Franken oder als Schutz vor Wikingern errichtet wurde. Nach einem Bedeutungsverlust im 9. und 10. Jahrhundert, wird Alt-Lübeck zu Beginn des 12. Jahrhunderts die Residenz Heinrichs des Slawenfürsten. Das Kapitel beschreibt Alt-Lübeck nicht als geplante Siedlung, sondern als Ergebnis einer bestimmten Machtverteilung, bewohnt von Kaufleuten, Slawen und Skandinaviern. Nach Heinrichs Tod 1127 und inneren Unruhen wird die Burganlage 1138 von slawischen Angreifern zerstört. Die sächsische Politik wird als einflussreich in den Jahren zwischen 1131 und 1138 angesehen, jedoch fehlen detaillierte Informationen über diese Zeit.
Schlüsselwörter
Lübeck, Hanse, Heinrich der Slawenfürst, Adolf II. von Schauenburg, Heinrich der Löwe, Friedrich Barbarossa, Reichsfreiheitsbrief 1226, Helmold von Bosau, Arnold von Lübeck, norddeutscher Handel, Stadtentwicklung, Landesherren, historische Quellen, Histographie des 12. und 13. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung Lübecks zu einer der wichtigsten norddeutschen Handelsstädte im 12. und 13. Jahrhundert. Sie analysiert die historischen Ereignisse und Quellen, die zu diesem Aufstieg beitrugen, und konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen den Lübecker Bürgern und Kaufleuten und ihren Landesherren sowie deren Einfluss auf die politische Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf den Reichsfreiheitsbrief von 1226.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle Lübecks im norddeutschen Handel, das Verhältnis zwischen Lübeck, dem Reich und Dänemark, den Einfluss der Lübecker Bevölkerung auf die Stadtentwicklung, die Bedeutung historischer Quellen und Chroniken sowie die politische und wirtschaftliche Entwicklung Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Fazit. Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit und stellt die verwendeten Quellen vor. Der Hauptteil behandelt die Entwicklung Lübecks von der slawischen Siedlung "Liubice" bis zum Erhalt des Reichsfreiheitsbriefs 1226, mit einzelnen Kapiteln zu wichtigen Persönlichkeiten und Ereignissen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche historischen Personen und Ereignisse werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Heinrich den Slawenfürsten, Adolf II. von Schauenburg, Heinrich den Löwen, Friedrich Barbarossa und den Reichsfreiheitsbrief von 1226. Es werden die Anfänge Lübecks, die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse und die Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen für die Entwicklung der Stadt beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf historische Quellen wie die Chroniken von Helmold von Bosau und Arnold von Lübeck sowie Werke zur Hansegeschichte. Die Einleitung nennt die spezifischen Quellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lübeck, Hanse, Heinrich der Slawenfürst, Adolf II. von Schauenburg, Heinrich der Löwe, Friedrich Barbarossa, Reichsfreiheitsbrief 1226, Helmold von Bosau, Arnold von Lübeck, norddeutscher Handel, Stadtentwicklung, Landesherren, historische Quellen, Histographie des 12. und 13. Jahrhunderts.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Der HTML-Auszug enthält keine explizite Zusammenfassung des Fazits. Es wird jedoch implizit auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse hingewiesen.)
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich für die Geschichte Lübecks, den norddeutschen Handel und die Entwicklung mittelalterlicher Städte interessieren.
- Citar trabajo
- Gesa Brüchmann (Autor), 2003, Lübeck, das Reich und Dänemark im Spiegel der Histographie des 12. und 13. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62651