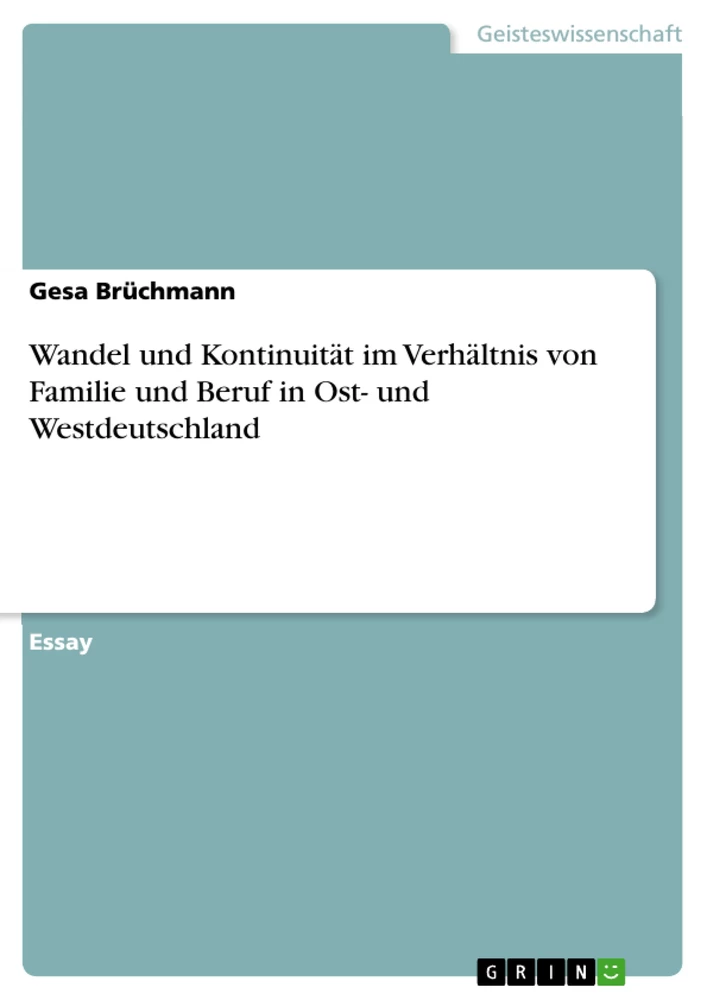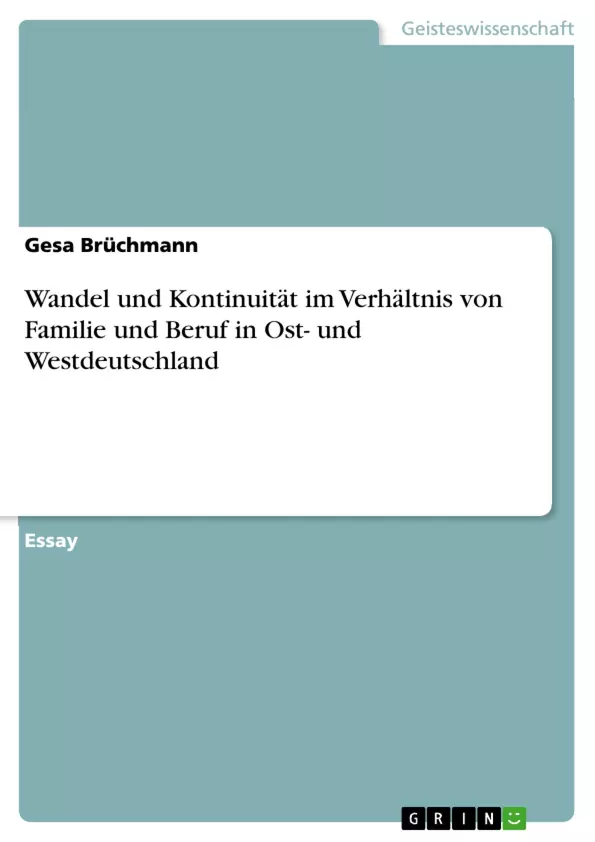Der Text von Birgit Geissler und Mechtild Oechsle beschäftigt sich dem Titel nach mit den Lebenslaufentwürfen junger Frauen in der heutigen Gesellschaft und den damit verbundenen Chancen und Problemen. Die Autorinnen haben den Text in verschiedene Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil geht es um die biographische Selbststeuerung und die halbierte Moderne, im zweiten um die Modernisierung des Frauenlebens sowie die rechtliche Gleichheit und die materielle Unabhängigkeit. In den folgenden Abschnitten werden zuerst das Gleichheitspostulat und die doppelte Lebensführung und danach die Lebensplanung als Konstruktion neuer Relationen zwischen Erwerbsarbeit und Familie diskutiert. Daran schließt sich der letzte und ausführlichste Abschnitt an, der ein Entwurf verschiedener Typen der Lebensplanung ist, gefolgt vom letzten Teil, der sich kurz mit der Lebensplanung als Ressource befasst. Ich möchte in diesem Essay der Frage nachgehen, ob und unter welchen Bedingungen Familie bzw. Kinder und Beruf für Frauen in der heutigen Gesellschaft realisierbar sind und welche Vereinbarkeitsproblematik damit einhergeht. Darüber hinaus möchte ich untersuchen, welche Typen der Lebensplanung in Bezug auf diese Frage vorteilhaft sind. Der erste Teil des vorliegenden Textes ist eine Einführung in die sogenannte „biographische Selbststeuerung“. Die Autorinnen berichten hier von der Möglichkeit der Planung des menschlichen Lebens. Das Leben eines Individuums sollte von diesem als Projekt angesehen werden, mit dem in der heutigen Zeit sowohl vielfältige Möglichkeiten in Bezug auf Bildung und Beruf als auch „Risiken der Diskontinuität“ verbunden sind, die es zu beherrschen gilt. Mit dieser Antizipation ist die Eigeninitiative des Individuums verbunden, das heißt die Auseinandersetzung mit den normativen und institutionellen Institutionen und Vorgaben, die der Lebensplanung bestimmte Grenzen setzen. Das planende Verhalten wird in diesem Zusammenhang vor allem auf Männer bezogen, da sie voll in den Arbeitsmarkt integriert sind. Bei diesen geschlechtsspezifischen Lebenslaufmodellen wird der Frau keine selbständige Planung zugeschrieben. Frauen waren früher eher beschränkt auf Ehe und Familie und in Bezug auf die soziale (Ab-) Sicherung und den Lebensunterhalt auf den Mann angewiesen. Ihnen wurde in der Erwerbsarbeit kein Platz eingeräumt und darüber hinaus würden nur „widrige Umstände“ die Frauen zur Erwerbsarbeit, das heißt zu abweichenden Verhalten, zwingen.
Inhaltsverzeichnis
- Biographische Selbststeuerung und die halbierte Moderne
- Modernisierung des Frauenlebens
- Gleichheitspostulat und doppelte Lebensführung
- Lebensplanung als Konstruktion neuer Relationen zwischen Erwerbsarbeit und Familie
- Entwurf verschiedener Typen der Lebensplanung
- Lebensplanung als Ressource
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Birgit Geissler und Mechtild Oechsle analysiert die Lebenslaufentwürfe junger Frauen in der heutigen Gesellschaft und beleuchtet die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Dabei wird die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Fokus gesetzt und untersucht, welche Lebensplanungstypen in diesem Kontext relevant sind.
- Biographische Selbststeuerung und die Herausforderungen der modernen Lebensgestaltung
- Modernisierung des Frauenlebens und die Auswirkungen auf die Rollenverteilung
- Gleichheitspostulat und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Konstruktion neuer Lebenslaufmodelle für Frauen
- Typisierung verschiedener Lebensplanungstypen und deren spezifische Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Konzept der „biographischen Selbststeuerung“ ein, das die Planung des menschlichen Lebens als Projekt betrachtet. Es wird die Möglichkeit der Selbstbestimmung und die damit verbundenen Risiken der Diskontinuität thematisiert. Die Autorinnen kritisieren die traditionelle Rollenverteilung, die Frauen in der Vergangenheit auf Ehe und Familie beschränkte und ihnen eine selbstständige Planung verweigerte.
Im zweiten Kapitel wird die These aufgestellt, dass die traditionelle Lebensführung für junge Frauen in der heutigen Gesellschaft keine Gültigkeit mehr besitzt. Es wird der Wandel in der Rolle der Frau beschrieben und die neuen Möglichkeiten der Selbstbestimmung hervorgehoben. Trotz der erweiterten Handlungsspielräume werden auch die Herausforderungen und Konflikte angesprochen, die sich aus dem Spagat zwischen Beruf und Familie ergeben.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Strukturen der modernen Familie und deren Auswirkungen auf die individuelle Planung von Frauen. Es wird die Bedeutung der materiellen Unabhängigkeit für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung betont.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der „doppelten Lebensführung“, die sich aus der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergibt. Die Autorinnen diskutieren die Herausforderungen und Chancen dieser Lebensform und betonen die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Unterstützung für berufstätige Mütter.
Der fünfte Teil des Textes stellt verschiedene Typen der Lebensplanung für Frauen im Alter von 20-30 Jahren vor. Es werden vier verschiedene Modelle vorgestellt: die doppelte, die familienzentrierte, die berufszentrierte und die individualisierte Lebensplanung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die biographische Selbststeuerung, die Modernisierung des Frauenlebens, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Konstruktion neuer Lebenslaufmodelle, die doppelte Lebensführung, die Lebensplanung und die Typisierung verschiedener Lebensentwürfe.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "biographische Selbststeuerung"?
Es bezeichnet die Fähigkeit und Notwendigkeit des Individuums, den eigenen Lebenslauf aktiv zu planen und als Projekt zu gestalten, anstatt traditionellen Mustern zu folgen.
Wie hat sich die Lebensplanung von Frauen modernisiert?
Frauen sind heute nicht mehr auf Ehe und Familie beschränkt, sondern streben nach materieller Unabhängigkeit und beruflicher Selbstverwirklichung, was zu einer "doppelten Lebensführung" führt.
Welche Typen der Lebensplanung werden für junge Frauen unterschieden?
Die Arbeit nennt vier Haupttypen: die doppelte (Beruf und Familie), die familienzentrierte, die berufszentrierte und die individualisierte Lebensplanung.
Was ist das Problem der "halbierten Moderne"?
Es beschreibt den Zustand, in dem Frauen zwar formal gleichberechtigt sind und am Arbeitsmarkt teilhaben, die gesellschaftlichen Strukturen (z.B. Kinderbetreuung) aber noch auf traditionellen Rollenbildern beruhen.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland bei Familie und Beruf?
Die Arbeit untersucht Wandel und Kontinuität in beiden Landesteilen, wobei im Osten oft eine stärkere Tradition der weiblichen Vollzeiterwerbstätigkeit fortwirkt.
Warum ist materielle Unabhängigkeit für Frauen heute so wichtig?
Sie gilt als Grundvoraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und als Absicherung gegen die Risiken von Diskontinuitäten im Lebenslauf (z.B. Trennung).
- Citation du texte
- Gesa Brüchmann (Auteur), 2001, Wandel und Kontinuität im Verhältnis von Familie und Beruf in Ost- und Westdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62654