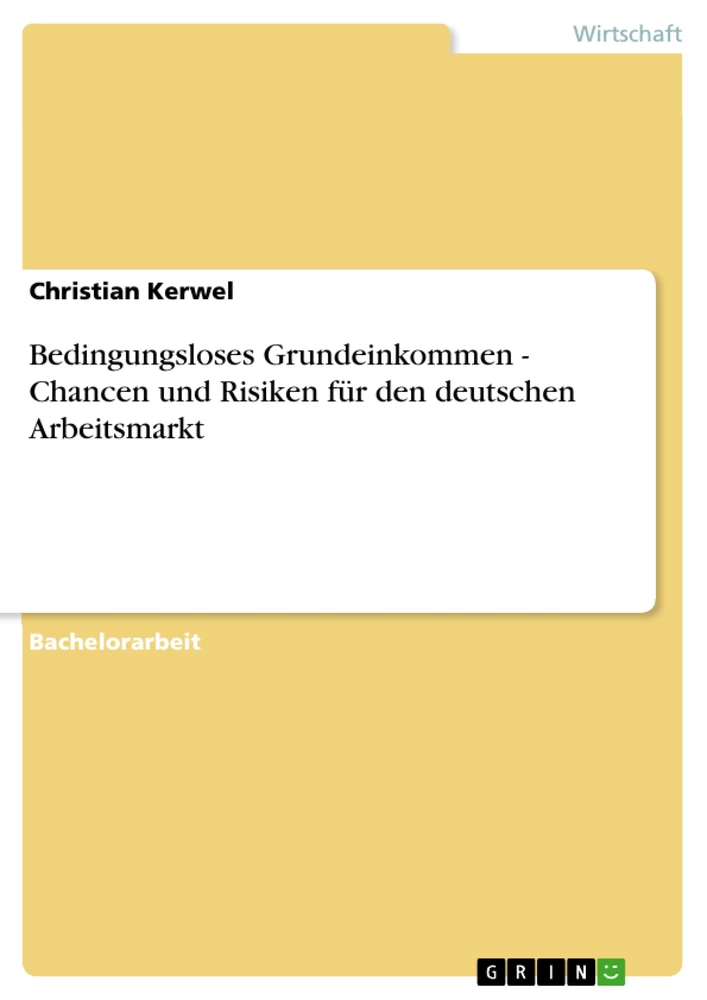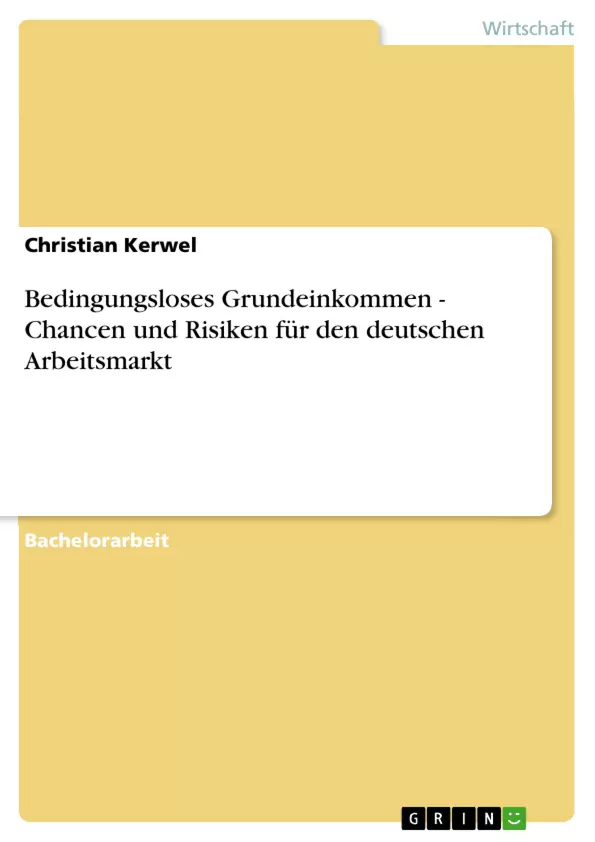Das Ziel der effektiven Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit beschäftigt seit Jahrzehnten Wissenschaftler, Politiker und Verbände. Zahlreiche Konzepte und Reformen wurden weltweit durchgeführt - bislang ohne den gewünschten Erfolg. Seit Jahren wächst in Deutschland trotz steigender Produktivität die Arbeitslosigkeit. Mit dem Grundeinkommen wollen seine Befürworter den Herausforderungen der Arbeitslosigkeit und Armut gerecht werden. Das Urteil der Kritiker fällt unterschiedlich aus: naiv, gefährlich und wirtschaftlich schädlich. Trotzdem wird die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen seit Jahrzehnten geführt und heute mehr denn je in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Bereits in den 1960er Jahren wurden unter anderem durch die Unterstützung von Milton Friedman in den USA einige Gesetzesvorlagen dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt. Weltweit haben sich Wissenschaftler, Politiker und Verbände für die Einführung eines Grundeinkommens eingesetzt. Vereinfacht ausgedrückt steht der Begriff Grundeinkommen für die Idee einer garantierten Zahlung des Staates an seine Bürger, die weder an Bedingungen geknüpft ist, noch Kontrollen der Bedürftigkeit unterliegt. Gleichzeitig legen die meisten Konzepte eine umfassende Reform und Vereinfachung der bestehenden Sozialsysteme zugrunde. Indessen unterscheiden sich die entwickelten Ansätze hinsichtlich der Höhe der Zahlung, des Finanzierungsansatzes und der jeweiligen Zielvorstellungen. Dabei bricht die Abkopplung des Lohns von der Erwerbsarbeit mit sämtlichen gewachsenen Denkmustern, Wertevorstellungen und nicht zuletzt dem biblischen Ausspruch „wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“. Tatsache ist aber auch, dass durch die seit Jahrzehnten wachsende Arbeitslosigkeit immer mehr Menschen schon heute von der Erwerbsarbeit abgekoppelt sind. In der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sehen die Befürworter die Lösung der akuten wirtschafts- und armutspolitischen Probleme. Es wird als konsequente Re-form und Anpassung der bisherigen sozialen Sicherungssyteme an die sich wandelnde Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft verstanden. Da die Diskussion um ein Grundeinkommen weltweit geführt wird, liegen unterschiedlichste Vorschläge zur Ausgestaltung vor. So werden Grundeinkommenskonzepte auch als Negative Einkommensteuer, Bürgergeld und Sozialdividende bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens
- Die Vordenker eines bedingungslosen Grundeinkommens
- Probleme der Begriffsabgrenzung
- Vorschläge zur Ausgestaltung eines Grundeinkommens in Deutschland
- Diskussionspapier von Bündnis 90/Die Grünen
- Vorschlag der FDP zu einem liberalen Bürgergeld
- Entwurf des Netzwerk Grundeinkommens
- Ansätze zur Festlegung der Grundeinkommenshöhe
- Finanzierungsmodelle des Grundeinkommens
- Das Transfergrenzen-Modell der Universität Ulm
- Vorschlag des Netzwerk Grundeinkommens
- Grundeinkommen – ein Feldversuch
- Der Alaska Permanent Fund
- Das Experiment des Office of Economic Opportunity
- Potentielle Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Angebotseffekt
- Nachfrageeffekt
- Existenzgründungen
- Grundeinkommen als Mindestlohn?
- Gegenüberstellung von Grundeinkommen und ökonomischen Theorien
- Unterschiedliche Formen der Arbeitslosigkeit
- Heterogenes versus homogenes Arbeitsangebot
- Mikroökonomische Betrachtung des Arbeitsangebotes
- Makroökonomischer Erklärungsansatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben könnte. Sie untersucht die Grundprinzipien des Grundeinkommens, analysiert verschiedene Modelle und betrachtet die potenziellen Folgen für das Arbeitsangebot und die Nachfrage.
- Die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens
- Verschiedene Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens
- Die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens
- Potentielle Auswirkungen auf das Arbeitsangebot und die Nachfrage
- Die Bedeutung des bedingungslosen Grundeinkommens im Kontext ökonomischer Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens und seiner historischen Entwicklung. Es beleuchtet die verschiedenen Ansätze und Vorschläge zur Ausgestaltung eines Grundeinkommens in Deutschland und analysiert die Problemstellungen im Hinblick auf die Begriffsabgrenzung. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Finanzierungsmodelle des Grundeinkommens vorgestellt, darunter das Transfergrenzen-Modell und der Vorschlag des Netzwerk Grundeinkommens. Außerdem werden zwei Feldversuche aus der Vergangenheit, der Alaska Permanent Fund und das Experiment des Office of Economic Opportunity, vorgestellt. Kapitel 3 fokussiert sich auf die potenziellen Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf den deutschen Arbeitsmarkt und untersucht dabei Angebotseffekte, Nachfrageeffekte, Existenzgründungen und die mögliche Funktion als Mindestlohn. Das vierte Kapitel widmet sich der Gegenüberstellung des Grundeinkommens mit ökonomischen Theorien, wobei sowohl mikro- als auch makroökonomische Ansätze beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themenfelder des bedingungslosen Grundeinkommens, des deutschen Arbeitsmarktes, der Arbeitslosigkeit, der Einkommensverteilung, der Arbeitsmarktpolitik, der Finanzierungsmodelle, der ökonomischen Theorien und der Feldversuche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernidee eines bedingungslosen Grundeinkommens?
Es handelt sich um eine garantierte staatliche Zahlung an alle Bürger, die ohne Bedingungen und ohne Prüfung der Bedürftigkeit ausgezahlt wird.
Welche Modelle werden in Deutschland für ein Grundeinkommen diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem das liberale Bürgergeld der FDP, Vorschläge von Bündnis 90/Die Grünen sowie das Modell des Netzwerks Grundeinkommen.
Welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden erwartet?
Die Arbeit untersucht potenzielle Angebotseffekte, Nachfrageeffekte, Auswirkungen auf Existenzgründungen und die Frage, ob das Grundeinkommen als Mindestlohn fungieren könnte.
Wie könnte ein solches System finanziert werden?
Vorgestellt werden Finanzierungsmodelle wie das Transfergrenzen-Modell der Universität Ulm oder Konzepte über eine umfassende Reform der Sozialsysteme.
Gibt es historische Vorbilder oder Feldversuche?
Ja, die Arbeit nennt den Alaska Permanent Fund und Experimente des Office of Economic Opportunity als Beispiele für praktische Anwendungen.
- Quote paper
- Christian Kerwel (Author), 2006, Bedingungsloses Grundeinkommen - Chancen und Risiken für den deutschen Arbeitsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62726