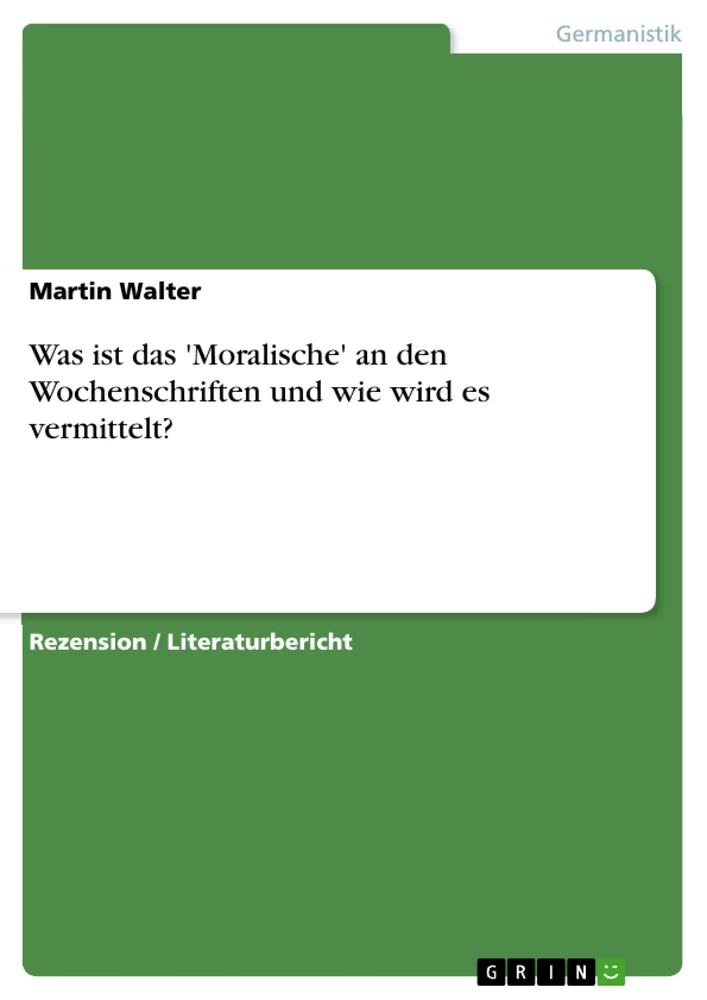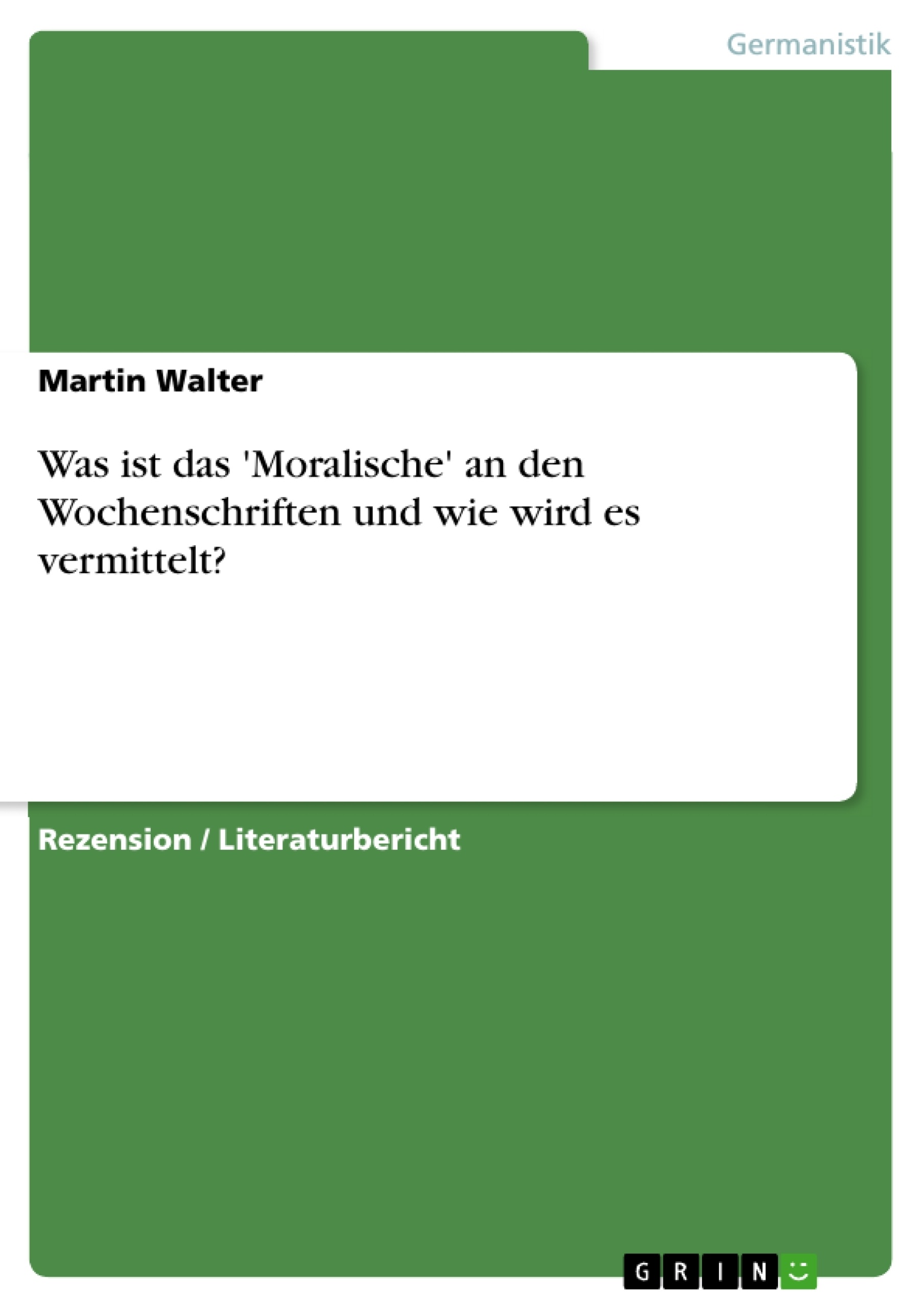Beide Wochenschriften, sowohl Die Matrone von Johann Georg Hamann als auch Der Biedermann von Johann Christoph Gottsched, werden von einer fiktiven Verfasserfigur geschrieben, auf die bereits der Titel der jeweiligen Zeitschrift hinweist. Die erste Ausgabe beider Wochenschriften dient dazu, dem Leser die Intention, die Funktion und die Vorgehensweise der Zeitschrift nahe zulegen, alle weiteren Aufmachungen sind sich meist sehr ähnlich: Einem kurzen Motto am Anfang folgen fortlaufende Texte zu einem bestimmten Thema, gelegentlich werden aber auch fingierte Leserbriefe oder eingefügte Gedichte abgedruckt. Die behandelten Themen sind dabei äußerst vielfältig: Ausführungen über Religion, Aberglaube, die richtige Kindererziehung- und Ausbildung, oder die galante Lebensführung stehen Exkurse über das Benehmen bei Theateraufführungen oder den Karneval gegenüber.
Das Moralische an den Wochenschriften ist dabei das Nützliche das sie vermitteln wollen, vor allem zielen die Aufsätze darauf ab, durch Einführung einer gewissen Tugend die Sitten der Menschen zu verbessern. Daher schildert auch Gottsched rückwirkend in der letzten Ausgabe des Biedermann seine Absichten darin liegend, „die Unvernunft und das Laster auszurotten, hingegen Verstand und Tugend ... zu befördern“. Hamann, bzw. sein alter ego, spricht in der ersten Ausgabe der Matrone hauptsächlich die Jugend an wenn er die Ziele seiner Wochenschrift nennt: „Ich werde ihre gewöhnlichen Fehler anmercken, sie wider Vorurtheile wappnen, und vor gewissen schädlichen Gewohnheiten warnen“.
Inhaltsverzeichnis
- Die Matrone und Der Biedermann: Moralische Wochenschriften
- Fiktive Verfasserfiguren und Struktur der Zeitschriften
- Moralische Inhalte und Zielsetzung
- Vermittlung der Moral: Prodesse et delectare
- Fiktive Verfasser, Leserbriefe und Glaubwürdigkeit
- Satire als Mittel der Moral-Vermittlung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die beiden moralischen Wochenschriften „Die Matrone“ von Johann Georg Hamann und „Der Biedermann“ von Johann Christoph Gottsched. Sie untersucht, wie die Autoren das „Moralische“ in ihren Publikationen vermitteln und welche Strategien sie dabei verwenden. Dabei liegt der Fokus auf der Funktion der fiktiven Verfasserfiguren, der Nutzung von Leserbriefen sowie der Anwendung satirischer Elemente. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle von Moral und Tugend in der Literatur des 18. Jahrhunderts.
- Die Funktion fiktiver Verfasserfiguren in moralischen Wochenschriften
- Die Rolle von Leserbriefen in der Gestaltung der Moral
- Das Prinzip von „prodesse et delectare“ in der Vermittlung von Moral
- Die Nutzung satirischer Elemente als Mittel der Moral-Vermittlung
- Der Einfluss der Aufklärung auf die Moralvorstellungen der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Struktur der beiden moralischen Wochenschriften. Er beleuchtet die Funktion der fiktiven Verfasserfiguren und beschreibt die typischen Merkmale der Zeitschriften. Der zweite Teil konzentriert sich auf die moralischen Inhalte der Schriften. Er analysiert die Ziele der Autoren und untersucht die Methoden, die sie zur Vermittlung ihrer moralischen Botschaften einsetzen. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Verwendung von Leserbriefen und der Rolle der Satire als Mittel der Moral-Vermittlung.
Schlüsselwörter
Moralische Wochenschriften, Johann Georg Hamann, Johann Christoph Gottsched, „Die Matrone“, „Der Biedermann“, fiktive Verfasserfiguren, Leserbriefe, Satire, prodesse et delectare, Aufklärung, Tugend, Laster, Sitten, Moral, Literatur des 18. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Moralische Wochenschriften“?
Es sind Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, die durch literarische Texte Tugend und Verstand fördern und die Sitten der Leser verbessern wollten.
Wer verbirgt sich hinter der Zeitschrift „Der Biedermann“?
„Der Biedermann“ wurde von dem Aufklärer Johann Christoph Gottsched unter einer fiktiven Verfasserfigur herausgegeben.
Was ist das Ziel von Hamanns „Die Matrone“?
Die Zeitschrift richtet sich primär an die Jugend, um vor Fehlern und schädlichen Gewohnheiten zu warnen und sie gegen Vorurteile zu wappnen.
Was bedeutet das Prinzip „prodesse et delectare“?
Es bedeutet „nützen und erfreuen“ – die moralische Belehrung wurde unterhaltsam verpackt, um die Leser besser zu erreichen.
Welche Rolle spielen fiktive Leserbriefe in diesen Schriften?
Sie dienten dazu, moralische Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und die Glaubwürdigkeit der Verfasserfigur zu erhöhen.
Warum wurde Satire in den Wochenschriften eingesetzt?
Satire wurde genutzt, um Laster und Unvernunft lächerlich zu machen und so den Leser indirekt zur Tugend zu führen.
- Citar trabajo
- Martin Walter (Autor), 2006, Was ist das 'Moralische' an den Wochenschriften und wie wird es vermittelt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62964