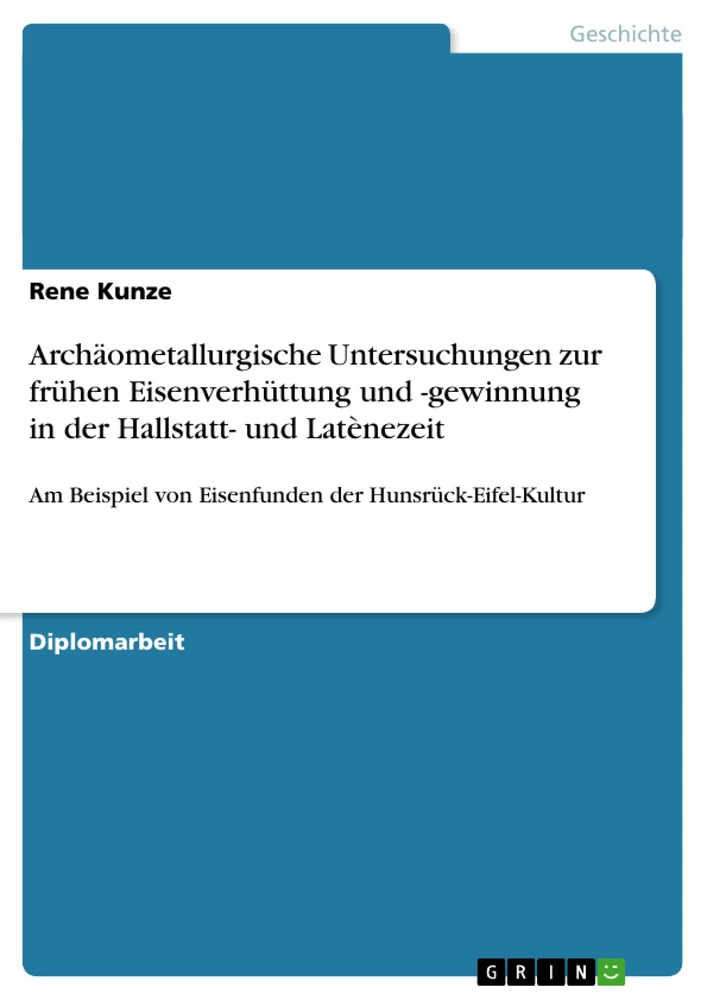Archäologische Untersuchungen der vergangenen 100 Jahre im Bereich der Eifel und des Hunsrücks in Deutschland erbrachten Erkenntnisse, die aufgrund ihrer Menge dazu führten, dass ein „Kulturbild“ für diese Region entstand. Die von K. Schumacher als solche deklarierte „Hunsrück-Eifel-Kultur“ konnte zeitlich in die Späthallstattzeit bis in die mittlere Latènezeit eingeordnet werden. Forschungen zeigten, dass in diesem Gebiet sehr früh metallurgische Kenntnisse über die Verhüttung von Eisen vorhanden waren. Diese Arbeit setzt sich zum Ziel Fragen zur Eisentechnologie (Herkunft und Art der Eisenerze, Metallurgische Prozesse etc.) klären zu können. Dazu fanden metallografische und chemische Analysen mittels Auflichtmikroskop und Elektronenstrahlmikrosonde statt.
Bei den Probenahmen wurde bewusst auf eine Differenzierung nach Regionen, Hunsrück und Eifel, geachtet, um mögliche Unterschiede aufzuzeigen. Die metallografische Untersuchung sowie die Auswertung der Analysen der Schlackeneinschlüsse durch binäre und ternäre Diagramme zeigten eine eindeutige Dissonanz zwischen beiden Regionen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung & Zielsetzung
- 2 Überblick zur Hunsrück-Eifel-Kultur (HEK)
- 2.1 Forschungsgeschichte und Chronologie
- 2.2 HEK – ein archäologischer Überblick
- 2.2.1 Voreisenzeitliche Besiedlung und Verbreitung
- 2.2.2 Siedlungswesen
- 2.2.3 Gräberfelder und die Interpretation des Fundgutes
- 2.2.4 Sozialstruktur
- 2.3 Kritische Zusammenfassung und die Frage nach dem „Kulturbegriff“
- 3 Grundlagen der Eisengewinnung
- 3.1 Geschichtliches
- 3.2 Keltische Eisengewinnung und –verarbeitung
- 3.2.1 Der Rennofen
- 3.2.2 Roheisen und „Stahlherstellung“ (Rennfeuerverfahren)
- 3.2.3 Schlacken als „Abfallprodukte“ und die Rolle der Ofenwand
- 3.3 Eisenverhüttung im Untersuchungsgebiet sowie die Arbeit von J. Driehaus
- 4 Analytik
- 4.1 Probenaufbereitung und Analysenmethoden
- 4.2 Beschreibung der analytischen Verfahren
- 4.2.1 Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA)
- 4.2.1.1 Aufbau und Funktionsweise
- 4.2.1.2 Korrektur der quantitativen Röntgenanalyse
- 4.2.2 Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
- 4.2.2.1 Theoretische Grundlagen
- 4.2.2.2 Apparativer Aufbau
- 4.2.2.3 Korrektur
- 4.3 Fehlerbetrachtung
- 5 Geochemische und Mineralogische Betrachtung des Eisens
- 5.1 Allgemeines
- 5.2 Die Eisenerze und ihre Vorkommen im Bereich der Eifel
- 5.3 Die Eisenerzlagerstätten des Hunsrücks
- 6 Metallografische Untersuchungen
- 6.1 Grundlagen von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen (EKL)
- 6.1.1 Das System Eisen-Kohlenstoff
- 6.1.2 Die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts durch die „Punktzählmethode“
- 6.1.3 Härteprüfung
- 6.2 Auswertung der Metallografischen Untersuchung
- 6.2.1 Gesamtüberblick
- 6.2.2 Waffen
- 6.2.3 Gebrauchsgegenstände
- 6.2.4 Zusammenfassung
- 7 Auswertung der Chemischen Analyse der Schlackeneinschlüsse
- 7.1 Überblick
- 7.1.1 Methodik
- 7.1.2 Chemismus der Schlacken
- 7.2 Beschreibung der Schlackeneinschlüsse nach optischen Eigenschaften
- 7.3 Hauptelemente
- 7.4 Nebenelemente
- 7.5 Spurenelemente
- 7.6 Auffälligkeiten und Möglichkeiten der Rekonstruktion zur Erzbasis
- 8 Diskussion der Ergebnisse
- 8.1 Die Reduktion der Erze
- 8.1.1 Das Verhalten von SiO2
- 8.1.2 Das Verhalten von MnO
- 8.1.3 Das Verhalten von CaO
- 8.1.4 Das Verhalten von P2O5
- 8.2 Vermutungen zur Herkunft der verwendeten Erze der Proben des Hunsrücks
- 8.2.1 Überblick zur Erzgrundlage
- 8.2.2 Die Sonderstellung von Pr. TR_6 – die Rolle des MgO
- 8.3 Vergleich der Eisenverhüttung: Hunsrück und (Ost-)Eifel
- 8.4 Überlegungen zu den Proben des RLMB („Eifelproben“)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht früh- bis mitteleisenzeitliche Eisenartefakte aus dem Hunsrück und der Eifel, um Fragen zur Eisentechnologie dieser Region zu klären. Es werden metallografische und chemische Analysen von Eisenfunden und Schlackeneinschlüssen durchgeführt, um Herstellungsprozesse und die verwendeten Eisenerze zu rekonstruieren.
- Metallografische Analyse der Eisenartefakte
- Chemische Analyse der Schlackeneinschlüsse
- Rekonstruktion der metallurgischen Prozesse
- Bestimmung der Herkunft und Art der Eisenerze
- Regionale Unterschiede in der Eisenverhüttung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung & Zielsetzung: Die Arbeit untersucht die frühe Eisenverhüttung im Hunsrück und der Eifel, basierend auf archäologischen Funden. Sie zielt darauf ab, Fragen zur Eisentechnologie (Erzherkunft, -art, Metallurgie) zu beantworten und regionale Unterschiede zu beleuchten. Die Analyse von Eisenartefakten und Schlacken mittels Mikroskopie und Elektronenstrahlmikrosonde soll diese Fragen klären.
2 Überblick zur Hunsrück-Eifel-Kultur (HEK): Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die Forschungsgeschichte und Chronologie der Hunsrück-Eifel-Kultur, von den ersten Grabungen bis zu aktuellen Forschungsansätzen. Es beleuchtet die voreisenzeitliche Besiedlung, das Siedlungswesen, die Gräberfelder und die Sozialstruktur. Kritisch hinterfragt wird der "Kulturbegriff" und die Einheitlichkeit der HEK.
3 Grundlagen der Eisengewinnung: Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung der Eisengewinnung, die keltische Eisentechnologie mit Fokus auf das Rennfeuerverfahren, und die Rolle von Rennöfen, Roheisen und Schlacken. Die Arbeit von J. Driehaus und seine Thesen zur Bedeutung der Eisengewinnung für die HEK werden kritisch beleuchtet.
4 Analytik: Detaillierte Beschreibung der Probenaufbereitung und der angewandten Analysemethoden (Lichtmikroskopie, Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA), Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)). Der Aufbau und die Funktionsweise der Geräte sowie die Korrekturverfahren werden erläutert. Mögliche Fehlerquellen werden ebenfalls adressiert.
5 Geochemische und Mineralogische Betrachtung des Eisens: Das Kapitel beschreibt die allgemeine geochemische Bedeutung von Eisen, die verschiedenen Eisenerzminerale und ihre Vorkommen in der Eifel und im Hunsrück. Es werden verschiedene Eisenerztypen und ihre Eigenschaften im Detail dargestellt.
6 Metallografische Untersuchungen: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts und die Härteprüfung. Die metallografischen Untersuchungen der Eisenartefakte werden vorgestellt und regionale Unterschiede hinsichtlich Gefüge, Kohlenstoffgehalt und Härte diskutiert. Es wird die Frage nach bewussten Härtungsprozessen erörtert.
7 Auswertung der Chemischen Analyse der Schlackeneinschlüsse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der chemischen Analyse der Schlackeneinschlüsse in den Eisenartefakten. Es werden Hauptelemente, Nebenelemente und Spurenelemente betrachtet und deren Verteilung analysiert. Die Möglichkeiten zur Rekonstruktion der Erzbasis werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Hunsrück-Eifel-Kultur, Eisenverhüttung, Rennfeuerverfahren, Metallografie, Schlackenanalyse, Eisenerze, Regionale Unterschiede, Metallurgie, Archäometallurgie, Hallstattzeit, Latènezeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Früh- bis mitteleisenzeitliche Eisenartefakte aus dem Hunsrück und der Eifel
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht früh- bis mitteleisenzeitliche Eisenartefakte aus dem Hunsrück und der Eifel, um Fragen zur Eisentechnologie dieser Region zu klären. Konkret geht es um die Rekonstruktion der Herstellungsprozesse, die verwendeten Eisenerze und regionale Unterschiede in der Eisenverhüttung.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet metallografische und chemische Analysen von Eisenfunden und Schlackeneinschlüssen. Es wurden Lichtmikroskopie, Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA) und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) eingesetzt.
Welche Aspekte der Hunsrück-Eifel-Kultur (HEK) werden behandelt?
Die Arbeit bietet einen Überblick über die Forschungsgeschichte und Chronologie der HEK, beleuchtet die voreisenzeitliche Besiedlung, das Siedlungswesen, die Gräberfelder und die Sozialstruktur. Der "Kulturbegriff" und die Einheitlichkeit der HEK werden kritisch hinterfragt.
Wie werden die Eisengewinnung und -verarbeitung beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die geschichtliche Entwicklung der Eisengewinnung, die keltische Eisentechnologie mit Fokus auf das Rennfeuerverfahren, die Rolle von Rennöfen, Roheisen und Schlacken. Die Arbeit von J. Driehaus und seine Thesen werden kritisch beleuchtet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen die metallografische Charakterisierung der Eisenartefakte (Gefüge, Kohlenstoffgehalt, Härte), die chemische Analyse der Schlackeneinschlüsse (Hauptelemente, Nebenelemente, Spurenelemente), und die Rekonstruktion der Erzbasis. Regionale Unterschiede in der Eisenverhüttung werden diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Herkunft und Art der verwendeten Eisenerze, zu den metallurgischen Prozessen und zu regionalen Unterschieden in der Eisenverhüttung im Hunsrück und der Eifel. Vermutungen zur Herkunft der verwendeten Erze werden aufgestellt und ein Vergleich der Eisenverhüttung im Hunsrück und der (Ost-)Eifel durchgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hunsrück-Eifel-Kultur, Eisenverhüttung, Rennfeuerverfahren, Metallografie, Schlackenanalyse, Eisenerze, Regionale Unterschiede, Metallurgie, Archäometallurgie, Hallstattzeit, Latènezeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung & Zielsetzung; Überblick zur Hunsrück-Eifel-Kultur; Grundlagen der Eisengewinnung; Analytik; Geochemische und Mineralogische Betrachtung des Eisens; Metallografische Untersuchungen; Auswertung der Chemischen Analyse der Schlackeneinschlüsse; Diskussion der Ergebnisse.
- Citation du texte
- Dipl.-Arch. Rene Kunze (Auteur), 2006, Archäometallurgische Untersuchungen zur frühen Eisenverhüttung und -gewinnung in der Hallstatt- und Latènezeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63007