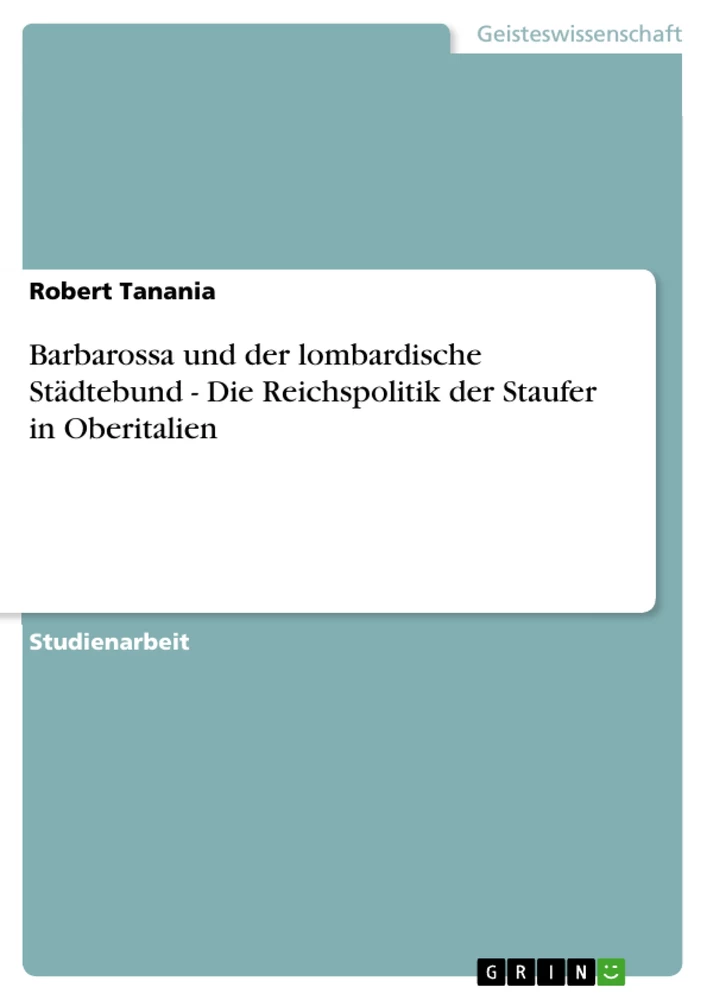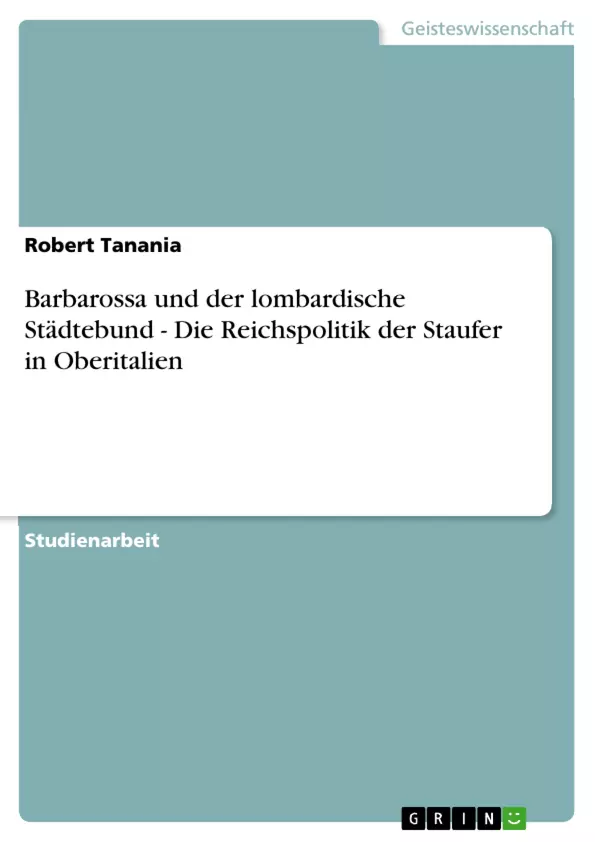Die Jahre von 1150 bis 1250 waren die entscheidenden in der Entwicklung der mittelalterlichen europäischen Städte und ihre Institutionen blieben bis in die Neuzeit ohne grundlegende Änderungen bestehen . In Italien bildeten sich Kommunen mit mehr Bürokratie als in den anderen europäischen Ländern.Die oberitalienische Region war neben Unteritalien, der Provence und Katalonien am offensten für Einflüsse aus der arabischen und der byzantinischen Welt.In Oberitalien ist die Kommune die Spitze einer Entwicklung, die schon in der fränkischen Zeit begann . Im Gegensatz zu Gallien, wo sich die Stadt im 3. und 4. Jahrhundert auf eine Zitadelle reduzierte, wurde die italienische Stadt von einer Mauer umgeben . In Gallien zog infolge dieser Entwicklung der Adel auf das Land und in Italien blieb die Aristokratie in der Stadt sesshaft . Die Mauer war im römischen Rechtsdenken heilig und dies kam auch in der Sage vom Sprung des Remus über die Stadtmauer zum Ausdruck . Das städtische Umland, der comitatus, wurde oft von der Kommune unterworfen und es hatte auch keine Teilhaberechte an der Kommune.In der weiteren Entwicklung konnte sich der ländlich orientierte Lehnsadel zwischen die bischöflichen und städtischen Strukturen schieben und eine innere Stabilität erreichen . In der Fachwelt gilt frühestens die Zeit der karolingischen Machtergreifung als die Geburtsstunde der Entstehung der Kommune . Während dieses Werdevorgangs des mittelalterlichen Stadt in Oberitalien standen diese in engstem politischen Kontakt mit Deutschland.Der Begriff Stadt bedeutete in Italien civitas, die der Mittelpunkt des umliegenden Territoriums war, das mit der Christianisierung zum Bischofssitz wurde . In den Urkunden des Lombardenbundes wird die Bezeichnung civitas den Bischofsstädten vorbehalten .
In den Kommunen wurde der hierarchisch-herrschaftlichen Ordnung des Mittelalters eine neue Form des menschlichen Zusammenwirkens mit neuen Formen der politischen Organisation entgegengesetzt .
Der Auslöser für die Ausbildung der städtischen Kommune war der seit der Herrschaft der Salier andauernde Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst: die Bedeutung der Bischöfe in den italienischen Städten hat durch diese Auseinandersetzung mehr zugenommen als in den Städten des Alten Reichs . Infolge der mit dem Investiturstreit einhergehenden Doppelwahlen kam es zur Entstehung von stärkeren sozialen und politischen Unruhen in den italienischen Kommunen .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Kommunen in Oberitalien
- 2. Consules, Podestàs und Rat
- 3. Die wirtschaftliche Entwicklung der oberitalienischen Kommunen
- 4. Die historische Entwicklung der Lombardei
- 4.1 Die Langobarden
- 4.2 Das bischöfliche Regime
- 5. Kaiser und Lombardenbund
- 5.1 Die Zeit bis Barbarossa
- 5.2 Ziele und Politik Barbarossas
- 5.3 Barbarossa und Italien
- 5.3.1 Ziele und Politik in Italien
- 5.3.2 Mailand
- 5.3.3 Erster Italienzug (1154)
- 5.3.4 Der Reichstag von Roncaglia bei Piacenza (1158)
- 5.3.5 Vierter Italienzug (Oktober 1166)
- 5.3.6 Der Lombardenbund
- 5.3.7 Fünfter Italienzug (1174)
- 5.3.8 Friede von Konstanz und Anerkennung des Lombardenbundes (1183)
- 6. Der Zweite und Dritte Lombardenbund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reichspolitik Kaiser Friedrich Barbarossas in Oberitalien im Kontext des lombardischen Städtebundes. Ziel ist es, die komplexen Beziehungen zwischen Kaiser und Kommunen zu analysieren und die Entwicklung des Städtebundes im Spannungsfeld zwischen kaiserlicher Macht und städtischer Autonomie zu beleuchten.
- Die Entwicklung der oberitalienischen Kommunen
- Die politische Organisation der Kommunen (Consules, Podestàs, Rat)
- Die wirtschaftliche Entwicklung Oberitaliens
- Die Ziele und Strategien Barbarossas in Italien
- Die Entstehung und Entwicklung des Lombardenbundes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Kommunen in Oberitalien: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Entstehung und die Strukturen der oberitalienischen Kommunen im Mittelalter. Es beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Herausbildung dieser selbstverwalteten Städte führten und skizziert die verschiedenen Formen der städtischen Organisation und Verwaltung, die in dieser Zeit entstanden sind. Die Entwicklung der Kommunen wird als ein komplexer Prozess dargestellt, der von regionalen Unterschieden und den jeweiligen politischen Kontexten geprägt wurde.
2. Consules, Podestàs und Rat: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen politischen Institutionen der oberitalienischen Kommunen. Es analysiert die Rollen der Consules, Podestàs und des Rates, um ein Verständnis der Machtstrukturen und der Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Städte zu entwickeln. Das Kapitel untersucht die Wechselwirkungen dieser Institutionen untereinander und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit, unter Berücksichtigung des komplexen Verhältnisses zwischen den einzelnen Akteuren und der jeweiligen städtischen Bevölkerung.
3. Die wirtschaftliche Entwicklung der oberitalienischen Kommunen: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Grundlagen des Aufstiegs der oberitalienischen Kommunen. Es untersucht den Handel, die Gewerbe und die Landwirtschaft, um die Faktoren zu identifizieren, die zu dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Städte beitrugen. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Städte als Zentren des Handels und des Finanzwesens im mittelalterlichen Europa und die Bedeutung dieser wirtschaftlichen Dynamik für die politische und soziale Entwicklung der Region.
4. Die historische Entwicklung der Lombardei: Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung der Lombardei, von der Herrschaft der Langobarden bis hin zur Entstehung der kommunalen Strukturen. Es setzt den Fokus auf die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die die Grundlage für die Entwicklung der Städte legten. Der Einfluss der Langobarden und des bischöflichen Regimes wird genauer untersucht. Dieses Kapitel dient als essentieller Kontext für das Verständnis der späteren Entwicklung der Kommunen und ihrer Beziehungen zum Kaiserreich.
5. Kaiser und Lombardenbund: Das Kapitel beschreibt die Beziehungen zwischen dem Kaiser und den lombardischen Kommunen, insbesondere unter Friedrich Barbarossa. Es analysiert Barbarossas politische Strategien und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Lombardenbundes. Die verschiedenen Italienzüge Barbarossas und ihre Konsequenzen werden im Detail beleuchtet, einschließlich der entscheidenden Ereignisse wie der Reichsversammlung von Roncaglia. Das Kapitel untersucht die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Kaiser und Kommunen und die letztendliche Anerkennung des Lombardenbundes.
6. Der Zweite und Dritte Lombardenbund: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklungen nach der Anerkennung des ersten Lombardenbundes, die zur Bildung von weiteren Bündnissen führten. Es analysiert die Ursachen für die anhaltende Konfliktsituation zwischen Kaiserreich und den Städten sowie die langfristigen Folgen dieser Auseinandersetzungen für die politische Landschaft Oberitaliens.
Schlüsselwörter
Friedrich Barbarossa, Lombardenbund, Oberitalien, Reichspolitik, Kommunen, Städteautonomie, Consules, Podestàs, Wirtschaft, Langobarden, Roncaglia, Italienzüge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kaiser Friedrich Barbarossa und der Lombardenbund"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reichspolitik Kaiser Friedrich Barbarossas in Oberitalien im Kontext des lombardischen Städtebundes. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Beziehungen zwischen Kaiser und Kommunen und der Entwicklung des Städtebundes im Spannungsfeld zwischen kaiserlicher Macht und städtischer Autonomie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der oberitalienischen Kommunen, ihre politische Organisation (Consules, Podestàs, Rat), die wirtschaftliche Entwicklung Oberitaliens, die Ziele und Strategien Barbarossas in Italien und die Entstehung und Entwicklung des Lombardenbundes. Die historische Entwicklung der Lombardei, von den Langobarden bis zum bischöflichen Regime, wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: 1. Die Kommunen in Oberitalien; 2. Consules, Podestàs und Rat; 3. Die wirtschaftliche Entwicklung der oberitalienischen Kommunen; 4. Die historische Entwicklung der Lombardei (inkl. Langobarden und bischöfliches Regime); 5. Kaiser und Lombardenbund (inkl. Barbarossas Italienzüge und die Reichsversammlung von Roncaglia); 6. Der Zweite und Dritte Lombardenbund.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die komplexen Beziehungen zwischen Kaiser und Kommunen zu analysieren und die Entwicklung des Städtebundes im Spannungsfeld zwischen kaiserlicher Macht und städtischer Autonomie zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Barbarossa, Lombardenbund, Oberitalien, Reichspolitik, Kommunen, Städteautonomie, Consules, Podestàs, Wirtschaft, Langobarden, Roncaglia, Italienzüge.
Was wird im Kapitel über die Kommunen in Oberitalien behandelt?
Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Entstehung und Strukturen der oberitalienischen Kommunen im Mittelalter. Es beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Herausbildung dieser selbstverwalteten Städte führten, und skizziert verschiedene Formen der städtischen Organisation und Verwaltung.
Was wird im Kapitel über Consules, Podestàs und Rat behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die politischen Institutionen der oberitalienischen Kommunen. Es analysiert die Rollen der Consules, Podestàs und des Rates, um die Machtstrukturen und Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Städte zu verstehen.
Was wird im Kapitel über die wirtschaftliche Entwicklung behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Grundlagen des Aufstiegs der oberitalienischen Kommunen, untersucht Handel, Gewerbe und Landwirtschaft und die Rolle der Städte als Zentren des Handels und Finanzwesens.
Was wird im Kapitel über die historische Entwicklung der Lombardei behandelt?
Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung der Lombardei von der Herrschaft der Langobarden bis zur Entstehung der kommunalen Strukturen. Der Einfluss der Langobarden und des bischöflichen Regimes wird genauer untersucht.
Was wird im Kapitel über Kaiser und Lombardenbund behandelt?
Das Kapitel beschreibt die Beziehungen zwischen Kaiser und lombardischen Kommunen, insbesondere unter Friedrich Barbarossa. Es analysiert Barbarossas politische Strategien und deren Auswirkungen auf den Lombardenbund, beleuchtet seine Italienzüge und die Reichsversammlung von Roncaglia.
Was wird im Kapitel über den Zweiten und Dritten Lombardenbund behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklungen nach der Anerkennung des ersten Lombardenbundes, die Ursachen für anhaltende Konflikte zwischen Kaiserreich und Städten und die langfristigen Folgen.
- Arbeit zitieren
- Robert Tanania (Autor:in), 2006, Barbarossa und der lombardische Städtebund - Die Reichspolitik der Staufer in Oberitalien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63033