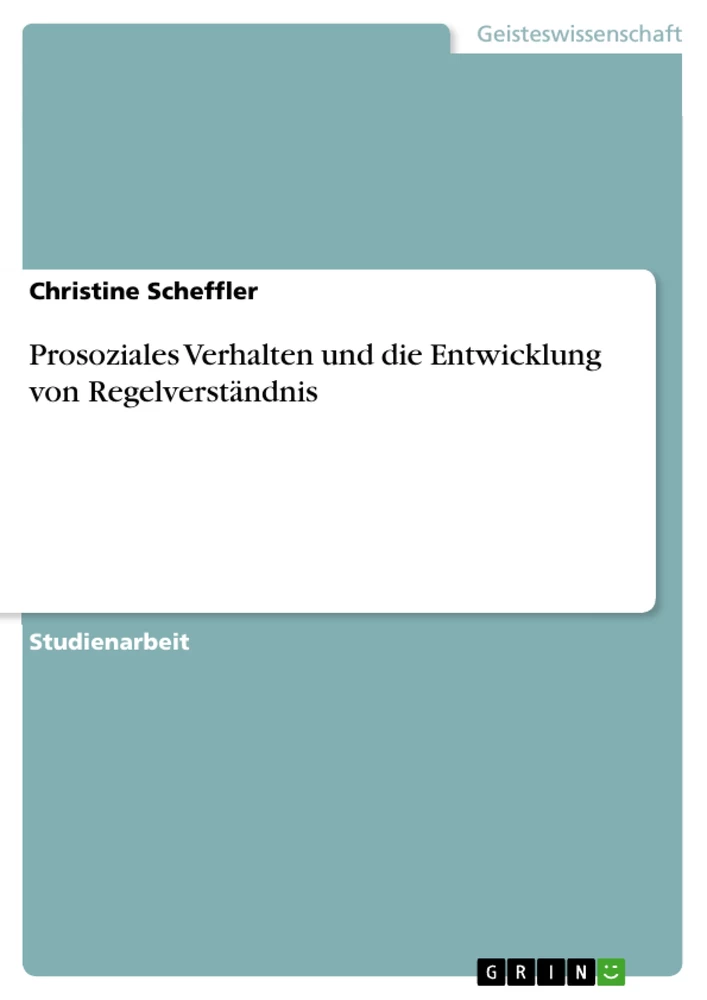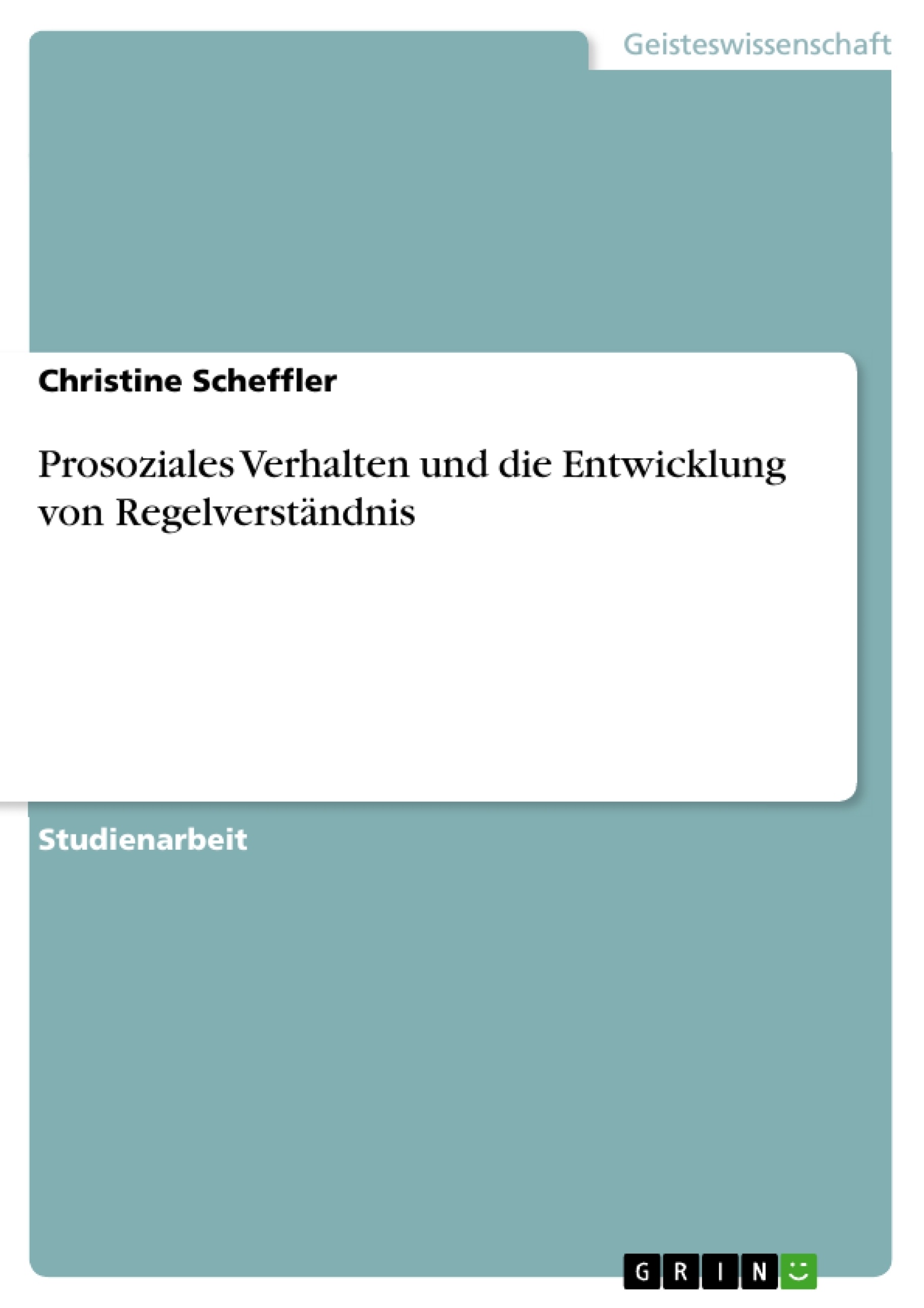Grundlage jeder prosozialen Handlung ist, dass der potentielle Helfer Mitgefühl für den Rezipienten entwickelt. Mitgefühl ist eine Reaktion auf die Situation, z. B. eine Notlage, eines anderen Menschen. Eine Definition von Wispe (1991, zitiert nach Ulich, Kienbaum & Volland, 2001) erklärt Mitgefühl als „die erhöhte Empfänglichkeit für das Leiden einer Person, das als etwas zu Linderndes empfunden wird.“
Mitgefühl entsteht als Reaktion auf die Notlage oder den Kummer einer anderen Person und umfasst eine Vielzahl möglicher Gefühlszustände und Gefühlsreaktionen. Gefühlszustände können Bekümmertheit, Beunruhigung, Bedauern, Besorgtheit und Fürsorglichkeit sein. Darin zeigen sich insgesamt individuelle Betroffenheit und Berührtheit, Emotionen, die das Gegenteil von Gleichgültigkeit darstellen (Ulich, Kienbaum & Volland, 2001,S. 4). Wie und ab welchem Alter entwickelt sich Mitgefühl? Nach Bischof-Köhler (1998, zitiert nach Ulich, Kienbaum & Volland, 2001, S. 5) sind Kinder zu mitfühlenden Reaktionen erst dann in der Lage, wenn sie zwischen sich und anderen unterscheiden können, auf Gesichtsausdrücke anderer reagieren können (Harris, 1992, zitiert nach Ulich, Kienbaum & Volland, 2001, S. 5) und wenn ihnen der Zusammenhang bestimmter Ereignisse und den dazugehörenden Gefühlen schon hinreichend vertraut ist. Diese Voraussetzungen scheinen um die Mitte des zweiten Lebensjahres gegeben zu sein (Ulich, Kienbaum & Volland, 2001, S. 5).
In dieser Arbeit geht es darum, zu zeigen, wie sich prosoziales Verhalten bei Kindern entwickelt und welche Faktoren dabei zusammen wirken. Es ist klar, dass dies ein komplexes Thema ist. Um es einzugrenzen habe ich mich auf die Forschungen von Peterson (u.a., 1982 & 1984) und Eisenberg (1983) beschränkt.
Peterson (u.a., 1982) hat erkannt, dass für das Ausführen prosozialer Handlungen eine Vielzahl von Faktoren zusammen spielen. Die Charakteristik des potentiellen Helfers, des Rezipienten und der Situation beschreibt sie als Einflussfaktoren, die letztendlich das prosoziale Handeln bestimmen. Sie hat diese Faktoren in einem Modell zusammengefasst, das ich in Kapitel 2 näher erläutere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein integratives Modell von Peterson, 1982. Prosoziales Verhalten und die Entwicklung von Mitgefühl.
- "I should help deserving individuals".
- ,,X levels of need"
- ,,The victim must be perceived as dependent on me for help"
- "when I can ascertain and perform the necessary behavior”.
- cost or risk.
- Studie von Eisenberg (1983). Kindliche Unterscheidungen gegenüber potentiellen Hilfeempfängern.......
- Hypothesen
- Methode
- Fragebogen....
- Ergebnisse...
- Studie von Peterson (1984). Welchen Einfluss haben Eltern auf das prosoziale Verhalten ihrer Kinder?
- Hypothesen
- Methode
- Fragebogen.......
- Ergebnisse......
- Schluss..
- Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung prosozialen Verhaltens bei Kindern und den Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Forschungsarbeiten von Peterson (1982 & 1984) und Eisenberg (1983).
- Das integrative Modell von Peterson (1982) zur Entwicklung von Mitgefühl und prosozialem Verhalten
- Kindliche Unterscheidungen gegenüber potentiellen Hilfeempfängern (Eisenberg, 1983)
- Der Einfluss der Eltern auf das prosoziale Verhalten ihrer Kinder (Peterson, 1984)
- Die Entwicklung von Mitgefühl und seine Bedeutung für prosoziales Verhalten
- Die Zusammenhänge zwischen Mitgefühl, moralischem Urteil und prosozialem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und den Forschungsstand zum Thema prosoziales Verhalten und Mitgefühl dar.
Kapitel 2 präsentiert das integrative Modell von Peterson (1982) zur Entwicklung von prosozialem Verhalten. Das Modell beschreibt die Faktoren, die das Ausführen prosozialer Handlungen beeinflussen, darunter die Charakteristik des potentiellen Helfers, des Rezipienten und der Situation.
Kapitel 3 stellt die Studie von Eisenberg (1983) vor, die kindliche Unterscheidungen gegenüber potentiellen Hilfeempfängern untersucht. Die Studie untersucht, wem Kinder eher helfen und wie sich ihr Urteilsvermögen gegenüber potentiellen Rezipienten mit dem Alter und der moralischen Entwicklung verändert.
Kapitel 4 behandelt die Studie von Peterson (1984), die den Einfluss der Eltern auf das prosoziale Verhalten ihrer Kinder untersucht. Diese Studie zeigt, inwieweit Eltern kindliches prosoziales Verhalten fördern oder beeinflussen.
Schlüsselwörter
Prosoziales Verhalten, Mitgefühl, Entwicklung, Peterson, Eisenberg, Kindliche Unterscheidungen, Eltern, Einflussfaktoren, Modell, Studien.
Häufig gestellte Fragen
Ab welchem Alter entwickeln Kinder Mitgefühl?
Voraussetzungen für Mitgefühl sind ab etwa der Mitte des zweiten Lebensjahres gegeben, wenn Kinder beginnen, zwischen sich und anderen zu unterscheiden.
Was ist prosoziales Verhalten?
Prosoziales Verhalten umfasst Handlungen, die darauf abzielen, anderen zu helfen, sie zu unterstützen oder ihr Wohlbefinden zu fördern, oft motiviert durch Mitgefühl.
Welche Faktoren beeinflussen laut Peterson prosoziales Handeln?
Peterson nennt die Charakteristika des Helfers, des Empfängers (Rezipienten) und der Situation sowie die wahrgenommenen Kosten oder Risiken der Hilfeleistung.
Welchen Einfluss haben Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder?
Die Studie von Peterson (1984) zeigt, dass elterliche Erziehungsmethoden und Vorbildfunktionen maßgeblich dazu beitragen, wie stark Kinder prosoziale Verhaltensweisen entwickeln.
Wem helfen Kinder am ehesten?
Laut Eisenberg (1983) machen Kinder Unterschiede bei potenziellen Hilfeempfängern; die Bereitschaft zu helfen hängt oft von der wahrgenommenen Bedürftigkeit und der Beziehung zum Empfänger ab.
Wie hängen Mitgefühl und moralisches Urteil zusammen?
Mitgefühl ist oft der emotionale Auslöser, während das moralische Urteil die kognitive Bewertung der Situation darstellt, die darüber entscheidet, ob eine Hilfeleistung als notwendig erachtet wird.
- Citar trabajo
- Magister Artium Christine Scheffler (Autor), 2002, Prosoziales Verhalten und die Entwicklung von Regelverständnis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63048