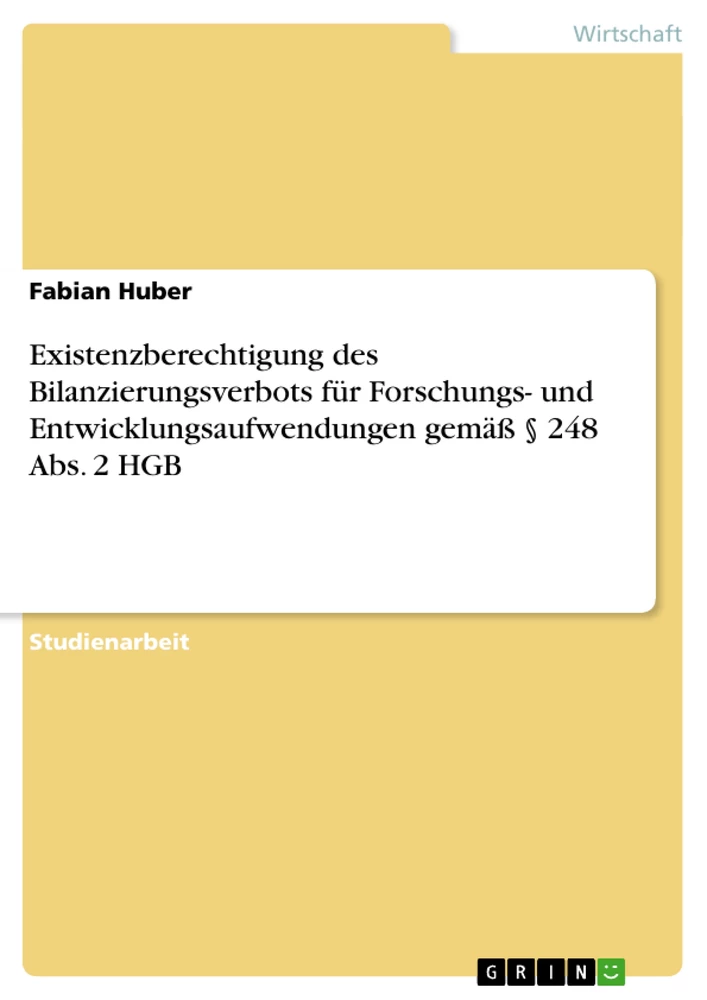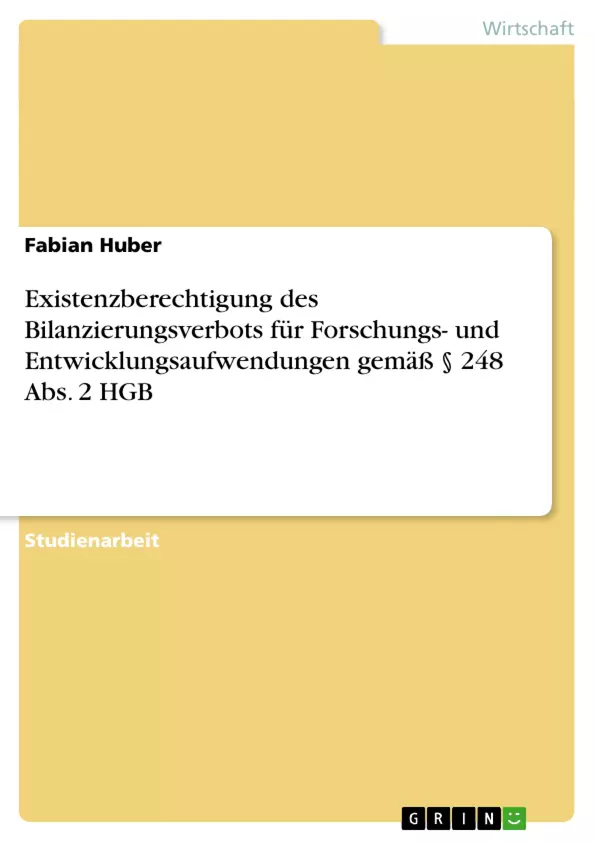Forschung und Entwicklung gewinnen in der sich zur Hochtechnologie wandelnden Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Internationaler Konkurrenz ausgesetzt sind die Unternehmen auf den globalen Märkten zu immer neuen Innovationen gezwungen, um ihr Geschäft auszuweiten oder ihre Stellung zu behaupten. Parallel zu dieser Entwicklung findet eine Internationalisierung der Kapitalmärkte statt. Investitionen sind frei von örtlicher Bindung. Dadurch entstehen zwei Probleme für die externe Rechnungslegung. Zum einen verlangen die global agierenden Kapitalgeber nach einer international vergleichbaren Rechnungslegung, zum anderen wird von den Unternehmen eine transparente Berichterstattung verlangt, die das Unternehmen realitätsnah abbildet. Der „true-and-fair-view“ Grundsatz der Rechnungslegungsstandards US-GAAP und IAS wird diesen Anforderungen besser gerecht als das deutsche Handelsrecht. Bei der bilanziellen Behandlung von Aufwendungen für F&E besteht im deutschen Handelsrecht ein grundsätzlicher Unterschied zu den international vorherrschenden anglo-amerikanischen Rechnungslegungsstandards der US-GAAP und der IAS. Das im deutschen Handelsrecht verankerte Bilanzierungsverbot für selbst
geschaffene, immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB steht einer international vergleichbaren und transparenten Berichterstattung im Wege. Hinsichtlich des leitenden Grundsatzes der deutschen Rechnungslegung, dem
Gläubigerschutz, hat dieses Bilanzierungsverbot seine Berechtigung. Die folgende Arbeit geht der Frage nach, ob das Bilanzierungsverbot für Aufwendungen der F&E gemäß § 248 Abs.2 HGB vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen berechtigt existent ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im deutschen Handelsrecht
- 2.1 Begriff der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
- 2.2 Einschlägigkeit des Bilanzierungsverbots
- 3 Existenzberechtigung des Bilanzierungsverbots
- 3.1 Argumentation für den § 248 Abs. 2 HGB
- 3.1.1 Normenkonflikte innerhalb des HGB
- 3.1.2 Kommunikation mit dem Finanzmarkt
- 3.2 Gründe für die Aufhebung des Bilanzierungsverbots
- 3.2.1 Eingeschränkte Dokumentation der Handelsbilanz
- 3.2.2 Interessen der Marktteilnehmer
- 4 Ausblick und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Berechtigung des Bilanzierungsverbots für Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen gemäß § 248 Abs. 2 HGB. Die Arbeit analysiert die Spannungen zwischen internationaler Vergleichbarkeit, Transparenz und dem deutschen Gläubigerschutz im Kontext der zunehmenden Bedeutung von F&E in der modernen Wirtschaft.
- Der Begriff und die Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten
- Die Argumentation für und gegen das Bilanzierungsverbot gemäß § 248 Abs. 2 HGB
- Die Auswirkungen des Bilanzierungsverbots auf die internationale Vergleichbarkeit der Rechnungslegung
- Der Konflikt zwischen dem Bilanzierungsverbot und den Prinzipien der Transparenz und des „true-and-fair-view“
- Die Interessen der Marktteilnehmer und deren Einfluss auf die Debatte um das Bilanzierungsverbot
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik des Bilanzierungsverbots für Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen gemäß § 248 Abs. 2 HGB ein. Sie stellt die zunehmende Bedeutung von F&E in der globalisierten Wirtschaft heraus und verdeutlicht den Konflikt zwischen internationaler Vergleichbarkeit der Rechnungslegung und dem deutschen Gläubigerschutz. Die Arbeit untersucht die Frage nach der Berechtigung des Bilanzierungsverbots im Lichte aktueller Entwicklungen und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
2 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im deutschen Handelsrecht: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Forschung“ und „Entwicklung“ und grenzt diese voneinander ab. Es erläutert, warum F&E-Aufwendungen unter den Tatbestand des § 248 Abs. 2 HGB fallen und somit bilanzierungsfrei sind. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen der Forschungsphase (Suche nach neuen Erkenntnissen) und der Entwicklungsphase (Nutzung von Forschungsergebnissen zur Produkt- oder Prozessverbesserung) und ihren jeweiligen Auswirkungen auf die bilanzielle Behandlung.
Schlüsselwörter
Bilanzierungsverbot, Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen, § 248 Abs. 2 HGB, International Accounting Standards (IAS), United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP), Gläubigerschutz, Transparenz, internationale Vergleichbarkeit, Rechnungslegung, Handelsrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Bilanzierungsverbot für Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen gemäß § 248 Abs. 2 HGB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Berechtigung des Bilanzierungsverbots für Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen gemäß § 248 Abs. 2 HGB. Sie analysiert die Spannungen zwischen internationaler Vergleichbarkeit, Transparenz und dem deutschen Gläubigerschutz im Kontext der zunehmenden Bedeutung von F&E in der modernen Wirtschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: den Begriff und die Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten; die Argumentation für und gegen das Bilanzierungsverbot gemäß § 248 Abs. 2 HGB; die Auswirkungen des Bilanzierungsverbots auf die internationale Vergleichbarkeit der Rechnungslegung; den Konflikt zwischen dem Bilanzierungsverbot und den Prinzipien der Transparenz und des „true-and-fair-view“; und die Interessen der Marktteilnehmer und deren Einfluss auf die Debatte um das Bilanzierungsverbot.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im deutschen Handelsrecht, ein Kapitel zur Existenzberechtigung des Bilanzierungsverbots und einen Ausblick. Die Einleitung führt in die Problematik ein und skizziert den Aufbau. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Forschung“ und „Entwicklung“ und erläutert deren bilanzielle Behandlung. Kapitel 3 analysiert die Argumente für und gegen das Bilanzierungsverbot. Der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die zentralen Argumente für das Bilanzierungsverbot?
Die Argumente für das Bilanzierungsverbot gemäß § 248 Abs. 2 HGB werden in der Arbeit detailliert untersucht und umfassen unter anderem die Vermeidung von Normenkonflikten innerhalb des HGB und die Kommunikation mit dem Finanzmarkt. Die Arbeit berücksichtigt die potenziellen Schwierigkeiten bei der Bewertung von F&E-Aufwendungen und die Risiken für den Gläubigerschutz.
Was sind die zentralen Argumente gegen das Bilanzierungsverbot?
Die Argumente gegen das Bilanzierungsverbot zielen auf eine verbesserte Transparenz und internationale Vergleichbarkeit der Rechnungslegung ab. Es wird argumentiert, dass die eingeschränkte Dokumentation der Handelsbilanz durch das Verbot und die Interessen der Marktteilnehmer eine Aufhebung des Verbots rechtfertigen könnten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Bilanzierungsverbot, Forschungs- und Entwicklung (F&E)-Aufwendungen, § 248 Abs. 2 HGB, International Accounting Standards (IAS), United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP), Gläubigerschutz, Transparenz, internationale Vergleichbarkeit, Rechnungslegung, Handelsrecht.
Welche internationalen Vergleichsstandards werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die International Accounting Standards (IAS) und die United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP), um die internationale Vergleichbarkeit der Rechnungslegung im Kontext des deutschen Bilanzierungsverbots zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Ausblick zusammengefasst und bewerten die Berechtigung des bestehenden Bilanzierungsverbots im Lichte der dargelegten Argumente und der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Rechnungslegung.
- Quote paper
- Fabian Huber (Author), 2006, Existenzberechtigung des Bilanzierungsverbots für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen gemäß § 248 Abs. 2 HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63061