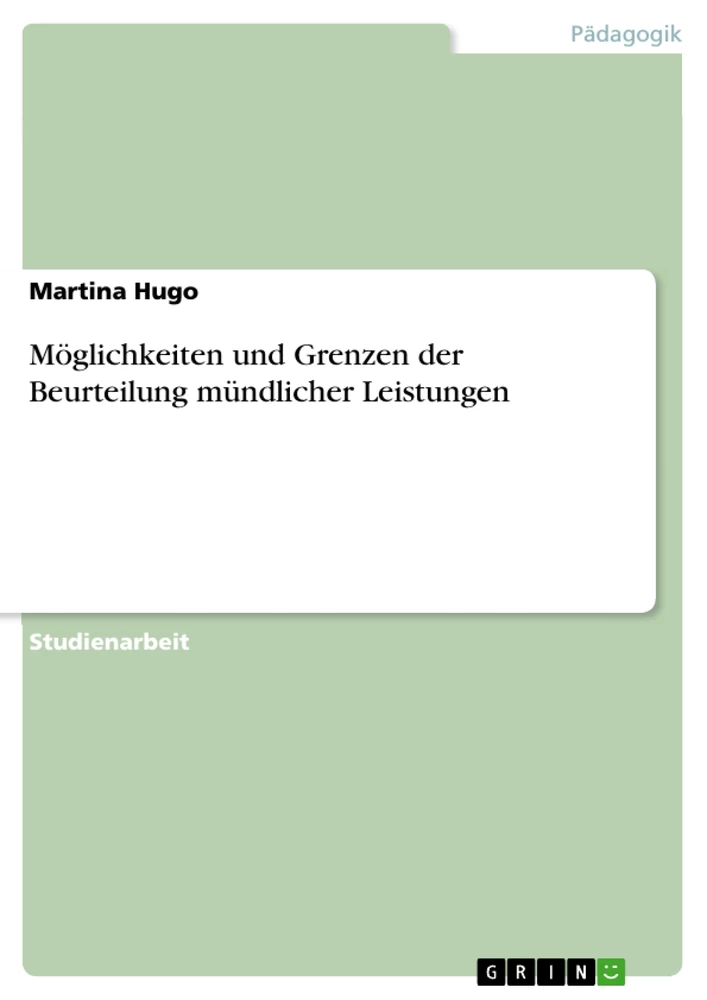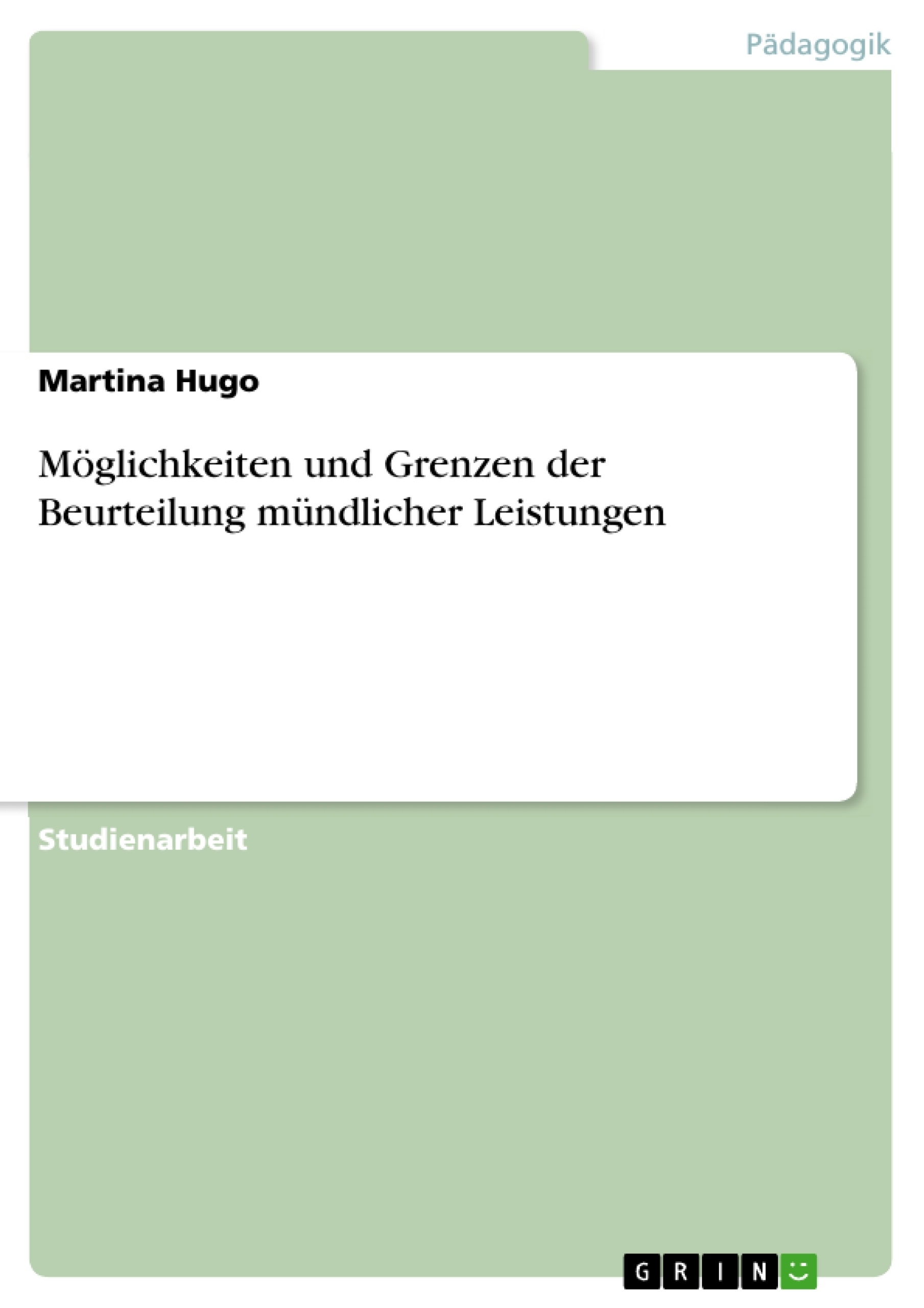Die Feststellung und Bewertung mündlich erbrachter Leistungen ist ein zentraler Bestandteil der schulischen Alltagspraxis und dient dem Lehrer dazu, Informationen über den aktuellen Leistungsstand und die Lernentwicklung des Schülers zu erhalten.
Bislang existieren keine schulgesetzlichen Erlasse und Verordnungen, die diese Form der Leistungserbringung und –bewertung zwingend vorschreiben. Allerdings werden immer wieder Stimmen laut, die entgegen der bisherigen Praxis fordern, die mündlich erbrachten Leistungen in die Endbewertung und damit in die Zeugnisnote stärker einfließen zu lassen als die schriftlich erbrachten Leistungen. Grundlage für die Umsetzung dieser Forderungen sind eine planmäßige und systematische Erfassung, Dokumentation, Bewertung und Interpretation der mündlichen Leistungen, sowie eine Sicherstellung, dass die Erbringung und Bewertung mündlicher Leistungen für alle Schüler einer Klasse unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt werden kann. Bislang steht die geübte Praxis einer entsprechenden Regelung häufig diametral entgegen.
Ziel dieser Arbeit ist es, auf der Grundlage eines einheitlichen Leistungsverständnisses und der Charakterisierung der mündlichen Leistung in Abgrenzung zur schriftlichen Leistung, die Chancen und möglichen Gefahren bei der Beurteilung mündlicher Leistungen einander gegenüberzustellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt insbesondere bei der Visualisierung dieser Herausforderungen anhand von Beispielen aus dem Bereich der beruflichen Schulen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leistungsprinzip im schulischen Kontext
- Der Leistungsbegriff
- Definition
- Merkmale der Leistungserbringung
- Charakterisierung mündlicher Leistungen
- Einordnung und Kategorisierung mündlicher Leistungen
- Merkmale mündlicher Leistungen in Abgrenzung zu schriftlichen Leistungen
- Rahmenbedingungen der mündlichen Leistungsfeststellung
- Der Istzustand in der Praxis
- Schulrechtliche Aspekte
- Gesellschaftliche und psychologische Aspekte
- Pädagogische und didaktische Aspekte
- Der Beurteilungsprozess mündlicher Leistungen
- Beobachten und Wahrnehmen
- Gütekriterien der Leistungsmessung
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Methoden der Leistungsdokumentation
- Der Lehrer als Beobachter
- Selbsteinschätzung durch den Schüler
- Leistungsbewertung
- Anforderungen
- Bezugsnormen
- Herausforderungen bei der Beurteilung mündlicher Leistungen
- Mögliche Vorteile der mündlichen Leistungsfeststellung
- Beurteilungsfehler
- Reformperspektiven
- Handlungsempfehlungen zur Ausschöpfung der Potenziale mündlicher Prüfungen
- Charakterisierung der Prüfungssituation
- Kriterien einer zielführenden Vorbereitung
- Gestaltungsfaktoren für die Durchführung der mündlichen Prüfung
- Möglichkeiten einer gütegerechten Beurteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Möglichkeiten und Grenzen der Beurteilung mündlicher Leistungen im schulischen Kontext. Ziel ist es, die komplexen Aspekte der mündlichen Leistungsfeststellung zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für eine gütegerechte Beurteilung zu entwickeln.
- Der Leistungsbegriff und seine Anwendung auf mündliche Leistungen
- Die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Beurteilung mündlicher Leistungen
- Gütekriterien der Leistungsmessung (Objektivität, Reliabilität, Validität) im Kontext mündlicher Prüfungen
- Methoden der Leistungsdokumentation und -bewertung
- Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten der mündlichen Leistungsfeststellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beurteilung mündlicher Leistungen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage.
Das Leistungsprinzip im schulischen Kontext: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Leistung“ im schulischen Kontext und beschreibt die spezifischen Merkmale der Leistungserbringung, insbesondere im Vergleich zu schriftlichen Leistungen. Es beleuchtet das Leistungsprinzip und seine Bedeutung für die Bewertung von Schülerleistungen.
Charakterisierung mündlicher Leistungen: Dieses Kapitel charakterisiert mündliche Leistungen und grenzt sie von schriftlichen Leistungen ab. Es analysiert die verschiedenen Formen mündlicher Leistungen und die damit verbundenen Besonderheiten bezüglich der Bewertung.
Rahmenbedingungen der mündlichen Leistungsfeststellung: Hier werden die verschiedenen Rahmenbedingungen der mündlichen Leistungsfeststellung untersucht, darunter schulrechtliche, gesellschaftliche, psychologische und pädagogisch-didaktische Aspekte. Es wird der Ist-Zustand in der Praxis beleuchtet und kritisch bewertet.
Der Beurteilungsprozess mündlicher Leistungen: Dieses Kapitel beschreibt den Beurteilungsprozess mündlicher Leistungen im Detail. Es behandelt die Aspekte des Beobachtens und Wahrnehmens, die Gütekriterien der Leistungsmessung (Objektivität, Reliabilität und Validität) sowie verschiedene Methoden der Leistungsdokumentation und -bewertung. Verschiedene Bezugsnormen werden diskutiert.
Herausforderungen bei der Beurteilung mündlicher Leistungen: Das Kapitel analysiert die Herausforderungen und Probleme, die bei der Beurteilung mündlicher Leistungen auftreten können, wie z.B. Beurteilungsfehler. Es setzt sich kritisch mit den Schwierigkeiten auseinander, die sich aus der Subjektivität des Bewertungsprozesses ergeben.
Mögliche Vorteile der mündlichen Leistungsfeststellung: Dieses Kapitel beleuchtet die positiven Aspekte der mündlichen Leistungsfeststellung und zeigt die Potenziale auf, die in dieser Form der Leistungsüberprüfung liegen. Es hebt den Nutzen von mündlichen Prüfungen für Schüler und Lehrer hervor.
Schlüsselwörter
Mündliche Leistungen, Leistungsbeurteilung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, Beurteilungsfehler, Schulrecht, Pädagogische Diagnostik, Prüfungsdesign, Feedback, Bezugsnormen.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Beurteilung mündlicher Leistungen im schulischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Beurteilung mündlicher Leistungen im schulischen Kontext. Sie untersucht Möglichkeiten und Grenzen dieser Beurteilungsform und entwickelt Handlungsempfehlungen für eine gütegerechte Bewertung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Leistungsbegriff im Zusammenhang mit mündlichen Leistungen, die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Beurteilung, die Gütekriterien der Leistungsmessung (Objektivität, Reliabilität, Validität), Methoden der Leistungsdokumentation und -bewertung sowie Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten der mündlichen Leistungsfeststellung. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, von schulrechtlichen Bestimmungen bis hin zu pädagogisch-didaktischen Überlegungen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Leistungsprinzip im schulischen Kontext, Charakterisierung mündlicher Leistungen, Rahmenbedingungen der mündlichen Leistungsfeststellung, Der Beurteilungsprozess mündlicher Leistungen, Herausforderungen bei der Beurteilung mündlicher Leistungen, Mögliche Vorteile der mündlichen Leistungsfeststellung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Wie wird der Leistungsbegriff definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff „Leistung“ im schulischen Kontext und beschreibt die spezifischen Merkmale der Leistungserbringung, insbesondere im Vergleich zu schriftlichen Leistungen. Es wird das Leistungsprinzip und seine Bedeutung für die Bewertung von Schülerleistungen beleuchtet.
Welche Gütekriterien der Leistungsmessung werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die zentralen Gütekriterien der Leistungsmessung: Objektivität, Reliabilität und Validität. Es wird untersucht, wie diese Kriterien im Kontext mündlicher Prüfungen angewendet und sichergestellt werden können.
Welche Methoden der Leistungsdokumentation und -bewertung werden diskutiert?
Die Seminararbeit beleuchtet verschiedene Methoden der Leistungsdokumentation, einschließlich der Rolle des Lehrers als Beobachter und der Selbsteinschätzung durch den Schüler. Weiterhin werden unterschiedliche Bezugsnormen für die Leistungsbewertung diskutiert.
Welche Herausforderungen bei der Beurteilung mündlicher Leistungen werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert verschiedene Herausforderungen, wie z.B. Beurteilungsfehler, die sich aus der Subjektivität des Bewertungsprozesses ergeben können. Es wird kritisch auf Schwierigkeiten eingegangen, die eine objektive und faire Bewertung erschweren.
Welche Vorteile bietet die mündliche Leistungsfeststellung?
Die Arbeit hebt die positiven Aspekte und Potenziale der mündlichen Leistungsfeststellung hervor. Es werden die Vorteile für Schüler und Lehrer diskutiert und Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Seminararbeit entwickelt Handlungsempfehlungen für eine gütegerechte Beurteilung mündlicher Leistungen. Diese Empfehlungen beziehen sich auf die Gestaltung der Prüfungssituation, die Vorbereitung der Schüler, die Durchführung der Prüfung und die Beurteilung selbst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mündliche Leistungen, Leistungsbeurteilung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, Beurteilungsfehler, Schulrecht, Pädagogische Diagnostik, Prüfungsdesign, Feedback, Bezugsnormen.
- Quote paper
- Martina Hugo (Author), 2006, Möglichkeiten und Grenzen der Beurteilung mündlicher Leistungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63084