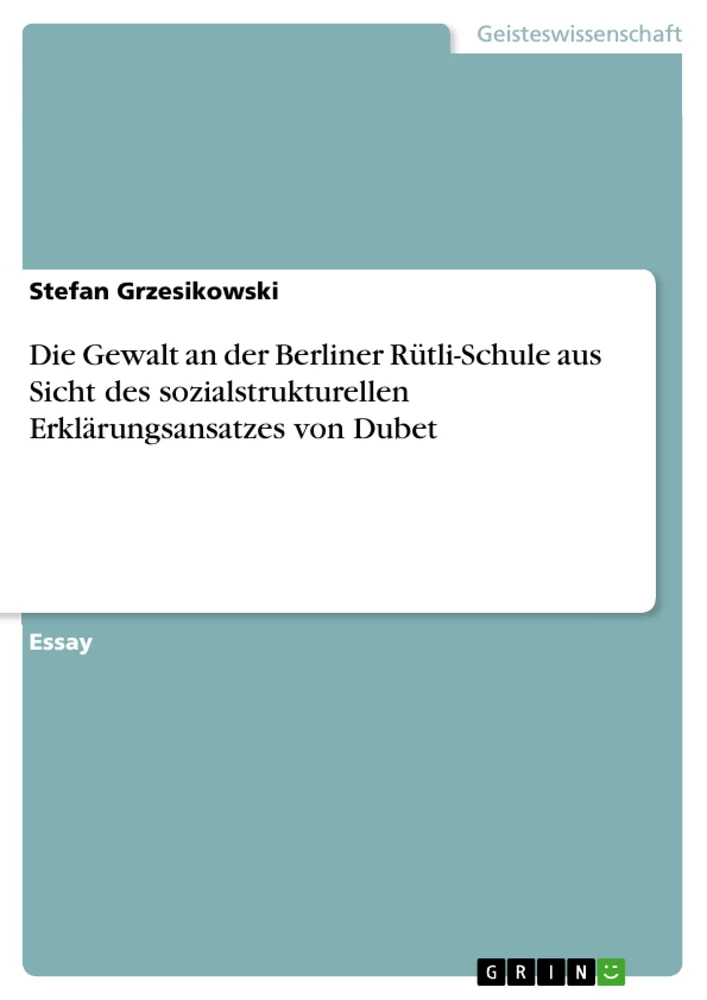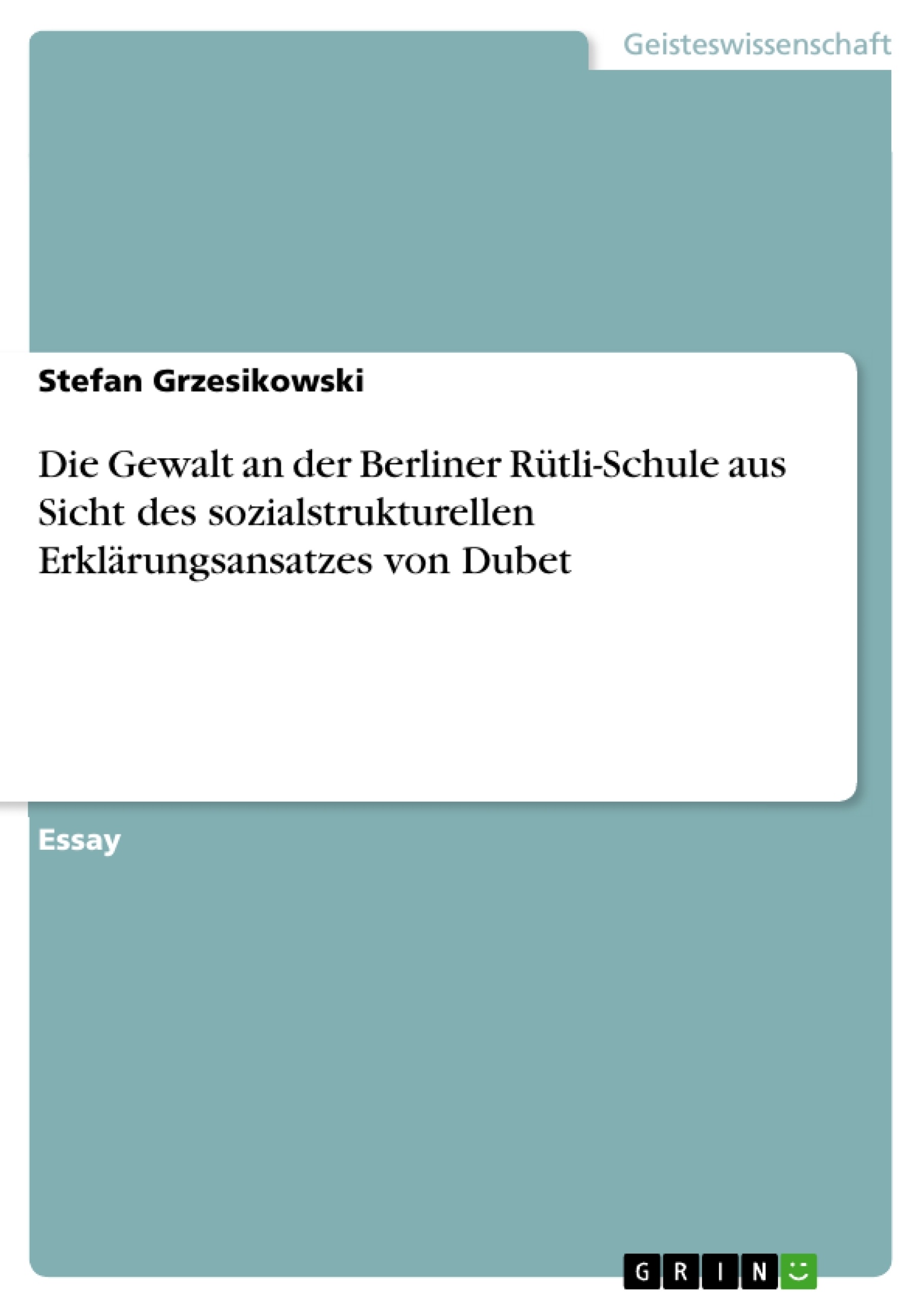Mit der vorliegenden Arbeit soll geprüft werden, inwiefern der sozialstrukturelle Erklärungsansatz von Dubet dabei helfen kann, die Gewalt an der Berliner Rütli-Schule zu erklären. Dabei wird darauf verzichtet, alle Zusammenhänge und Details des sehr umfangreichen Erklärungsansatzes wiederzugeben. Stattdessen beschränke ich mich auf solche Aspekte des Ansatzes von Dubet, die mir im Zusammenhang mit den Problemen an der Rütli-Schule als besonders wichtig erscheinen. Dies sind vor allem die Aussagen zur sozialen Kontrolle und zur tolerierten Abweichung, zur Bedeutung des sozialen und kulturellen Abstands zwischen Mittelschicht und Unterschicht für das Problem sowie das Paradoxon von Integration und Ausgrenzung. Wichtige Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Dubets Thesen zur Gewaltentstehung auf die Verhältnisse an der Berliner Rütli-Schule ist eine gemeinsame Basis für die Überlegungen. Gemeint ist damit eine zumindest annähernd übereinstimmende Gewaltdefinition. Da man Gewalt sehr unterschiedlich definieren kann, man kann sie zum Beispiel sehr eng auf körperliche Gewalt eingrenzen oder sie aber weiter definieren, indem man viele Formen abweichenden Verhaltens als Form von Gewalt einstuft, macht es wenig Sinn, Thesen zur Gewaltentstehung auf ein konkretes Beispiel anzuwenden, wenn die definitorische Grundlage der Theorie das praktische Beispiel gar nicht als Gewalt im eigentlichen Sinne versteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Bemerkungen
- 2. Anwendung des Erklärungsansatzes Dubets auf die Probleme der Rütli-Oberschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Dubets sozialstruktureller Erklärungsansatz die Gewalt an der Berliner Rütli-Schule erklären kann. Es wird auf eine umfassende Darstellung von Dubets Ansatz verzichtet und stattdessen auf ausgewählte Aspekte fokussiert, die für die Situation an der Rütli-Schule relevant erscheinen.
- Soziale Kontrolle und tolerierte Abweichung
- Sozialer und kultureller Abstand zwischen Mittelschicht und Unterschicht
- Paradoxon von Integration und Ausgrenzung
- Gewaltdefinition und deren Anwendung auf die Rütli-Schule
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, kulturellem Hintergrund und Gewalt an der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Bemerkungen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die Analyse der Gewalt an der Rütli-Schule durch die Linse von Dubets sozialstrukturellem Erklärungsansatz. Es wird betont, dass eine gemeinsame Verständnisgrundlage bezüglich der Definition von Gewalt unabdingbar ist. Die Arbeit beschränkt sich auf ausgewählte Aspekte von Dubets Theorie, insbesondere die soziale Kontrolle, tolerierte Abweichung, den sozialen und kulturellen Abstand zwischen den Schichten und das Paradoxon von Integration und Ausgrenzung. Die Definition von Gewalt nach Dubet wird vorgestellt, die den Bruch einer sozialen Ordnung als zentrales Merkmal hervorhebt. Der Bezug zu den Schilderungen der Lehrer der Rütli-Schule im Brief an die Berliner Senatsverwaltung wird hergestellt, um eine Übereinstimmung in der Gewaltdefinition zu belegen. Die mediale Berichterstattung wird aufgrund fehlender Eigenständigkeit der Recherche nicht berücksichtigt.
2. Anwendung des Erklärungsansatzes Dubets auf die Probleme der Rütli-Oberschule: Dieses Kapitel wendet Dubets Theorie auf die Situation an der Rütli-Schule an. Es wird der schwache Ausprägungsgrad der sozialen Kontrolle in der heterogenen und anonymen städtischen Umgebung Berlins herausgestellt im Gegensatz zu stark integrierten, konservativen Gesellschaften. Der Mangel an engen sozialen Netzwerken, die Anonymität und die kulturelle Diversität der Schülerschaft behindern die soziale Kontrolle und begünstigen Gewalt. Der fehlende Raum für tolerierte Abweichungen und die unterschiedliche Interpretation von Schülerverhalten durch die vorwiegend der Mittelschicht angehörigen Lehrer aufgrund des sozialen und kulturellen Abstands werden als weitere wichtige Faktoren hervorgehoben. Die schwierige soziale und wirtschaftliche Situation der Schüler und der große soziale Abstand zu den Lehrern tragen zum Missverständnis und zu Konflikten bei. Die schlechten Schulabschlüsse der Schüler und ihre ungewissen Zukunftsaussichten werden im Kontext der gesellschaftlichen Diskrepanz diskutiert. Die fehlende kulturelle Übereinstimmung zwischen Lehrern und Schülern verschärft die Situation zusätzlich.
Schlüsselwörter
Jugendgewalt, Rütli-Schule, sozialstruktureller Erklärungsansatz, Dubet, soziale Kontrolle, tolerierte Abweichung, sozialer und kultureller Abstand, Integration, Ausgrenzung, Migrationshintergrund, soziale Ungleichheit, Schichtunterschiede, Schulische Gewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Gewalt an der Rütli-Schule anhand des sozialstrukturellen Erklärungsansatzes von Dubet
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, inwieweit der sozialstrukturelle Erklärungsansatz von Dubet die Gewalt an der Berliner Rütli-Schule erklären kann. Der Fokus liegt auf ausgewählten Aspekten von Dubets Ansatz, die für die Situation an der Rütli-Schule relevant sind.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schwerpunkten: Soziale Kontrolle und tolerierte Abweichung; Sozialer und kultureller Abstand zwischen Mittelschicht und Unterschicht; Das Paradoxon von Integration und Ausgrenzung; Gewaltdefinition und deren Anwendung auf die Rütli-Schule; Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, kulturellem Hintergrund und Gewalt an der Schule.
Wie wird Dubets Ansatz auf die Rütli-Schule angewendet?
Das zweite Kapitel wendet Dubets Theorie auf die Rütli-Schule an. Es analysiert den schwachen Ausprägungsgrad der sozialen Kontrolle in der heterogenen Berliner Umgebung, den Mangel an engen sozialen Netzwerken, die Anonymität und die kulturelle Diversität der Schülerschaft. Weitere Faktoren sind der fehlende Raum für tolerierte Abweichungen, unterschiedliche Interpretationen von Schülerverhalten durch Lehrer aufgrund sozialen und kulturellen Abstands, die schwierige soziale und wirtschaftliche Situation der Schüler und die fehlende kulturelle Übereinstimmung zwischen Lehrern und Schülern.
Welche Rolle spielt die soziale Kontrolle?
Der schwache Ausprägungsgrad der sozialen Kontrolle in der heterogenen und anonymen städtischen Umgebung Berlins wird als entscheidender Faktor für die Gewalt an der Rütli-Schule hervorgehoben. Im Gegensatz zu stark integrierten, konservativen Gesellschaften fehlen enge soziale Netzwerke, was die soziale Kontrolle behindert und Gewalt begünstigt.
Welche Bedeutung hat der soziale und kulturelle Abstand zwischen Lehrern und Schülern?
Der große soziale und kulturelle Abstand zwischen den vorwiegend der Mittelschicht angehörenden Lehrern und den Schülern aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen führt zu Missverständnissen und Konflikten. Die unterschiedliche Interpretation von Schülerverhalten und die fehlende kulturelle Übereinstimmung verschärfen die Situation.
Wie definiert die Arbeit Gewalt?
Die Arbeit verwendet Dubets Gewaltdefinition, die den Bruch einer sozialen Ordnung als zentrales Merkmal hervorhebt. Es wird eine Übereinstimmung dieser Definition mit den Schilderungen der Lehrer der Rütli-Schule im Brief an die Berliner Senatsverwaltung hergestellt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Schilderungen der Lehrer der Rütli-Schule im Brief an die Berliner Senatsverwaltung. Die mediale Berichterstattung wird aufgrund fehlender Eigenständigkeit der Recherche nicht berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendgewalt, Rütli-Schule, sozialstruktureller Erklärungsansatz, Dubet, soziale Kontrolle, tolerierte Abweichung, sozialer und kultureller Abstand, Integration, Ausgrenzung, Migrationshintergrund, soziale Ungleichheit, Schichtunterschiede, Schulische Gewalt.
- Citar trabajo
- Stefan Grzesikowski (Autor), 2006, Die Gewalt an der Berliner Rütli-Schule aus Sicht des sozialstrukturellen Erklärungsansatzes von Dubet, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63147