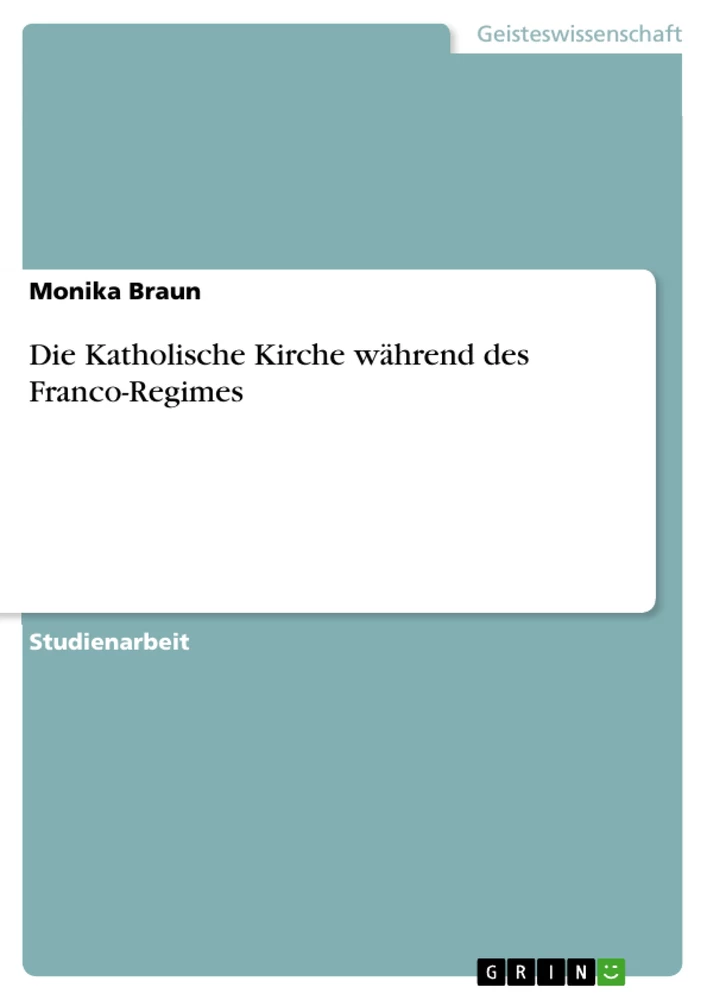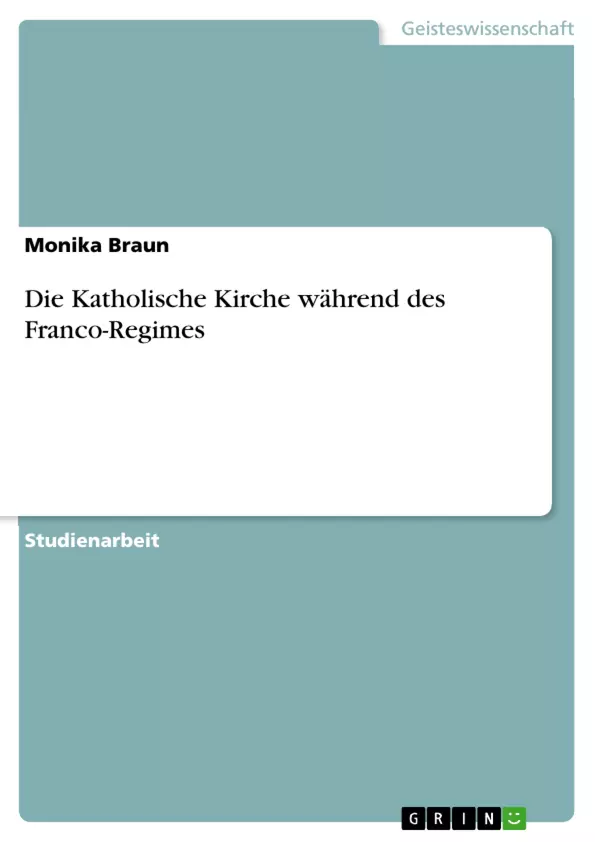Neben Italien ist Spanien wohl das Land in Europa, das auch heute noch am stärksten mit dem Katholizismus identifiziert wird. Die aktuellen Reaktionen in Spanien auf die Anerkennung der Ehe von gleichgeschlechtlichen Partnern, nämlich die Forderungen der Bischöfe an die Bürgermeister, „zivilen Ungehorsam“ zu leisten und die Eheschließungen dieser Paare zu verweigern, veranschaulicht, dass die spanische Katholische Kirche noch heute beansprucht, in Fragen von Moral und des rechten Menschenbilds Normen zu setzen und eine lautstarke Einflussnahme auf die spanische Gesellschaft auszuüben. Sind es heute nur noch Äußerungen appellativen Charakters, die die Kirche an die einzelnen Vertreter des Staates lanciert, so war die Verflechtung von Kirche und Staat im Franco-Regime auch institutionell verankert. Die Katholische Kirche gehörte zu den fundamentalen Stützen des neuen Regimes, welches ihr im Gegenzug ihre alten, in der Republik eingebüßten Privilegien zurückerstattete. Mit Hilfe dieser Machtinstrumente durchdrang die Katholische Kirche die verschiedenen Bereiche des sozialen Lebens. Doch welche Funktionen waren es genau, die die Kirche in jenem Regime, das oft als „klerikalfaschistische Herrschaftsform“ bezeichnet wird, einnahm? Welchergestalt war der Einfluss, den sie auf die Gesellschaft ausübte? Und welche Wirkung hatte dieser Einfluss im täglichen Leben? Diese Arbeit stellt den Versuch dar, die Rolle der Kirche im Franco-Regime zu skizzieren. Dabei lieferte die Darstellung von Walther L. Bernecker zur Religion in Spanien in der Fülle der Literatur zu diesem Thema eine grundlegende Orientierungshilfe. Im Rahmen einer im Wesentlichen chronologischen Darstellung der Entwicklung der Katholischen Kirche wird zunächst die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg beschrieben. Um die Kodifizierung des Verhältnisses von Staat und Kirche zu erklären, folgt eine Beschreibung des Konkordats und seiner konkreten Auswirkung in Spanien. Dabei muss darauf verzichtet werden, die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem franquistischen Regime genauer zu erläutern. In den folgenden drei Kapiteln wird die Einflussnahme der Kirche auf die Gesellschaft beleuchtet. Im Einzelnen interessieren uns dabei vier Bereiche: Die Sexualrepression durch die Kirche, das von ihr propagierte Frauenbild, ihre Beziehungen mit der Arbeiterschaft und der Einfluss einer kirchlichen Organisation, des Opus Dei, speziell auf die Wirtschaft. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg: der Nationalkatholizismus
- Das Konkordat von 1953
- Kirche und Sexualität
- Die Kirche und ihr Frauenbild
- Kirche und Arbeiterschaft
- Das Opus Dei
- Die Distanzierung der Kirche vom Staat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Katholischen Kirche während des Franco-Regimes in Spanien. Ziel ist es, die Funktionen der Kirche im Regime, ihren Einfluss auf die Gesellschaft und die Auswirkungen dieses Einflusses auf das tägliche Leben zu skizzieren. Die Arbeit konzentriert sich auf eine im Wesentlichen chronologische Darstellung.
- Die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg und der Aufstieg des Nationalkatholizismus
- Der Einfluss der Kirche auf Moral und gesellschaftliche Normen
- Die Beziehung zwischen Kirche und Staat, insbesondere das Konkordat von 1953
- Der Einfluss der Kirche auf verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens (Sexualität, Frauenbild, Arbeiterschaft)
- Die zunehmende Distanzierung der Kirche vom Staat ab den 1960er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle der Katholischen Kirche im Franco-Regime dar und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie verortet die Untersuchung im Kontext der starken Identifikation Spaniens mit dem Katholizismus und verweist auf aktuelle Beispiele für den anhaltenden Einfluss der Kirche auf die spanische Gesellschaft. Die Einleitung betont die institutionelle Verflechtung von Kirche und Staat während des Franco-Regimes und kündigt die chronologische Struktur der Arbeit an, die von der Nachkriegszeit bis zur Distanzierung der Kirche vom Staat reicht.
Die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg: der Nationalkatholizismus: Dieses Kapitel beschreibt die enge Beziehung zwischen der Kirche und dem Franco-Regime nach dem Bürgerkrieg. Die Kirche unterstützte den Aufstand und erwartete im Gegenzug die Wiederherstellung ihrer Privilegien. Trotz anfänglicher Konkurrenz mit der Falange bestand eine ideologische Übereinstimmung zwischen Kirche und Staat, die auf der Vorstellung einer Einheit von Katholizismus und Hispanismus beruhte. Der "Nationalkatholizismus" wird als komplexes Phänomen beschrieben, das Religionsfreiheit und Weltlichkeit ausschloss und Franco als Retter von Glauben und Nation darstellte. Die Kirche erhielt ihre verlorenen Privilegien zurück, der Katholizismus wurde zur Staatsreligion erklärt, und es folgte eine zunehmende Durchdringung verschiedener Bereiche des sozialen Lebens durch die Kirche.
Häufig gestellte Fragen: Rolle der Katholischen Kirche im Franco-Regime
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Katholischen Kirche während des Franco-Regimes in Spanien. Sie beleuchtet die Funktionen der Kirche im Regime, ihren Einfluss auf die Gesellschaft und die Auswirkungen dieses Einflusses auf das tägliche Leben der Spanier.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themenschwerpunkte, darunter die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg und der Aufstieg des Nationalkatholizismus, den Einfluss der Kirche auf Moral und gesellschaftliche Normen, die Beziehung zwischen Kirche und Staat (insbesondere das Konkordat von 1953), den Einfluss der Kirche auf Bereiche wie Sexualität, Frauenbild und Arbeiterschaft, sowie die zunehmende Distanzierung der Kirche vom Staat ab den 1960er Jahren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer im Wesentlichen chronologischen Struktur. Sie beginnt mit der Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg und endet mit der zunehmenden Distanzierung der Kirche vom Staat. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit den jeweiligen Aspekten der Kirchenrolle im Franco-Regime.
Was ist der Nationalkatholizismus?
Der Nationalkatholizismus wird als komplexes Phänomen beschrieben, das die enge Verflechtung von Kirche und Staat während des Franco-Regimes charakterisiert. Religionsfreiheit und Weltlichkeit wurden ausgeschlossen, und Franco wurde als Retter von Glauben und Nation dargestellt. Diese Ideologie führte zu einer umfassenden Durchdringung verschiedener Bereiche des sozialen Lebens durch die Kirche.
Welche Rolle spielte das Konkordat von 1953?
Das Konkordat von 1953 war ein wichtiger Bestandteil der Beziehung zwischen Kirche und Staat während des Franco-Regimes. Es wird in der Arbeit detailliert untersucht und seine Bedeutung für den Einfluss der Kirche auf die spanische Gesellschaft beleuchtet.
Wie beschreibt die Arbeit den Einfluss der Kirche auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Kirche auf verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wie beispielsweise die Sexualität, das Frauenbild und die Arbeiterschaft. Sie untersucht, wie die Kirche diese Bereiche prägte und welche Auswirkungen dies auf die Bevölkerung hatte.
Wie lässt sich die Entwicklung der Beziehung zwischen Kirche und Staat zusammenfassen?
Die Arbeit beschreibt eine anfänglich enge Beziehung zwischen Kirche und Staat, die sich im Laufe der Zeit, insbesondere ab den 1960er Jahren, zunehmend distanzierte. Die Gründe für diese Entwicklung werden in der Arbeit analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Die Situation der Kirche nach dem Bürgerkrieg: der Nationalkatholizismus, Das Konkordat von 1953, Kirche und Sexualität, Die Kirche und ihr Frauenbild, Kirche und Arbeiterschaft, Das Opus Dei, Die Distanzierung der Kirche vom Staat, Fazit.
- Quote paper
- Monika Braun (Author), 2005, Die Katholische Kirche während des Franco-Regimes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63225