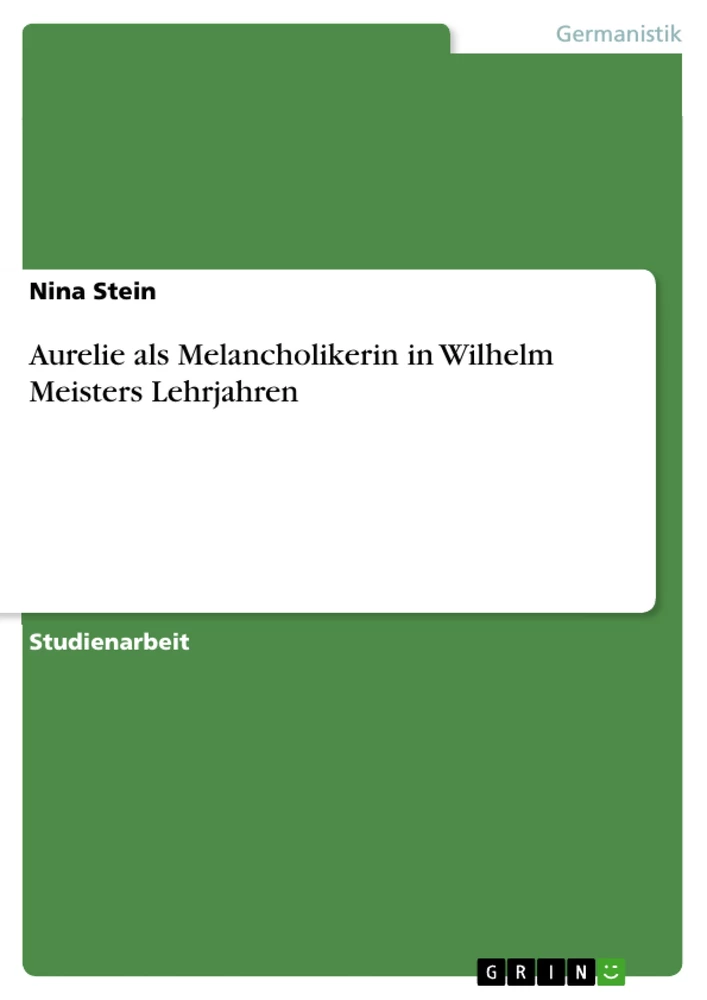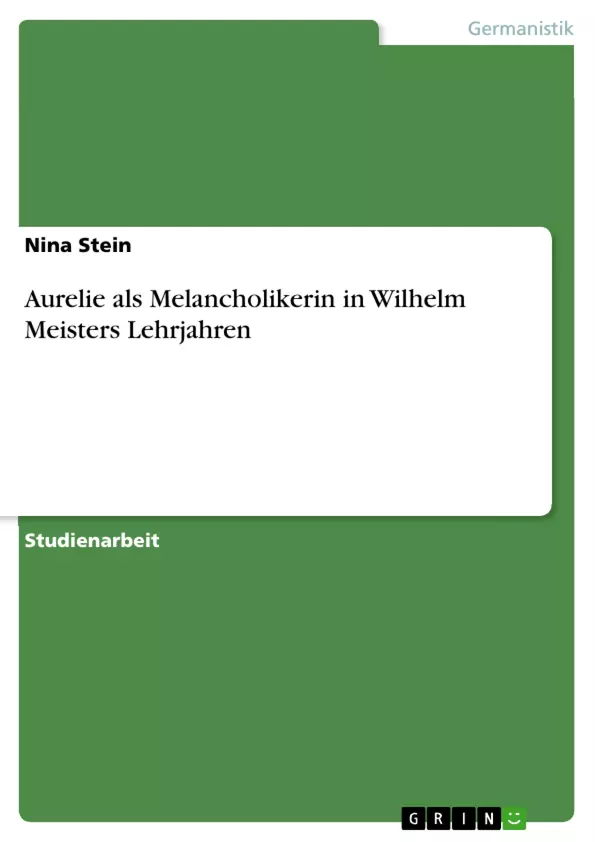Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Melancholie Aurelies. Diese Figur, die durchaus das vierte und fünfte Buch der ‚Lehrjahre’ prägt, ist in der Forschung bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Ingrid Ladendorf macht treffende Beobachtungen, verwendet jedoch an keiner Stelle den Melancholiebegriff, der für die Interpretation Aurelies unumgänglich ist.3 Anders verfährt Monika Fick, die zwar hauptsächlich die Beziehungen Aurelies zu Lothario und Wilhelm untersucht, dabei jedoch auf die Krankheit Aurelies zurückgreift.4 Thorsten Valk5 und Franziska Schößler6 weisen nachdrücklich auf die Wichtigkeit der Melancholie und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Aurelie hin. Wie äußert sich die Melancholie Aurelies? Welche Faktoren tragen zur Linderung oder Forcierung bei? Wie ist Aurelies Scheitern trotz Therapieversuchen zu bewerten? Um diese Fragen zu beantworten, wird zu Beginn der Arbeit Aurelies Auftreten untersucht, an Hand dessen erste auffällige Melancholieverweise sichtbar werden. Ebenso soll der Auslöser ihrer Krankheit sowie deren Auswirkungen beleuchtet werden. Im Folgenden widmet sich die Arbeit Aurelies Liebeswunde und Todessehnsucht. Die Folgen der Beziehung zu Lothario und die nicht erwiderte Liebe sollen hierbei in Hinblick auf ihre Melancholie untersucht werden. Außerdem wird die Todessehnsucht als Krankheitssymptom des Melancholikers im Vergleich mit literarischen Leidensgenossen herausgestellt. Aurelies Schauspiel und insbesondere die Verkörperung Ophelias und Orsinas geben im zweiten Kapitel Aufschluss über ihr Selbstverständnis. Die Wirkung der Identifikation mit den von ihr gespielten Charakteren hinsichtlich ihrer Krankheit soll aufgezeigt und interpretiert werden. Das letzte Kapitel befasst sich mit den Therapieversuchen. Es stellt sich die Frage, inwieweit Wilhelm als Freund und Vertrauter Einfluss auf den Krankheitsverlauf Aurelies nehmen kann. Abschließend wird die vom Arzt empfohlene Bibliotherapie im Zusammenhang mit ihrem Tod diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Melancholietradition und Melancholie in ,Wilhelm Meisters Lehrjahren'
- Aurelie als Melancholikerin
- Das Leiden Aurelies
- Auftreten Aurelies und Auslöser der Melancholie
- Liebeswunde und Todessehnsucht
- Identifikation mit dem Theater
- Ophelia
- Orsina
- Scheiternde Therapieversuche
- Wilhelms Freundschaft
- Bibliotherapie
- Versöhnlicher Abschied aus den ,Lehrjahren'
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Melancholie Aurelies in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Sie befasst sich mit der Frage, wie sich Aurelies Melancholie äußert, welche Faktoren ihre Krankheit verstärken oder lindern und welche Therapieversuche scheitern.
- Analyse von Aurelies Auftreten und Symptomen
- Untersuchung der Auslöser ihrer Melancholie, insbesondere der unglücklichen Liebe zu Lothario
- Bedeutung der Todessehnsucht als Krankheitssymptom
- Aurelies Identifikation mit den von ihr gespielten Figuren Ophelia und Orsina
- Analyse der Therapieversuche durch Wilhelms Freundschaft und die vom Arzt empfohlene Bibliotherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Melancholie Aurelies in „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und stellt die Figur im Kontext der Melancholietradition vor. Es werden die wichtigsten Aspekte der antiken und mittelalterlichen Melancholieauffassung sowie die Bedeutung des Melancholiekults im 18. Jahrhundert beleuchtet.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Leiden Aurelies. Es wird ihr Auftreten im Werk analysiert und der Auslöser ihrer Melancholie untersucht. Die Beziehung zu Lothario und die damit verbundene Liebeswunde sowie die Todessehnsucht werden in Hinblick auf ihre Krankheit beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich Aurelies Identifikation mit den Figuren Ophelia und Orsina. Es wird untersucht, wie ihre Verkörperung dieser Charaktere auf ihr Selbstverständnis und ihre Krankheit wirkt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Therapieversuchen, die Aurelie unternimmt. Es wird analysiert, inwieweit Wilhelms Freundschaft und die empfohlene Bibliotherapie den Krankheitsverlauf beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Melancholie, Aurelie, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, Goethes „Lehrjahre“, Liebeswunde, Todessehnsucht, Identifikation mit dem Theater, Therapie, Freundschaft, Bibliotherapie.
- Quote paper
- Nina Stein (Author), 2006, Aurelie als Melancholikerin in Wilhelm Meisters Lehrjahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63316