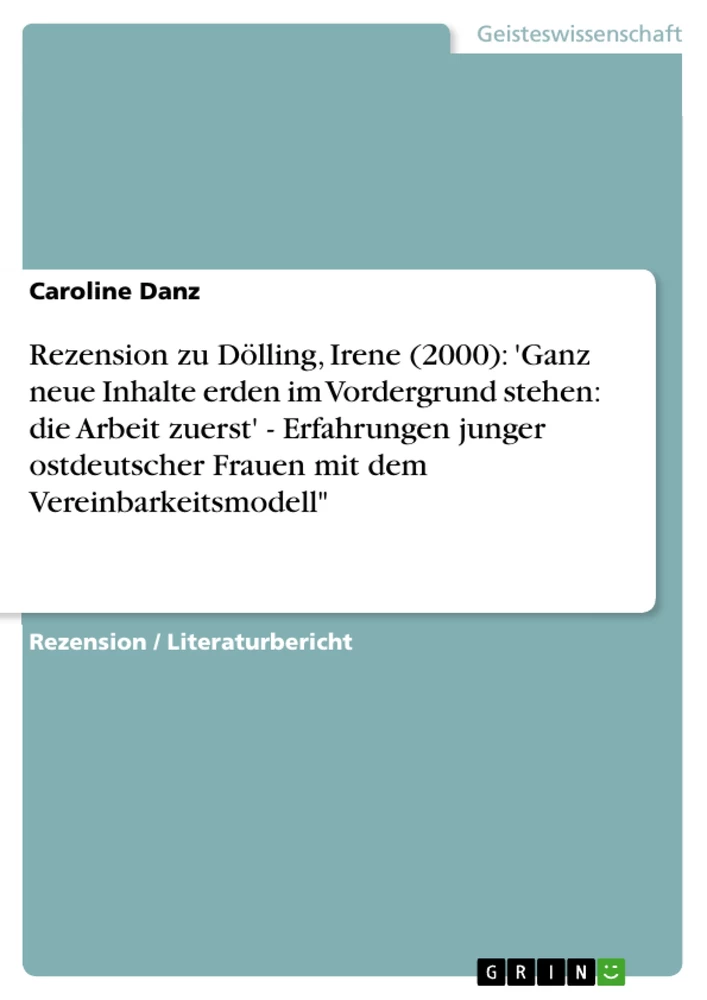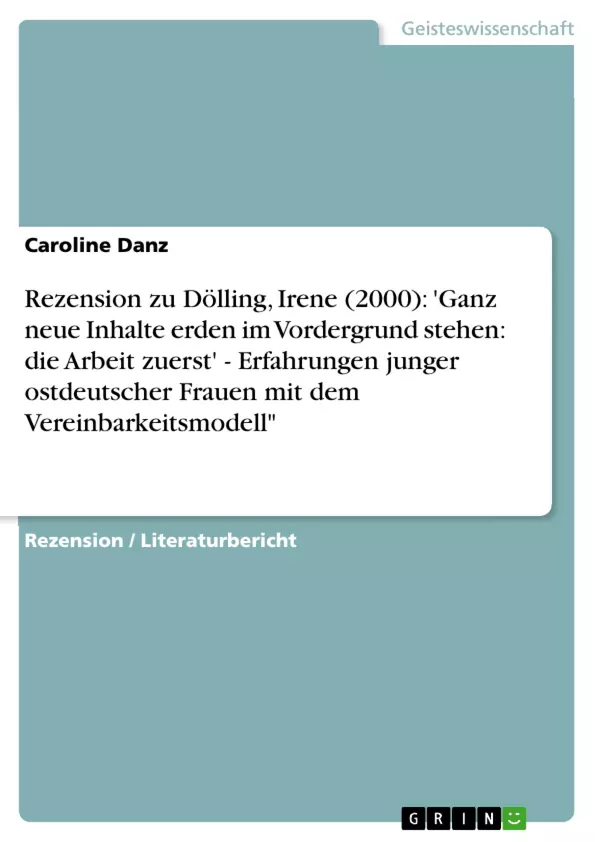Nicht einmal vier Prozent aller Top-Manager hierzulande sind Frauen. Zu den Gründen zählen nach einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins „Euro“ vor allem schlechte Rahmenbedingungen, wie etwa das Fehlen von Kindergärten, das 81 Prozent der Befragten beklagten. Wie kommt es zu solch einer Situation in der Berufssphäre in Deutschland? Sind es wirklich vor allem die Rahmenbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so erschweren, dass es zu dieser geringen Zahl kommt? Der Text "Ganz neue Inhalte werden im Vordergrund stehen: die Arbeit zuerst" von Irene Dölling könnte darüber Ausschluss geben.
Sie präsentiert hier eine Untersuchung, in der die Erfahrungen ostdeutscher Frauen mit dem Vereinbarkeitsmodell der DDR in der vereinigten Bundesrepublik dargestellt werden. Dazu stellten insgesamt 55 Frauen verschiedener Generationen der damaligen DDR ihre Tagebücher zur Verfügung. Durch die Analyse von Einzelgeschichten, die sich von 1990 bis 1997 erstreckte, konnte im späteren Verlauf auf soziokulturelle Zusammenhänge geschlossen werden.
In der DDR herrschte ein patriachalisch-paternalistisches Prinzip vor, das die Geschlechterkultur erheblich prägte. So war es in der deutschen demokratischen Republik eine Selbstverständlichkeit, dass der Großteil der Frauen arbeitete. Anders als die westdeutschen Frauen standen sie nicht vor der Alternative „Beruf oder Kinder“. Die ostdeutschen Frauen sind in Familien aufgewachsen, in denen es tendenziell gleichrangige Erwerbsarbeit beider Elternteile gab („Doppelverdienermodell“). So war das Bild der Frau in der DDR nicht festgelegt auf "Mütterlichkeit", sondern es konnten durchaus Attribute wie stark, selbstbewusst, berufstätig und ökonomisch unabhängig mit einfließen. Nach der Wende wurde die Hoffnung gehegt, diesen Gleichstellungsvorsprung ostdeutscher Frauen zu erhalten und diese Angleichungsprozesse vielleicht sogar auf den Westen übertragen zu können. Dölling stellt zuallererst dar, wie die Frauen in der von ihr geleiteten Untersuchung, nach der Wiedervereinigung einer Sozial- und Familienpolitik gegenüberstanden, die an der Norm des (modernisierten) Ernährer-Hausfrau-Modells orientiert ist. Die Autorin bezeichnet diese Situation als sogenannte "`Synchronisierung von Familien- und Berufsarbeit´ unter den Bedingungen einer strikten Trennung von `privater´ und `öffentlicher´ Sphäre“.
Inhaltsverzeichnis
- Die Erfahrungen junger ostdeutscher Frauen mit dem Vereinbarkeitsmodell (1990 - 1997)
- Einleitung: Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland
- Das Vereinbarkeitsmodell in der DDR
- Die Situation nach der Wiedervereinigung
- Der Stellenrang der Arbeit im Leben der Probanden
- Veränderungen im Frauenbild
- Der Einfluss der Wiedervereinigung auf die Geschlechterrollen
- Das Bild der eigenen Mutter
- Fazit: Die Re-Traditionalisierung von Geschlechterrollen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Irene Dölling untersucht die Erfahrungen ostdeutscher Frauen mit dem Vereinbarkeitsmodell in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung. Sie analysiert, wie die Frauen mit den veränderten soziokulturellen Rahmenbedingungen umgehen und welche Auswirkungen diese auf ihre Lebensentwürfe und Rollenbilder haben.
- Die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf das Vereinbarkeitsmodell in Ostdeutschland
- Der Einfluss der veränderten soziokulturellen Rahmenbedingungen auf die Lebensentwürfe von ostdeutschen Frauen
- Die Rolle der Arbeit im Leben der ostdeutschen Frauen nach der Wende
- Die Entwicklung des Frauenbildes und der Geschlechterrollen im Kontext der Wiedervereinigung
- Die Bedeutung der eigenen Mutter als Vorbild und Einflussfaktor auf die Lebensentwürfe der Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Studie von Irene Dölling zeigt, dass die ostdeutschen Frauen nach der Wiedervereinigung mit einer neuen Sozial- und Familienpolitik konfrontiert waren, die sich am (modernisierten) Ernährer-Hausfrau-Modell orientiert. Sie mussten sich mit bisher nicht vertrauten soziokulturellen Orientierungen über die Mutterschaft auseinandersetzen und die Rollen in der Familie neu aushandeln. Der Verlust soziopolitischer Rahmenbedingungen, wie z. B. das bezahlte Babyjahr, stellte eine weitere große Veränderung dar.
Die Untersuchung zeigt, dass die Arbeit für die ostdeutschen Frauen einen hohen Stellenrang im Leben einnahm. Die Frauen waren bestrebt, trotz der veränderten Bedingungen erwerbstätig zu bleiben oder wieder zu werden. Sie sahen die Arbeit als eine private Angelegenheit und waren nicht bereit, Hausfrau zu sein, auch nicht bei Langzeitarbeitslosigkeit.
Die Studie analysiert auch, wie sich die Wiedervereinigung auf das Bild der eigenen Mutter auswirkt. Die Frauen, die 1990 zwischen 35 und 40 Jahre alt waren, identifizierten sich positiv mit dem Leben ihrer Mütter, während die jüngeren Frauen eher Mitleid mit der beruflichen Situation ihrer Mütter empfanden und deren unterwürfige Position gegenüber den Männern kritisierten.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Beharren auf (Vollzeit) Erwerbsarbeit, die Ablehnung gegen die Segmentierung des Arbeitsmarktes und die weibliche Verantwortung für die Familienarbeit günstige Bedingungen für eine Re-Traditionalisierung von Geschlechterrollen darstellen.
Schlüsselwörter
Ostdeutsche Frauen, Vereinbarkeitsmodell, Wiedervereinigung, Geschlechterrollen, Frauenbild, Sozial- und Familienpolitik, Mutterschaft, Erwerbstätigkeit, Lebensentwurf, Re-Traditionalisierung.
- Citar trabajo
- Caroline Danz (Autor), 2005, Rezension zu Dölling, Irene (2000): 'Ganz neue Inhalte erden im Vordergrund stehen: die Arbeit zuerst' - Erfahrungen junger ostdeutscher Frauen mit dem Vereinbarkeitsmodell" , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63340