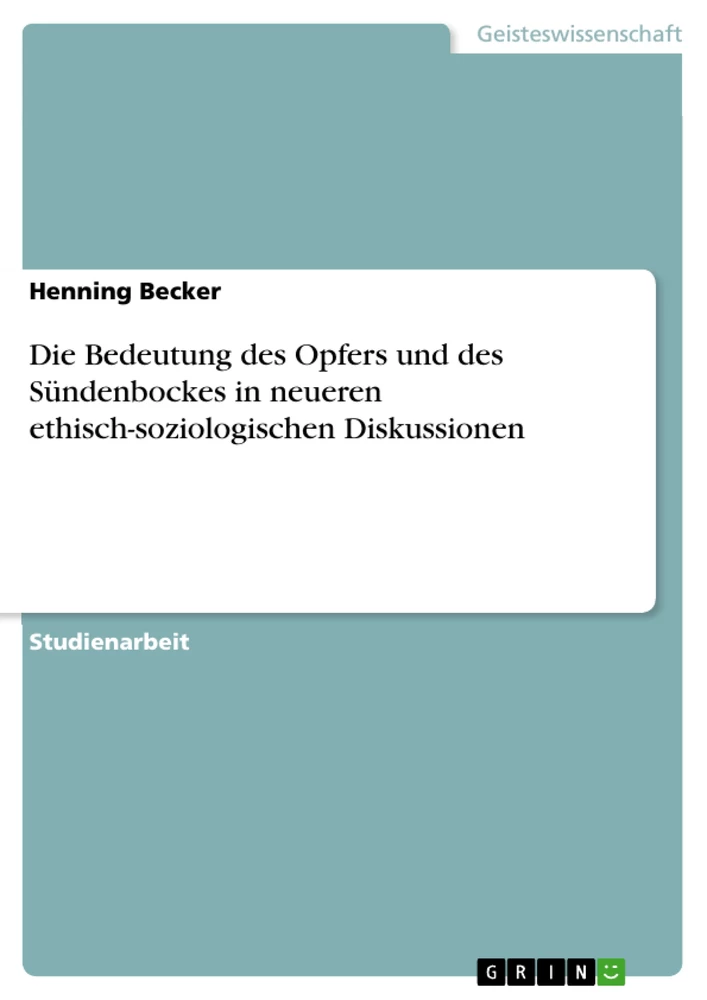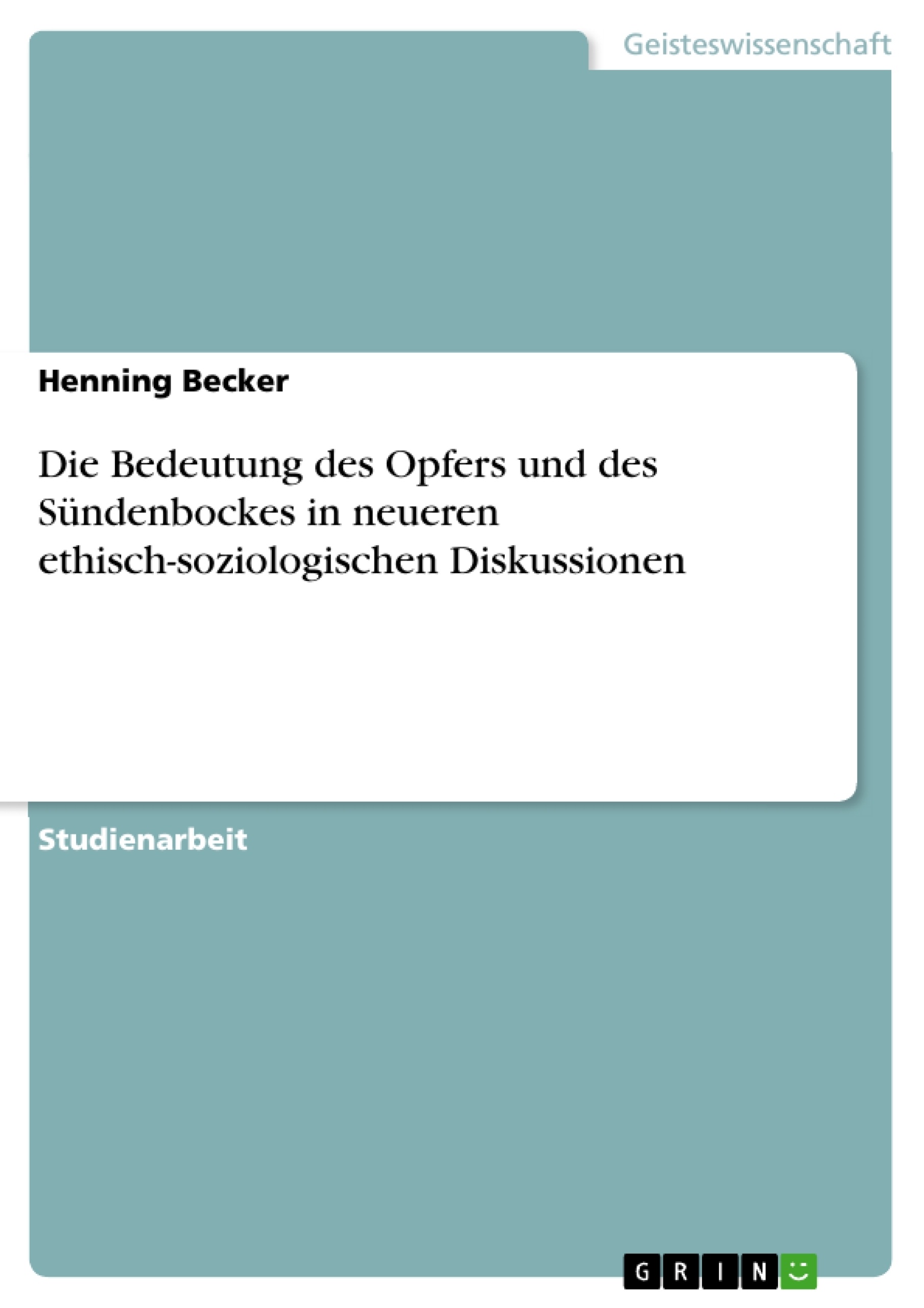Opfer ist ein Begriff, der in der heutigen Zeit überall bekannt ist und auch häufig – oft in sehr unterschiedlicher Absicht – verwendet wird. Doch was meint der Begriff des Opfers im Zusammenhang mit dem des Sündenbockes und dem von Gewalt?
Auf diese Frage geht u.a. der französische Kulturanthropologe René Girard in zahlreichen ethisch-philosophischen Werken ein. Seine Antwort lautet: Das Opfer ist der Schlüssel jeder menschlichen Gemeinschaft und zugleich der aus ihr hervorgehenden Gewalt. Erst ein ausgewähltes Opfer dient in der Funktion eines willkürlich geschaffenen Sündenbockes der Schaffung bzw. in Krisenzeiten der Wiederherstellung menschlicher Ordnung. Das Opfer im Sinne eines Sündenbockes ist also nach Girard ein künstliches Produkt der Menschen, das für ihre selbst verursachten Missstände herzuhalten hat.
Diese These ist innerhalb ethisch-philosophischer Ströme fraglos revolutionär. Und doch ist sie weder ganz neu noch unbegründet. Eine Disziplin, die sich ebenfalls mit der Problematik von gesellschaftlich Ausgestoßenen beschäftigt, ist die Soziologie. Sie versucht in diesem Zusammenhang vor allem die vielfach diskutierte Entstehung von Randgruppen als Opfer und Sündenböcke gesellschaftlich zu erklären.
Kernaussage dieser Arbeit ist, dass die Opfertheorie des Kulturanthropologen Girard mit der Randgruppenerklärung der Soziologie eng verwandt ist und sich beide Ansätze wechselseitig begründen – und das wahrscheinlich, ohne dass sie gegenseitig allzu viel voneinander wahrgenommen haben, sondern eher eigenständig erarbeitet worden sind. Beiden Gedankenführungen ist daher auch höchste Aktualität zu bescheinigen.
Um die Analogie und Brisanz beider Theorien zu vermitteln, muss zunächst der Ansatz Girards vom Opfer und Sündenbock erläutert werden. Anschließend ist unter soziologischen Gesichtspunkten auf die Randgruppenproblematik einzugehen. Hierbei soll an möglichst vielen Stellen bereits eine Brücke zu Girard geschlagen werden, um die Ausgewogenheit beider Argumentationswege näher zu beleuchten. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, abschließend auf Opfer- und Sündenbocktheorien einzugehen, weder auf die von Girard noch die aus der Soziologie. Vielmehr geht es darum, einzelne besonders interessante Aspekte vergleichend zu erarbeiten. Durch die Betrachtung zweier verschiedener Ansätze sollte ein erster Einblick in mögliche und begründete Erklärungsmuster für Opfer als Sündenböcke geboten werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Opfer- und Sündenbocktheorie bei René Girard
- 2.1 Das biblisch-rituelle Opfer
- 2.2 Mimesis
- 2.3 Opfer und Sündenböcke in der heutigen Gesellschaft
- 3 Soziologische Ansätze für Randgruppen als Opfer
- 3.1 Randgruppen
- 3.2 Abweichendes Verhalten
- 3.3 Labeling Approach
- 3.4 Stigmatisierung und Diskriminierung
- 4 Opfer und Randgruppen - ein Kurzvergleich
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Opfer und Sündenbock in neueren ethisch-soziologischen Diskussionen. Sie vergleicht die Opfertheorie von René Girard mit soziologischen Ansätzen zur Erklärung von Randgruppen als Opfer und Sündenböcke. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und die wechselseitige Begründung beider Perspektiven aufzuzeigen und ihre Aktualität zu belegen.
- Die Opfer- und Sündenbocktheorie nach René Girard
- Soziologische Erklärungsansätze für Randgruppen als Opfer
- Der Vergleich beider Theorien und ihre Gemeinsamkeiten
- Die Bedeutung des biblisch-rituellen Opfers
- Die Aktualität der Theorien im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des Opferbegriffs im Zusammenhang mit Sündenböcken und Gewalt. Sie führt den Ansatz von René Girard ein, der das Opfer als Schlüssel jeder menschlichen Gemeinschaft und zugleich als Quelle der Gewalt sieht. Der Sündenbock wird als künstliches Produkt der Gesellschaft dargestellt, das für selbst verursachte Missstände herhalten muss. Die Arbeit kündigt einen Vergleich dieser These mit soziologischen Erklärungsansätzen für Randgruppen als Opfer an und betont die Aktualität beider Perspektiven.
2 Die Opfer- und Sündenbocktheorie bei René Girard: Dieses Kapitel erläutert Girards Theorie anhand des biblisch-rituellen Opfers. Girard sieht im Opfer einen Vermittler zu Gott und ein stellvertretendes Wesen, das für die Sünden anderer büßt. Er argumentiert, dass das rituelle Opfer in Krisenzeiten der Versöhnung mit Gott und der Überwindung von Gewalt diente. Das Kapitel betont die Bedeutung des Opfers als künstliches Produkt, das für die Krisen der Gesellschaft herhalten muss, und legt den Grundstein für den Vergleich mit soziologischen Ansätzen.
3 Soziologische Ansätze für Randgruppen als Opfer: Dieses Kapitel untersucht soziologische Erklärungsansätze für die Entstehung von Randgruppen als Opfer und Sündenböcke. Es beleuchtet verschiedene Perspektiven, die das Phänomen der Ausgrenzung und Stigmatisierung sozialer Gruppen erklären. Der „Labeling Approach“ und die Konzepte von abweichendem Verhalten werden hier wahrscheinlich diskutiert. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde die verschiedenen soziologischen Perspektiven integrieren und ihre Relevanz für das Verständnis von Randgruppen als Opfer hervorheben.
4 Opfer und Randgruppen - ein Kurzvergleich: Dieses Kapitel stellt einen vergleichenden Überblick der vorherigen Kapitel dar. Es zieht Parallelen zwischen Girards Theorie und den soziologischen Ansätzen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die Zusammenfassung würde die konvergierenden und divergierenden Argumente der beiden Perspektiven aufzeigen und die Stärke einer integrierten Betrachtungsweise betonen. Es werden wahrscheinlich Gemeinsamkeiten in der Erklärung von Gewalt und sozialen Mechanismen der Ausgrenzung herausgestellt.
Schlüsselwörter
Opfer, Sündenbock, René Girard, Soziologie, Randgruppen, Gewalt, Mimesis, biblisch-rituelles Opfer, gesellschaftliche Ordnung, Stigmatisierung, Diskriminierung, Abweichendes Verhalten, Labeling Approach.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Opfer und Sündenböcke in ethisch-soziologischen Diskussionen
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Opfer und Sündenbock in neueren ethisch-soziologischen Diskussionen. Sie vergleicht die Opfertheorie von René Girard mit soziologischen Ansätzen zur Erklärung von Randgruppen als Opfer und Sündenböcke, um Gemeinsamkeiten und die wechselseitige Begründung beider Perspektiven aufzuzeigen und deren Aktualität zu belegen.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Opfer- und Sündenbocktheorie von René Girard mit soziologischen Ansätzen, insbesondere dem Labeling Approach, zur Erklärung von Randgruppen als Opfer. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Perspektiven im Verständnis von Gewalt, Ausgrenzung und sozialen Mechanismen.
Welche Rolle spielt René Girard in dieser Arbeit?
René Girards Opfer- und Sündenbocktheorie bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit. Seine Theorie, insbesondere die Bedeutung des biblisch-rituellen Opfers und der Mimesis, wird detailliert erläutert und als Grundlage für den Vergleich mit soziologischen Ansätzen verwendet.
Welche soziologischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene soziologische Perspektiven zur Erklärung von Randgruppen als Opfer und Sündenböcke. Hierzu gehört unter anderem der "Labeling Approach", der die Bedeutung von Stigmatisierung und Diskriminierung für die Entstehung von Randgruppen beleuchtet. Konzepte von abweichendem Verhalten werden ebenfalls diskutiert.
Wie werden die Theorien verglichen?
Die Arbeit stellt einen vergleichenden Überblick der Girardschen Theorie und der soziologischen Ansätze dar. Sie zeigt Parallelen und Unterschiede auf, um die konvergierenden und divergierenden Argumente beider Perspektiven herauszuarbeiten und die Stärke einer integrierten Betrachtungsweise zu betonen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Opfer, Sündenbock, René Girard, Soziologie, Randgruppen, Gewalt, Mimesis, biblisch-rituelles Opfer, gesellschaftliche Ordnung, Stigmatisierung, Diskriminierung, abweichendes Verhalten und Labeling Approach.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Girards Theorie, ein Kapitel zu soziologischen Ansätzen, einen Vergleich beider Perspektiven und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Opfer- und Sündenbockthematik.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung der Arbeit wird die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Girards Theorie und den soziologischen Ansätzen zusammenfassen und die Bedeutung beider Perspektiven für das Verständnis von Opferprozessen und sozialen Mechanismen der Ausgrenzung hervorheben. Sie wird wahrscheinlich die Aktualität der Theorien im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen betonen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich für ethisch-soziologische Fragestellungen, die Opfer- und Sündenbockthematik, sowie die Theorien von René Girard interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Soziologie, Ethik und verwandter Disziplinen von Interesse.
- Arbeit zitieren
- Henning Becker (Autor:in), 2006, Die Bedeutung des Opfers und des Sündenbockes in neueren ethisch-soziologischen Diskussionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63380