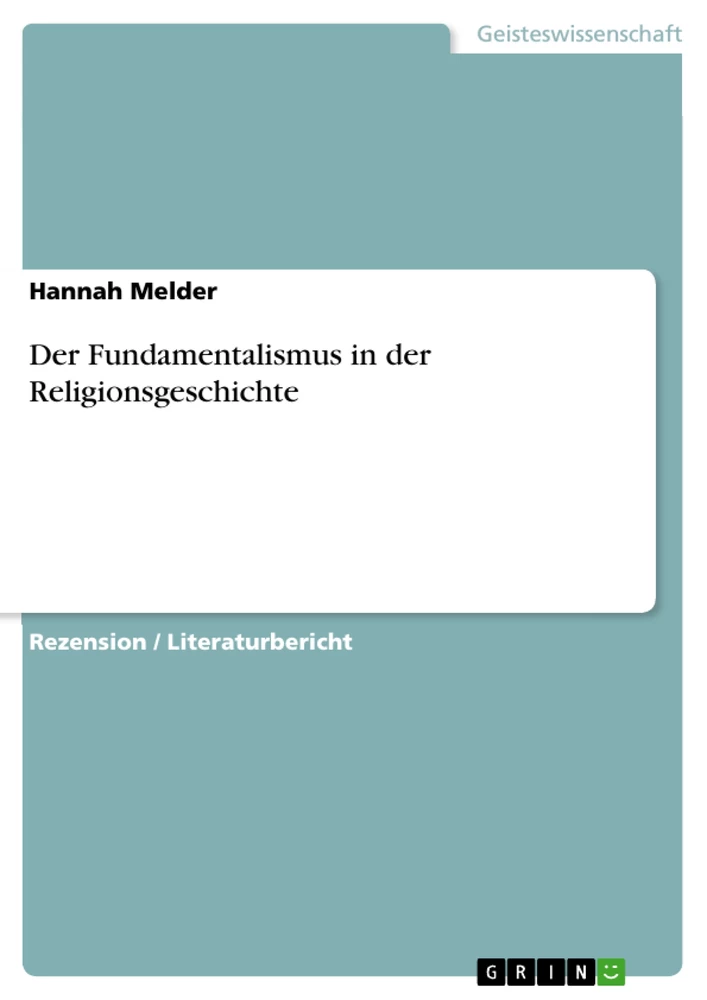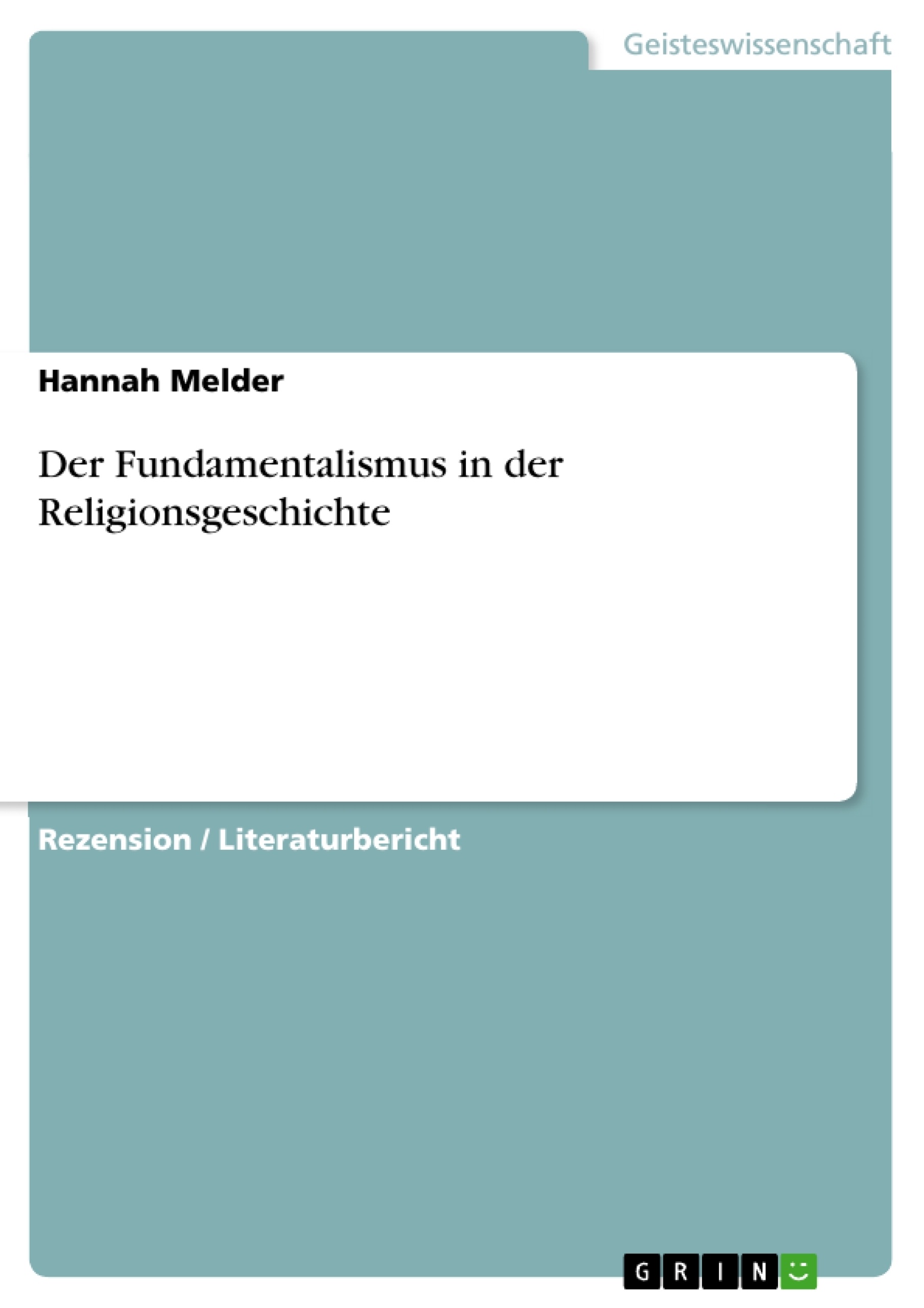Das Phänomen des Fundamentalismus: Omnipräsent und doch scheinbar schwer erklärbar. Was bewegt Menschen dazu, sich fundamentalistischen Gruppierungen anzuschließen und sogar soweit zu gehen, ihr Leben für deren Ideale und Vorstellungen zu opfern? Manche Experten suchen die Gründe hierfür in der Politik, andere in der Gesellschaft und einige in der Religion.
Gernot Wießner vertritt in seiner Abhandlung „Der Fundamentalismus in der Religionsgeschichte“ die These, dass der Fundamentalismus dem Wesen der Religion entspricht und einen bestimmten Typ von Religion darstellt. Er ist der Ansicht, dass die Gründe für das Aufkeimen des Fundamentalismus lediglich in der Religion zu suchen seien. Wießner folgt in seiner Argumentation der Methode des Essentialismus, das heißt, er erforscht das Phänomen des Fundamentalismus durch den Blick auf dessen Entwicklungsgeschichte.
Der Autor gliedert seinen Text hierbei in vier Teile, welche im Folgenden zusammengefasst werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Der religiöse Wahrheitsbegriff
- Die Enttabuisierung menschlichen Lebens
- Die Radikalität des Gottesglaubens
- Die religionsgeschichtliche Verortung des Fundamentalismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Gernot Wießners Argumentation in "Der Fundamentalismus in der Religionsgeschichte", die besagt, dass Fundamentalismus im Wesentlichen der Natur von Religion entspricht. Er untersucht die Bedeutung des religiösen Wahrheitsbegriffs, die Enttabuisierung menschlichen Lebens und die Radikalität des Gottesglaubens in fundamentalistischen Strömungen.
- Die Rolle des religiösen Wahrheitsbegriffs im Fundamentalismus
- Die Beziehung zwischen Fundamentalismus und der Enttabuisierung menschlichen Lebens
- Die Rolle des Gottesbildes in der Begründung der Gewaltbereitschaft von Fundamentalisten
- Die religionsgeschichtliche Einordnung des Fundamentalismus
- Kritik an Wießners Definition und Interpretation des Fundamentalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der religiöse Wahrheitsbegriff
Wießner stellt die absolute und zeitlose Natur der Offenbarung in den Vordergrund, auf der alle Religionen basieren. Die menschliche Vernunft dient dabei lediglich dem Verständnis, nicht der kritischen Überprüfung der Offenbarung. Der Fundamentalist sieht sich im Besitz der ewigen Wahrheit und lehnt Kompromisse mit Andersdenkenden ab, die die Wahrheit nicht in der Offenbarung, sondern im Diskurs der Vernunft suchen.
Die Enttabuisierung menschlichen Lebens
Die Teilung der Welt in Gut und Böse, die sich aus der absoluten Gültigkeit der Offenbarung ergibt, führt nach Wießners Argumentation zur Enttabuisierung menschlichen Lebens. Diejenigen, die die Wahrheit der Offenbarung nicht akzeptieren, werden nicht nur psychisch abgelehnt, sondern auch physisch bekämpft.
Die Radikalität des Gottesglaubens
Wießner argumentiert, dass die letztendliche Rechtfertigung für die Tötung von Menschen im Gottesbild des Fundamentalisten liegt. Er verweist auf das 1. Makkabäerbuch, das den Menschen als Instrument Gottes im Kampf gegen das Böse darstellt. Die Enttabuisierung des Lebens wird somit zum Willen Gottes und der Mensch ist verpflichtet, diesen Willen zu erfüllen.
Die religionsgeschichtliche Verortung des Fundamentalismus
Wießner definiert den Fundamentalismus als eine Bewegung, die die Enttabuisierung menschlichen Lebens zur Durchsetzung einer Grundordnung unter den Menschen nach den Vorgaben einer autoritativen Offenbarung rechtfertigt. Dieser Typus des religiösen Fundamentalismus habe es in der Religionsgeschichte schon immer gegeben, der Autor widerlegt die verbreitete Ansicht, dass Fundamentalismus ein Phänomen der Moderne sei.
Schlüsselwörter
Dieser Essay beschäftigt sich mit dem Phänomen des Fundamentalismus, insbesondere mit seiner Beziehung zur Religion. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fundamentalismus, Religion, Offenbarung, Enttabuisierung menschlichen Lebens, Gottesbild, Religionsgeschichte, Gewaltbereitschaft, Wahrheit, Vernunft, Kompromiss.
Häufig gestellte Fragen zum religiösen Fundamentalismus
Was ist Gernot Wießners Hauptthese zum Fundamentalismus?
Wießner vertritt die Ansicht, dass der Fundamentalismus kein modernes Phänomen ist, sondern dem Wesen der Religion entspricht und einen bestimmten Typ von Religion darstellt.
Welche Rolle spielt der Wahrheitsbegriff im Fundamentalismus?
Fundamentalisten gehen von einer absoluten, zeitlosen Wahrheit aus, die auf einer göttlichen Offenbarung basiert und keiner kritischen Überprüfung durch die Vernunft bedarf.
Was meint Wießner mit der "Enttabuisierung menschlichen Lebens"?
Er beschreibt damit den Prozess, bei dem das Leben von "Ungläubigen" oder Andersdenkenden als weniger wertvoll angesehen wird, was die physische Bekämpfung oder Tötung religiös rechtfertigt.
Warum lehnen Fundamentalisten den Diskurs der Vernunft ab?
Da sie glauben, im Besitz der ewigen Wahrheit zu sein, betrachten sie Kompromisse oder rationale Hinterfragungen als Verrat an der göttlichen Offenbarung.
Wie begründen Fundamentalisten Gewaltbereitschaft?
Gewalt wird oft als Wille Gottes legitimiert, wobei der Mensch sich als Instrument im Kampf zwischen Gut und Böse sieht, um eine gottgegebene Ordnung durchzusetzen.
- Citation du texte
- Hannah Melder (Auteur), 2006, Der Fundamentalismus in der Religionsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63408