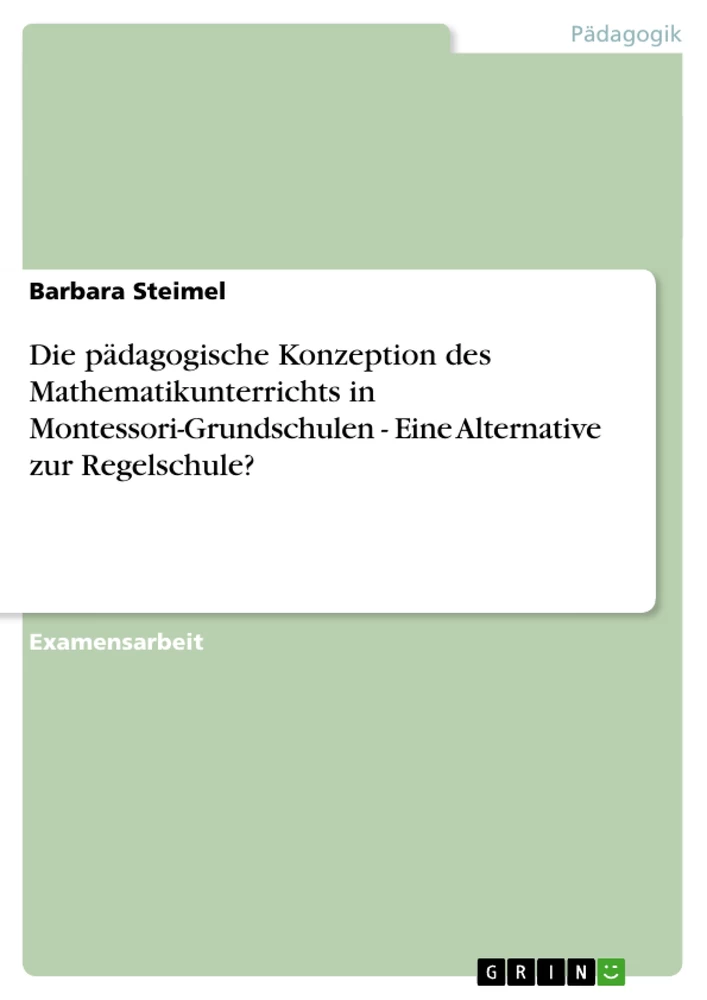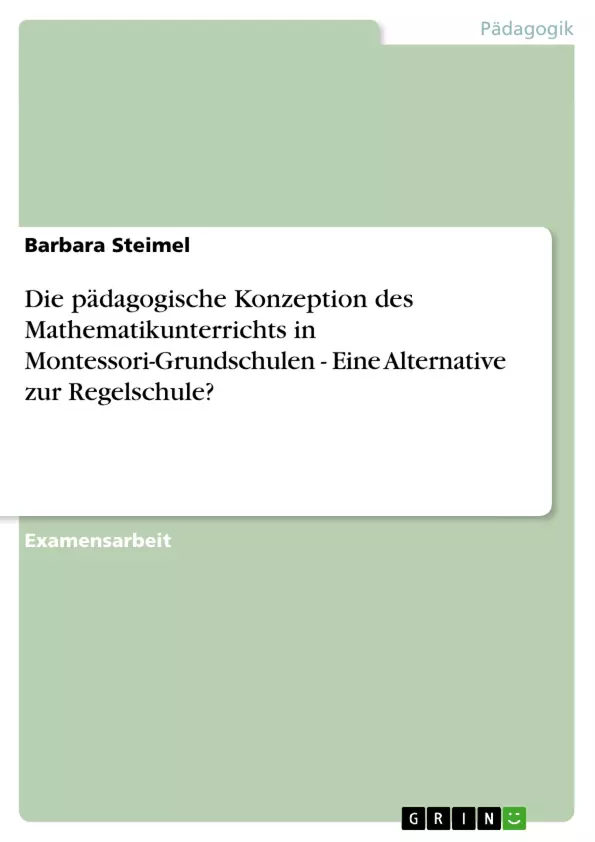Die Vielfalt gegenwärtig verbreiteter Lebensformen einschließlich ihrer multikulturellen Erscheinungsweisen, die Fülle unterschiedlicher Informationen, die über die modernen Medien vermittelt werden und die divergierenden sozialen Lebenssituationen bei den Heranwachsenden spiegeln sich in den kindlichen Erziehungs- und Bildungsvoraussetzungen wider. Eine starke Heterogenität bei den Schülern innerhalb einer Grundschulklasse ist die Folge. Lehrer sind im Zuge dessen in besonderem Maße gefordert, ihren Unterricht differenziert auf die vorhandenen Ressourcen der jungen Menschen abzustimmen.
Die Montessori-Pädagogik, entwickelt von der gleichnamigen italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870-1952), erscheint, hinsichtlich ihres am einzelnen Kind und seinen spezifischen Möglichkeiten orientierten Ansatzes, als eine sinnvolle Option, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Aufgrund dessen drängt sich die Frage auf, ob die pädagogische Konzeption Montessoris geeignet ist, den gegenwärtigen Problemen entgegenzuwirken und die Bedürfnisse der Kinder adäquat zu erfüllen. Die Autorin befasst sich in der vorliegenden Arbeit mit dieser Thematik, indem sie versucht herauszufinden, inwieweit der Entwurf der Pädagogin, bezogen auf das Fach Mathematik, eine sinnvolle Alternative zur Regelschule darstellt. Da diese ausschließlich an die Richtlinien und Lehrpläne ihres jeweiligen Bundeslandes gebunden ist und keine weiteren Standards einhalten muss, werden im Folgenden als Qualitätsmaßstab wertneutral die fachspezifischen Curricula des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen. Zunächst werden jedoch die anthropologischen und bildungstheoretischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik herausgearbeitet und vorgestellt, insbesondere das dem Fach Mathematik zugrunde liegende Konzept.
Im weiteren Verlauf widmet sich die Verfasserin den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Mathematik an Elementarschulen. Analog den Ausführungen der mathematischen Konzeption Montessoris, wird hier die pädagogische und die methodisch-didaktische Seite des Mathematikunterrichts berücksichtigt.
Um die dieser Arbeit unterstellte Fragestellung beantworten zu können, wird sich das nachfolgende Kapitel mit der Aktualität der Mon-tessori-Pädagogik beschäftigen, um im letzten schließlich den Versuch einer aussagekräftigen Bewertung vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- Anthropologische und bildungstheoretische Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- Montessoris Sicht des Kindes
- Die Theorie der sensiblen Phasen
- Die Polarisation der Aufmerksamkeit
- Aspekte der Schule als Institution
- Ziele und Inhalte der Schulerziehung nach Montessori
- Organisation einer Montessori-Grundschule
- Erzieherische Aspekte von Schule und Unterricht
- Erziehung zur Stille
- Die Bedeutung des Fehlers
- Die Rolle des Lehrers
- Aspekte der Unterrichtsgestaltung
- Das Montessori-Material
- Die vorbereitete Umgebung
- Die Freiarbeit
- Die mathematische Bildung bei Montessori
- Der mathematische Geist
- Sinnesmaterialien als Grundlage mathematischer Bildung
- Mathematische Bildung in der Freiarbeit
- Mathematische Bildung im Fachunterricht
- Montessoris pädagogische Konzeption des Mathematikunterrichts
- Richtlinien und Lehrplan für das Fach Mathematik an Grundschulen des Landes NRW
- Pädagogische Aspekte des Mathematikunterrichts
- Allgemeine Lernziele des Mathematikunterrichts (nach Winter)
- Argumentieren
- Kreativität
- Mathematisieren
- Geistige Grundtechniken
- Fachspezifische Lernformen
- Entdeckendes Lernen
- Beziehungsreiches Üben
- Individuelles und gemeinsames Lernen
- Darstellungsformen
- Prinzipien der Unterrichtsgestaltung
- Anwendungs- und Strukturorientierung
- Spiralprinzip
- Offene Unterrichtsformen
- Lernen mit elektronischen Medien
- Frage nach der Aktualität der Montessori-Pädagogik
- Grundsätze der Montessori-Pädagogik in den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Mathematik in NRW
- Anthropologische Aspekte
- Methodisch-didaktische Aspekte
- Umsetzung der Montessori-Pädagogik in Montessori-Schulen der Gegenwart
- Schlussbetrachtung
- Die anthropologischen und bildungstheoretischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- Die mathematische Bildung in Montessori-Schulen
- Die Vergleichbarkeit der Montessori-Pädagogik mit den Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen
- Die Frage nach der Aktualität der Montessori-Pädagogik im Kontext des Mathematikunterrichts
- Die Potentiale und Herausforderungen der Montessori-Pädagogik als Alternative zur Regelschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die pädagogische Konzeption des Mathematikunterrichts in Montessori-Grundschulen und setzt sich mit der Frage auseinander, ob diese eine sinnvolle Alternative zur Regelschule darstellt. Sie beleuchtet die anthropologischen und bildungstheoretischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik im Kontext des Mathematikunterrichts und analysiert die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Prinzipien Montessoris und den Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Bildungslandschaft erläutert und den Forschungsgegenstand präzisiert. Im zweiten Kapitel werden die anthropologischen und bildungstheoretischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik ausführlich dargestellt, wobei die Schwerpunkte auf der Sicht Montessoris vom Kind, der Theorie der sensiblen Phasen und dem Konzept der Polarisation der Aufmerksamkeit liegen. Des Weiteren werden wichtige Aspekte der Schule als Institution, wie Ziele und Inhalte der Schulerziehung nach Montessori und die Organisation einer Montessori-Grundschule, behandelt. Erzieherische Aspekte von Schule und Unterricht, wie die Erziehung zur Stille, die Bedeutung des Fehlers und die Rolle des Lehrers, sowie Aspekte der Unterrichtsgestaltung, wie das Montessori-Material, die vorbereitete Umgebung und die Freiarbeit, werden ebenfalls beleuchtet.
Im Fokus des dritten Kapitels stehen die Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Mathematik an Grundschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Die pädagogischen Aspekte des Mathematikunterrichts, die allgemeinen Lernziele nach Winter (Argumentieren, Kreativität, Mathematisieren, Geistige Grundtechniken) und die fachspezifischen Lernformen (entdeckendes Lernen, beziehungsreiches Üben, individuelles und gemeinsames Lernen, Darstellungsformen) werden ausführlich beschrieben. Abschließend werden die Prinzipien der Unterrichtsgestaltung, wie Anwendungs- und Strukturorientierung, Spiralprinzip, offene Unterrichtsformen und Lernen mit elektronischen Medien, analysiert.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Frage nach der Aktualität der Montessori-Pädagogik. Hierbei werden die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik und den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Mathematik in NRW untersucht. Die Betrachtung der Umsetzung der Montessori-Pädagogik in Montessori-Schulen der Gegenwart schließt dieses Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Montessori-Pädagogik, Mathematikunterricht, Grundschule, Richtlinien und Lehrpläne, NRW, Anthropologie, Bildungstheorie, Sensitive Phasen, Polarisation der Aufmerksamkeit, Sinnesmaterialien, Freiarbeit, Entdeckendes Lernen, Beziehungsreiches Üben, Individuelles und gemeinsames Lernen, Spiralprinzip, Offene Unterrichtsformen, Aktualiät.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Mathematikunterricht nach Montessori?
Er basiert auf dem Konzept des "mathematischen Geistes" und nutzt spezifische Sinnesmaterialien, die abstrakte mathematische Konzepte begreifbar machen.
Was versteht Maria Montessori unter "sensiblen Phasen"?
Dies sind Zeitfenster in der kindlichen Entwicklung, in denen das Kind eine besondere Empfänglichkeit für den Erwerb bestimmter Fähigkeiten (z.B. Ordnung oder Zahlen) besitzt.
Wie unterscheidet sich die Montessori-Schule von der Regelschule in NRW?
Montessori-Schulen setzen stark auf Freiarbeit und jahrgangsgemischte Gruppen, orientieren sich aber dennoch an den fachspezifischen Curricula des Landes.
Was bedeutet "Polarisation der Aufmerksamkeit"?
Es beschreibt den Zustand tiefer Konzentration, in dem ein Kind völlig in seiner Arbeit aufgeht und äußere Reize ausblendet.
Welche Rolle spielt der Lehrer in der Montessori-Pädagogik?
Der Lehrer agiert eher als Beobachter und Begleiter ("Hilf mir, es selbst zu tun"), der die Lernumgebung vorbereitet, statt frontal zu unterrichten.
- Citation du texte
- Barbara Steimel (Auteur), 2006, Die pädagogische Konzeption des Mathematikunterrichts in Montessori-Grundschulen - Eine Alternative zur Regelschule?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63452