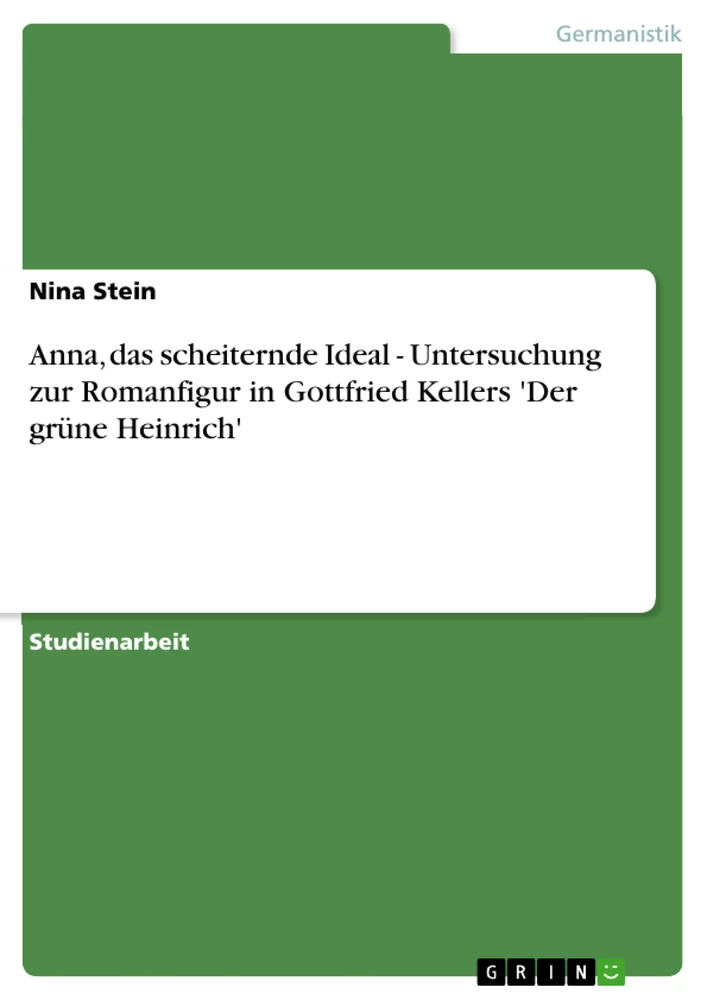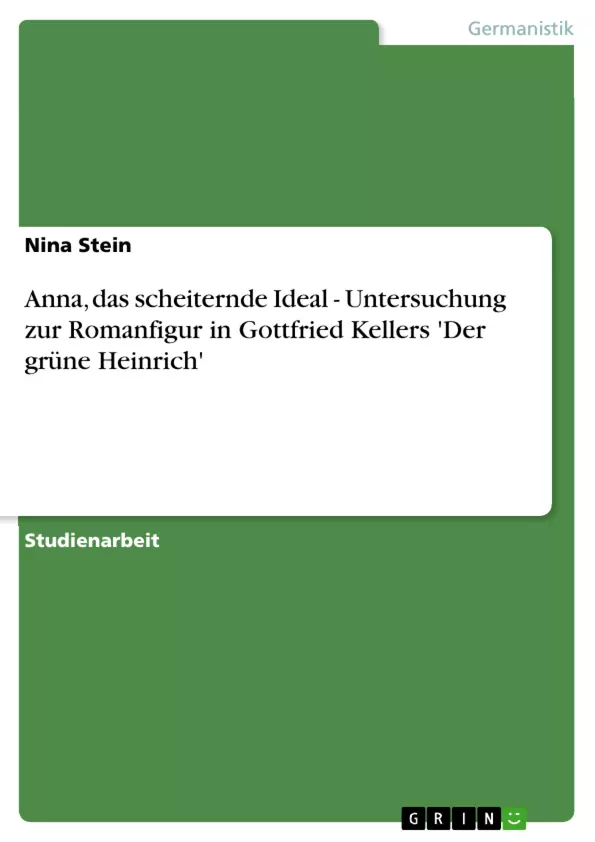Einführung: Ideale
Unbestreitbar wurde der Charakter Heinrich Lee durch seine Kindheit und die Erziehung seiner Mutter entscheidend für sein späteres Leben geprägt. Obwohl vaterlos aufgewachsen, spielt die Vorstellung, die er von seinem Vater hat, eine bedeutende Rolle in seinem späteren Leben. Anhand des Vaterbildes, das seine Mutter ihm in der Kindheit vermittelt hat, versucht Heinrich ein Ideal anzustreben, das Ideal des Vaters, das für ihn unerreichbar ist.1
In dieser Arbeit spielt die Idealvorstellung, die Heinrich von sich selber hat, nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr befasst sich die Arbeit mit dem Ideal, „der Verkörperung von etwas Vollkommenem“2. Sie widmet sich der Romangestalt der Anna, die in Konflikt mit einer Idealvorstellung, die ihr von außen auferlegt wird, und dem eigenen Selbst gerät.
Es soll untersucht werden, inwiefern die Forderungen, die ihre Umwelt an sie stellt, für Anna von Bedeutung sind. Dazu werden die beiden Figuren des Romans, die in engstem Zusammenhang mit Annas Entwicklung stehen, ihr Vater und Heinrich, miteinbezogen.
Ist das Scheitern Annas auf die ihr auferlegten Idealbilder zurückzuführen? Muss Anna „sterben, weil sie ganz Reinheit sein will und soll“3? Um diese Hauptfrage zu klären, soll zunächst untersucht werden, wie diese Ideale aufgebaut werden. Zu diesem Zweck befasst sich die Arbeit mit der Beschreibung Annas durch Heinrich, die weniger ihren Charakter aufzeigt, sondern vielmehr Heinrichs subjektive Empfindungen von Annas Gestalt wiedergibt. Des Weiteren wird der Einfluss der Vaterfigur auf Anna beleuchtet. Wie erzieht der Vater seine Tochter und inwiefern wird sie durch seine Ansprüche und Normvorstellungen geprägt? Anschließend wird der Blick auf die Liebesbeziehung zwischen Heinrich und Anna geworfen. Hierbei soll geklärt werden, welcher Art die Beziehung zwischen Heinrich und Anna ist und welches Bild der Liebe sich Heinrich entwirft. Weiterhin wird die Szene zwischen Heinrich und Anna in der Heidenstube untersucht, in der Annas Konflikt besonders deutlich zu Tage tritt. Ein letzter Abschnitt widmet sich Annas Krankheit und Tod, zeigt im Besonderen Heinrichs Reaktion darauf und untersucht in einem letzten Teil Ähnlichkeiten und Unterschiede mit der ebenfalls scheiternden Meret.
1 Vgl. Kessel: Sprechen – Schreiben – Schweigen, S. 22-29, Adamczyk: Die realitätsbezogene Konstruktion des Entwicklungsromans, S. 108.
2 Duden: Das Fremdwörterbuch7, 2001.
3 Kaiser: Gottfried Keller, S. 103.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung: Ideale
- II. Anna - das scheiternde „Ideal’
- 1. Anna: Bild Heinrichs und Ideal des Vaters
- 1.1 Bild Heinrichs
- 1.2 Anna: Ideal des Vaters und wahres Selbst
- 2. Idealisierte Liebesbeziehung
- 2.1 „Heiligung“ statt Liebe
- 2.2 Spiegelfigur Anna und Kontrastfigur Judith
- 3. Scheitern der idealisierten Beziehung
- 4. Krankheit und Tod
- 4.1 Annas Krankheit und Tod
- 4.2 Anna und Meret
- 1. Anna: Bild Heinrichs und Ideal des Vaters
- III. Durch Idealisierung zum Scheitern verurteilte Figur
- IV. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Romangestalt der Anna in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“. Der Fokus liegt darauf, wie die Idealvorstellungen, die Anna von außen auferlegt werden, ihre Entwicklung und letztlich ihr Schicksal prägen. Es wird beleuchtet, inwiefern Annas Scheitern auf diese Idealbilder zurückzuführen ist.
- Annäherung an Annas Charakter aus Heinrichs Perspektive
- Der Einfluss der Vaterfigur auf Annas Erziehung und Prägung
- Analyse der idealisierten Liebesbeziehung zwischen Heinrich und Anna
- Annäherung an Annas Konflikt in der Szene in der Heidenstube
- Annäherung an Annas Krankheit und Tod im Kontext ihrer Idealbilder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Prägung Heinrichs durch seine Kindheit und seine idealisierten Vorstellungen vom Vater vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Romanfigur Anna und den Konflikt zwischen den ihr auferlegten Idealvorstellungen und ihrem eigenen Selbst.
Kapitel II befasst sich mit Annas Darstellung in Heinrichs Augen und dem Einfluss des Vaterbildes auf sie. Es wird untersucht, wie Heinrich Anna idealisiert und wie sie durch die Ansprüche des Vaters geprägt wird. Der Fokus liegt auf der idealisierten Liebesbeziehung zwischen Heinrich und Anna und der Analyse ihrer Beziehung im Kontext von Heinrichs Idealvorstellungen.
Kapitel III untersucht das Scheitern der idealisierten Beziehung und widmet sich Annas Krankheit und Tod. Es wird Heinrichs Reaktion auf Annas Tod analysiert und ein Vergleich zu Meret gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Realismus in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“, insbesondere mit der Romanfigur Anna und der ihr auferlegten Idealvorstellung. Die Analyse umfasst die Themen Idealbildung, Vaterfigur, Liebesbeziehung, Scheitern und Tod.
- Quote paper
- Nina Stein (Author), 2005, Anna, das scheiternde Ideal - Untersuchung zur Romanfigur in Gottfried Kellers 'Der grüne Heinrich', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63479