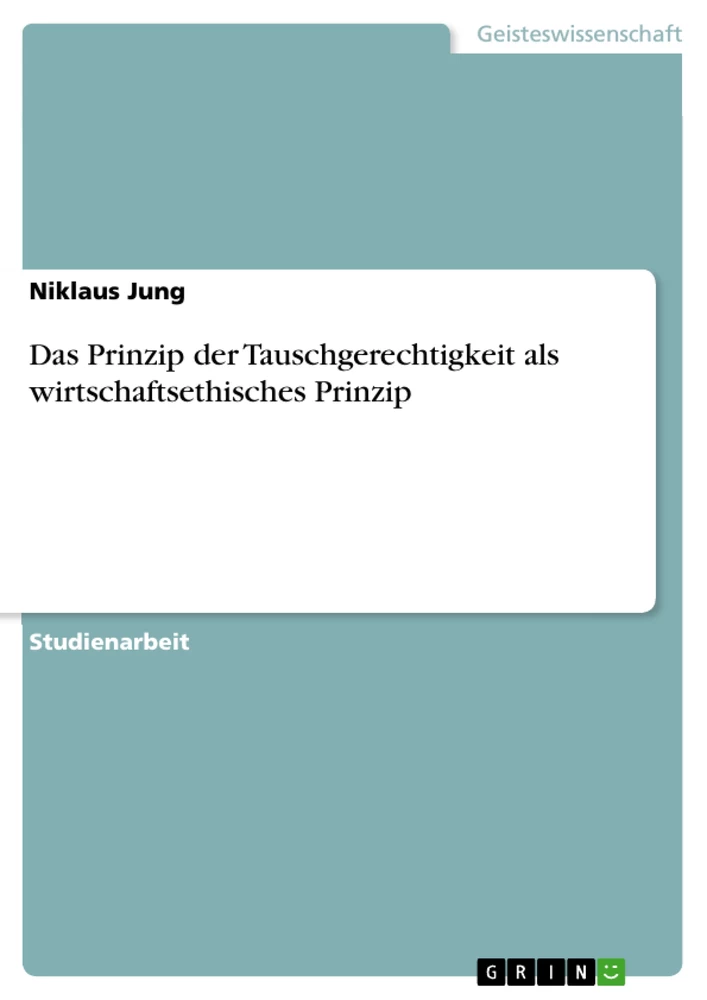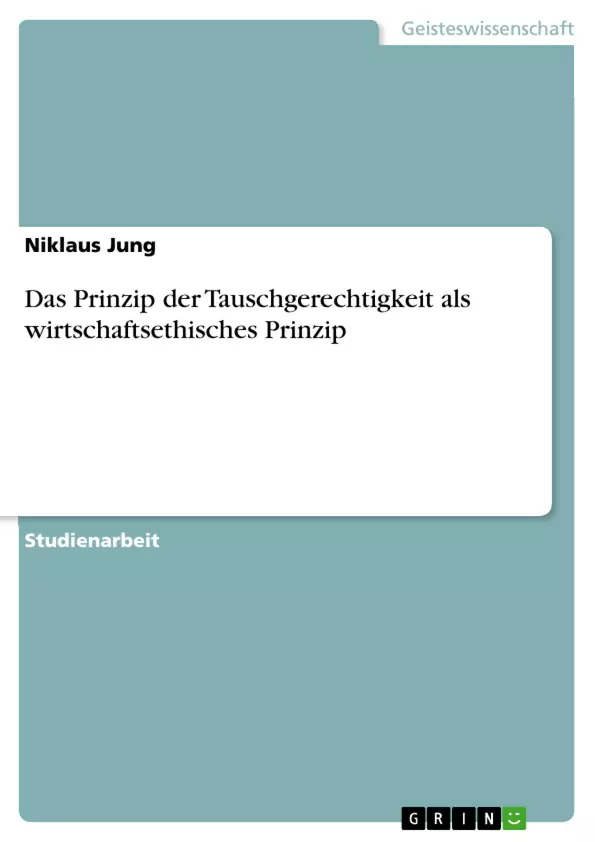In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit dem Prinzip der Tauschgerechtigkeit befassen. Als Vorlage dient mir der Text von Otfried Höffe „Gerechtigkeit als Tausch? Ein ökonomisches Prinzip für die Ethik“
Dabei soll untersucht werden, inwieweit das von Höffe vorgestellte Prinzip der Tauschgerechtigkeit geeignet zum Lösen wirtschaftsethischer Fragen ist. Ziel dieser Arbeit ist es dabei nicht, den Text Höffes zu erläutern, interpretieren und kommentieren, sondern basierend auf der Idee der Tauschgerechtigkeit unter Zuhilfenahme von Höffes Text eine eigene Argumentation zu erarbeiten. Es wird durchaus Höffes Weg in seiner Struktur begleitend dargestellt, um aufzuzeigen, wo Parallelen und wo Verschiedenheiten in der Argumentation bestehen.
Die Untersuchung der Tauschgerechtigkeit besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten. Zuerst muss geklärt werden, mit welcher Berechtigung das Prinzip der Tauschgerechtigkeit für geeignet gehalten werden kann, Lösungsansätze für normative Fragen zu entwickeln. Für Tausch und Gerechtigkeit muss das auf zwei verschiedenen Ebenen geschehen. Da Gerechtigkeit bereits ein moralischer Begriff ist, gilt es, mögliche Alternativen auszuschließen oder zumindest Gerechtigkeit als das plausiblere, geeignetere Prinzip zu begründen. Tausch ist eher ein ökonomisches denn ein moralisches Prinzip; an dieser Stelle muss gezeigt werden, wie dennoch durch das Prinzip Tausch eine normative Regelung gefunden werden kann. Das zu zeigen, wird Kern des ersten Hauptabschnitts sein.
Im zweiten Teil geht es darum, zu klären, wie mögliche Lösungsansätze durch die Tauschgerechtigkeit gerechtfertigt werden, bzw. wie durch das genannte Prinzip neue Ansätze gefunden werden können. Dabei soll zunächst der politische Tausch anhand des Hobbesschen Modells des Gesellschaftsvertrags erörtert werden, um zu zeigen, dass das Prinzip Tauschgerechtigkeit seine ethische Anwendung findet. Des weiteren möchte ich mich einer Frage widmen, die Höffe nicht bearbeitet hat, nämlich welche direkten Konsequenzen sich aus dem politischen Tausch für den ökonomischen ergeben können.
Unabhängig davon soll Tauschgerechtigkeit anhand exemplarischer Probleme erörtert werden. Dabei müssen die Probleme unterschieden werden: Zum einen müssen wirtschaftsethische Fragen grundsätzlicher, theoretischer Art untersucht werden, also Probleme, die im ökonomischen System per se sind - dem widmet sich Höffe, und an seinem Text sollen entsprechende Fragen auch bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlegungen zu Tausch und Gerechtigkeit
- Der politische Tausch
- Der ökonomische Tausch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Prinzip der Tauschgerechtigkeit als Lösung für wirtschaftsethische Fragen, basierend auf Otfried Höffes Text "Gerechtigkeit als Tausch?". Ziel ist nicht die bloße Kommentierung Höffes, sondern die Entwicklung einer eigenen Argumentation, die Parallelen und Unterschiede zu Höffes Ansatz aufzeigt.
- Die Legitimität der Tauschgerechtigkeit als Prinzip zur Entwicklung normativer Lösungsansätze.
- Die Rechtfertigung möglicher Lösungsansätze durch die Tauschgerechtigkeit.
- Die Anwendung des Prinzips der Tauschgerechtigkeit auf politische und ökonomische Tauschprozesse.
- Die Untersuchung wirtschaftsethischer Probleme anhand des Prinzips der Tauschgerechtigkeit.
- Die Unterscheidung zwischen theoretischen und praktischen wirtschaftsethischen Problemen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit dem Prinzip der Tauschgerechtigkeit als Lösungsansatz für wirtschaftsethische Fragen. Sie orientiert sich an Otfried Höffes Text "Gerechtigkeit als Tausch?", entwickelt aber eine eigenständige Argumentation. Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: Erstens wird die Legitimität der Tauschgerechtigkeit als normatives Prinzip geklärt, wobei Tausch und Gerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Zweitens werden mögliche Lösungsansätze durch die Tauschgerechtigkeit untersucht, inklusive der Anwendung auf politische und ökonomische Tauschprozesse sowie die Analyse konkreter wirtschaftsethischer Probleme.
Überlegungen zu Tausch und Gerechtigkeit: Dieses Kapitel hinterfragt die Eignung von Gerechtigkeit als Prinzip für Wirtschaftsnormen. Es werden alternative Prinzipien wie Solidarität und Brüderlichkeit diskutiert, deren praktische Anwendung anhand historischer Beispiele (Verhältnis der Ersten zur Dritten Welt, Französische Revolution) als fragwürdig dargestellt wird. Die Freiwilligkeit als Voraussetzung für moralisch relevantes Handeln wird betont, und Gerechtigkeit wird als das Prinzip definiert, das falsches Handeln zu vermeiden sucht. Die Notwendigkeit verbindlicher Moral und Rechtsverbindlichkeit wird im Zusammenhang mit Gerechtigkeit erläutert.
Schlüsselwörter
Tauschgerechtigkeit, Wirtschaftsethik, Gerechtigkeit, Solidarität, Brüderlichkeit, Politischer Tausch, Ökonomischer Tausch, Normative Prinzipien, Lösungsansätze, Wirtschaftsethische Probleme.
Häufig gestellte Fragen zu "Gerechtigkeit als Tausch?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Prinzip der Tauschgerechtigkeit als Lösungsansatz für wirtschaftsethische Fragen. Sie basiert auf Otfried Höffes Text "Gerechtigkeit als Tausch?", entwickelt aber eine eigenständige Argumentation, die Parallelen und Unterschiede zu Höffes Ansatz aufzeigt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Legitimität der Tauschgerechtigkeit als normatives Prinzip zu klären, mögliche Lösungsansätze durch die Tauschgerechtigkeit zu rechtfertigen und dieses Prinzip auf politische und ökonomische Tauschprozesse anzuwenden. Weiterhin untersucht sie wirtschaftsethische Probleme anhand dieses Prinzips und unterscheidet zwischen theoretischen und praktischen wirtschaftsethischen Problemen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Legitimität der Tauschgerechtigkeit, die Rechtfertigung von Lösungsansätzen durch Tauschgerechtigkeit, die Anwendung des Prinzips auf politische und ökonomische Tauschprozesse, die Untersuchung wirtschaftsethischer Probleme und die Unterscheidung zwischen theoretischen und praktischen wirtschaftsethischen Problemen. Zusätzlich werden alternative Prinzipien wie Solidarität und Brüderlichkeit diskutiert und deren praktische Anwendung hinterfragt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Überlegungen zu Tausch und Gerechtigkeit, dem politischen Tausch und dem ökonomischen Tausch. Die Einleitung erläutert den Forschungsansatz und die Struktur der Arbeit. Die Kapitel untersuchen die Eignung von Gerechtigkeit als Prinzip für Wirtschaftsnormen, diskutieren alternative Prinzipien und wenden das Prinzip der Tauschgerechtigkeit auf verschiedene Bereiche an.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Tauschgerechtigkeit, Wirtschaftsethik, Gerechtigkeit, Solidarität, Brüderlichkeit, Politischer Tausch, Ökonomischer Tausch, Normative Prinzipien, Lösungsansätze und Wirtschaftsethische Probleme.
Wie wird Gerechtigkeit in der Arbeit definiert?
Gerechtigkeit wird als das Prinzip definiert, das falsches Handeln zu vermeiden sucht. Die Freiwilligkeit wird als Voraussetzung für moralisch relevantes Handeln betont. Die Notwendigkeit verbindlicher Moral und Rechtsverbindlichkeit im Zusammenhang mit Gerechtigkeit wird ebenfalls erläutert.
Welche Kritikpunkte werden an alternativen Prinzipien wie Solidarität und Brüderlichkeit geäußert?
Die Arbeit hinterfragt die praktische Anwendbarkeit von Solidarität und Brüderlichkeit anhand historischer Beispiele wie dem Verhältnis der Ersten zur Dritten Welt und der Französischen Revolution, und zeigt deren Grenzen auf.
Wie wird der Bezug zu Otfried Höffes "Gerechtigkeit als Tausch?" hergestellt?
Die Arbeit orientiert sich an Höffes Text, entwickelt aber eine eigenständige Argumentation. Sie zeigt Parallelen und Unterschiede zu Höffes Ansatz auf und dient nicht nur als bloße Kommentierung seines Werkes.
- Citar trabajo
- Niklaus Jung (Autor), 2002, Das Prinzip der Tauschgerechtigkeit als wirtschaftsethisches Prinzip, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63496