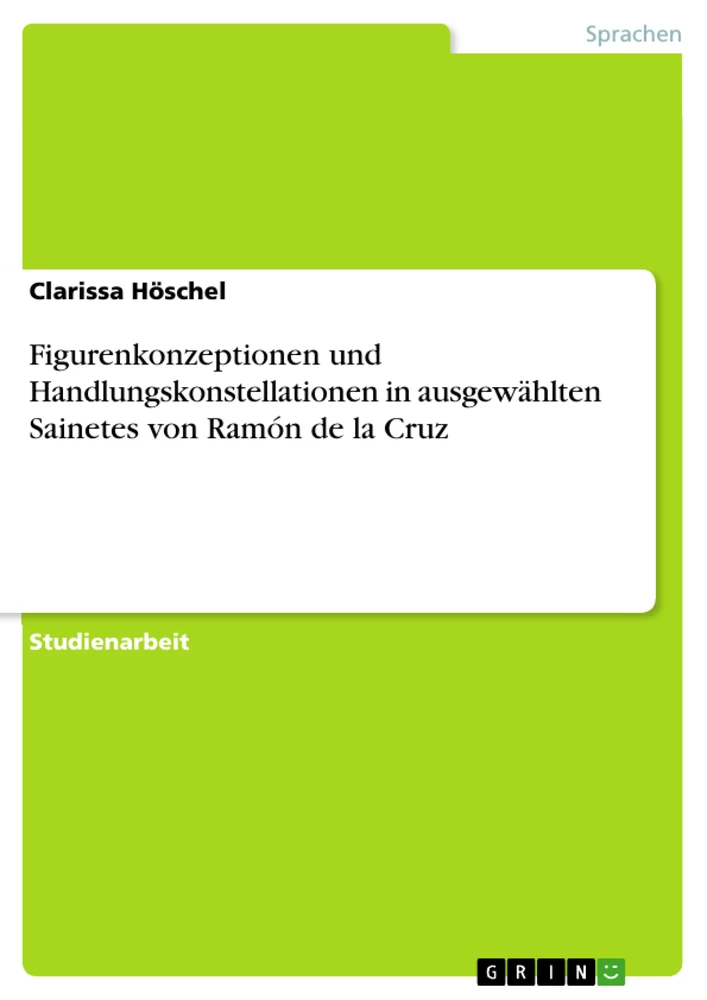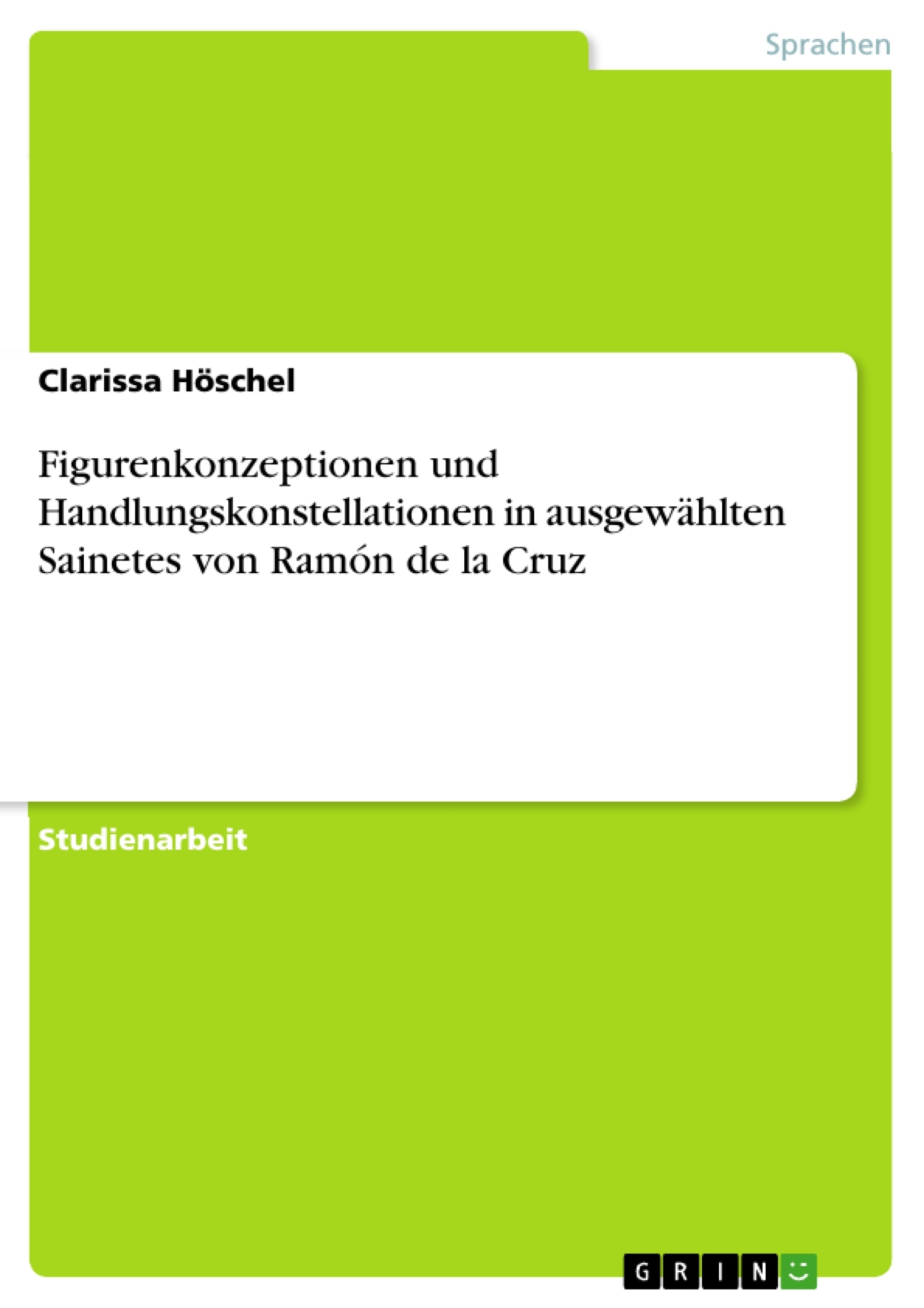Das komische Theaters im Spanien des 18. Jahrhunderts ist, ähnlich wie auch in Italien, durch eine gewisse Zweigleisigkeit gekennzeichnet: Einerseits orientiert sich das hochliterarische Theater an Vorbildern wie Molière und Einflüssen wie der Didaktik der Aufklärung, andererseits leben traditionelle und volkstümliche Elemente weiterhin fort. Anders aber als in Italien, wo sich ein Erstarren der venezianischen Commedia dell’arte bemerkbar macht, erlebt Spanien die Verselbständigung des género menor in Form von entremeses und sainetes, die sich zum Gegengewicht des género mayor entwickeln und in den unteren Volksschichten ihr treuestes Publikum, in den Theaterreformern aber auch ihre vehementesten Gegner finden.
Im Gegensatz zum kulturell wegweisenden Frankreich weist Spanien eine lange Tradition des humorvollen Theaters auf; gleichzeitig wirkt sich der starke französische Kultureinfluß seit dem am Anfang des 18. Jahrhunderts ausgetragenen Erbfolgekrieg deutlich auf die Entwicklung des hochliterarischen Theaters aus, was nicht nur zu Spannungen und Konkurrenzsituationen, sondern durchaus auch zu einem Miteinander der beiden Gattungen auf der Bühne führt, denn die kurzen entremeses und sainetes werden zwischen den Akten der abendfüllenden Klassiker aufgeführt und symbolisieren damit den Ausgang der comedia antigua des Siglo de Oro, deren Hauptanliegen ebenfalls das delectare, das Erfreuen und Unterhalten des Zuschauers, war, ohne den moralisierenden und didaktischen Anspruch der comedia nueva, die dem Aspekt des delectare den des docere an die Seite stellt. Auffällig ist, daß die klassischen Werke des Siglo de Oro, vor allem die Stücke Calderóns, nun als refundiciones aufgeführt werden, und dies bedeutet, daß sie dem zeitgenössischen Geschmack angepaßt und immer mehr auf die Unterhaltung ausgerichtet sind. Insgesamt kann beobachtet werden, daß die monarchischen und religiösen Elemente zunehmend aus der Mode geraten und daß gerade die Zwischenspiele viel zum allgemeinen Theatererfolg beitragen. Dabei entstehen aus den traditionellen entremeses (die 1780 wegen ihrer Obszönität verboten werden) die gesprochenen (sainetes) und gesungenen (tonadillas) Zwischenspiele.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Theatersituation im Spanien des 18. Jahrhunderts
- Ramón de la Cruz
- Zur Gattung der Sainetes
- Definition
- Vorläufer der Sainetes und seiner Figuren
- Schauplätze
- Außenräume
- El Paseo del Prado
- La Calle
- La Plaza Mayor
- El patio
- Innenräume
- La casa pobre
- Die Verlagerung des Schauplatzes
- Von außen nach außen
- Von außen nach innen
- Von innen nach innen
- Erkennungszeichen der Schlüsselfiguren
- Kleider machen majos und petimetres
- Sprechende Namen
- Sprache
- Musik, Gesang und Tanz
- Das liebe Geld oder Mehr scheinen denn sein
- Tod als Komik
- Die Figurenkonzeption
- Majos und petimetres
- Die Doppelung des dramatischen Genres: lo tradicional y lo foreño
- Majos und petimetres: wie Hund und Katze?
- Der Sonderfall: Sainetes ohne die Opposition majo-petimetre
- Der Umgang mit Konflikten
- Modelle der Konfliktlösung
- Die Obrigkeit
- Das Einschreiten indirekt Beteiligter
- Konfliktlösung durch direkt Betroffene
- Bleibt alles, wie es ist?
- Delectare - mit oder ohne docere?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Figurenkonzeption und den Handlungskonstellationen in ausgewählten Sainetes von Ramón de la Cruz. Sie analysiert, wie der Autor in seinen Stücken typische Charaktere des Madrider Volkes, insbesondere Majos und Petimetres, darstellt und deren Interaktion in den Kontext des spanischen Theaters des 18. Jahrhunderts einordnet.
- Die Theaterlandschaft im Spanien des 18. Jahrhunderts
- Das Genre des Sainetes und seine Bedeutung für die spanische Theatergeschichte
- Die Figurenkonzeption in den Sainetes von Ramón de la Cruz, insbesondere die Darstellung von Majos und Petimetres
- Die Rolle von Schauplätzen und deren Einfluss auf die Handlung
- Der Umgang mit Konflikten in den Sainetes von Ramón de la Cruz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel zeichnet ein Bild der Theatersituation im Spanien des 18. Jahrhunderts und beleuchtet die Bedeutung des género menor, insbesondere der Sainetes, als Gegengewicht zum dominierenden género mayor.
Das zweite Kapitel widmet sich den Schauplätzen, die in den Sainetes von Ramón de la Cruz eine wichtige Rolle spielen. Es werden sowohl Außenräume wie der Paseo del Prado, La Calle und La Plaza Mayor als auch Innenräume wie La casa pobre untersucht.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Erkennungszeichen der Schlüsselfiguren in den Sainetes. Es wird die Bedeutung von Kleidung, sprechenden Namen, Sprache, Musik, Gesang, Tanz und dem Thema Geld sowie der Darstellung des Todes als Komik analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Figurenkonzeption in den Sainetes, insbesondere der Darstellung von Majos und Petimetres, und beleuchtet deren Rolle in der Konfrontation zwischen traditioneller und neuer Weltanschauung.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Umgang mit Konflikten in den Sainetes und analysiert verschiedene Modelle der Konfliktlösung, wie die Einmischung der Obrigkeit, das Eingreifen indirekt Beteiligter oder die direkte Konfliktlösung durch die Betroffenen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie dem spanischen Theater des 18. Jahrhunderts, dem Genre des Sainetes, der Figurenkonzeption, der Darstellung von Majos und Petimetres, Schauplätzen, Konflikten und den unterschiedlichen Ansätzen zur Konfliktlösung. Sie untersucht die spezifischen Merkmale der Sainetes von Ramón de la Cruz, die Bedeutung des Humors und der Satire für die Gesellschaftssatire und die Relevanz der Werke für das Verständnis der spanischen Kultur und Theatergeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Sainete?
Ein Sainete ist ein kurzes, humorvolles Theaterstück der spanischen Aufklärung, das oft als Zwischenspiel (género menor) aufgeführt wurde und den Alltag des Volkes darstellt.
Wer waren die „Majos“ und „Petimetres“?
Majos repräsentieren das traditionelle, stolze Madrider Volk, während Petimetres (vom franz. petit maître) modisch-französisierte, oft eitle Figuren der Oberschicht darstellen.
Welche Rolle spielen die Schauplätze in den Werken von Ramón de la Cruz?
Die Schauplätze wie der Paseo del Prado oder die Plaza Mayor sind essenziell, um die soziale Dynamik und die Begegnungen der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten abzubilden.
Was bedeutet „delectare et docere“ im spanischen Theater?
Es beschreibt den Anspruch, das Publikum gleichzeitig zu unterhalten (delectare) und moralisch zu belehren (docere), wobei Sainetes oft stärker auf Unterhaltung setzten.
Wie werden Konflikte in den Sainetes gelöst?
Konflikte werden entweder durch die Obrigkeit, durch das Eingreifen Dritter oder direkt durch die betroffenen Figuren gelöst, oft mit komischem Ausgang.
Welche Bedeutung hat die Kleidung für die Figurenkonzeption?
Kleidung dient als wichtigstes Erkennungszeichen für den sozialen Status und die Gesinnung (traditionell vs. modern/ausländisch) der Charaktere.
- Citar trabajo
- Magister Artium Clarissa Höschel (Autor), 2003, Figurenkonzeptionen und Handlungskonstellationen in ausgewählten Sainetes von Ramón de la Cruz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63543