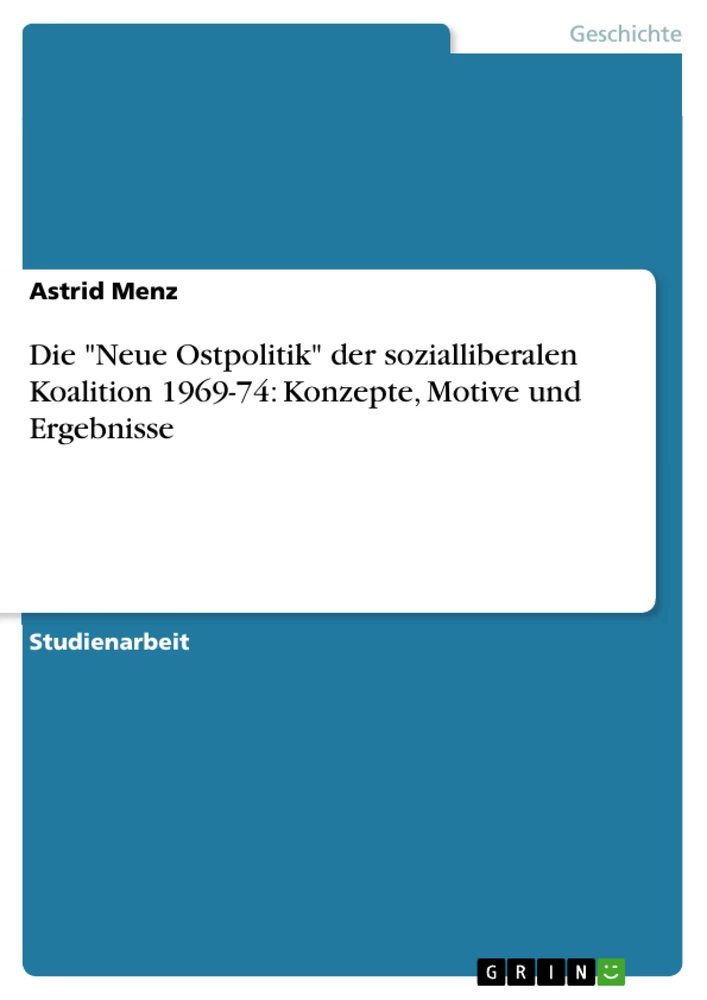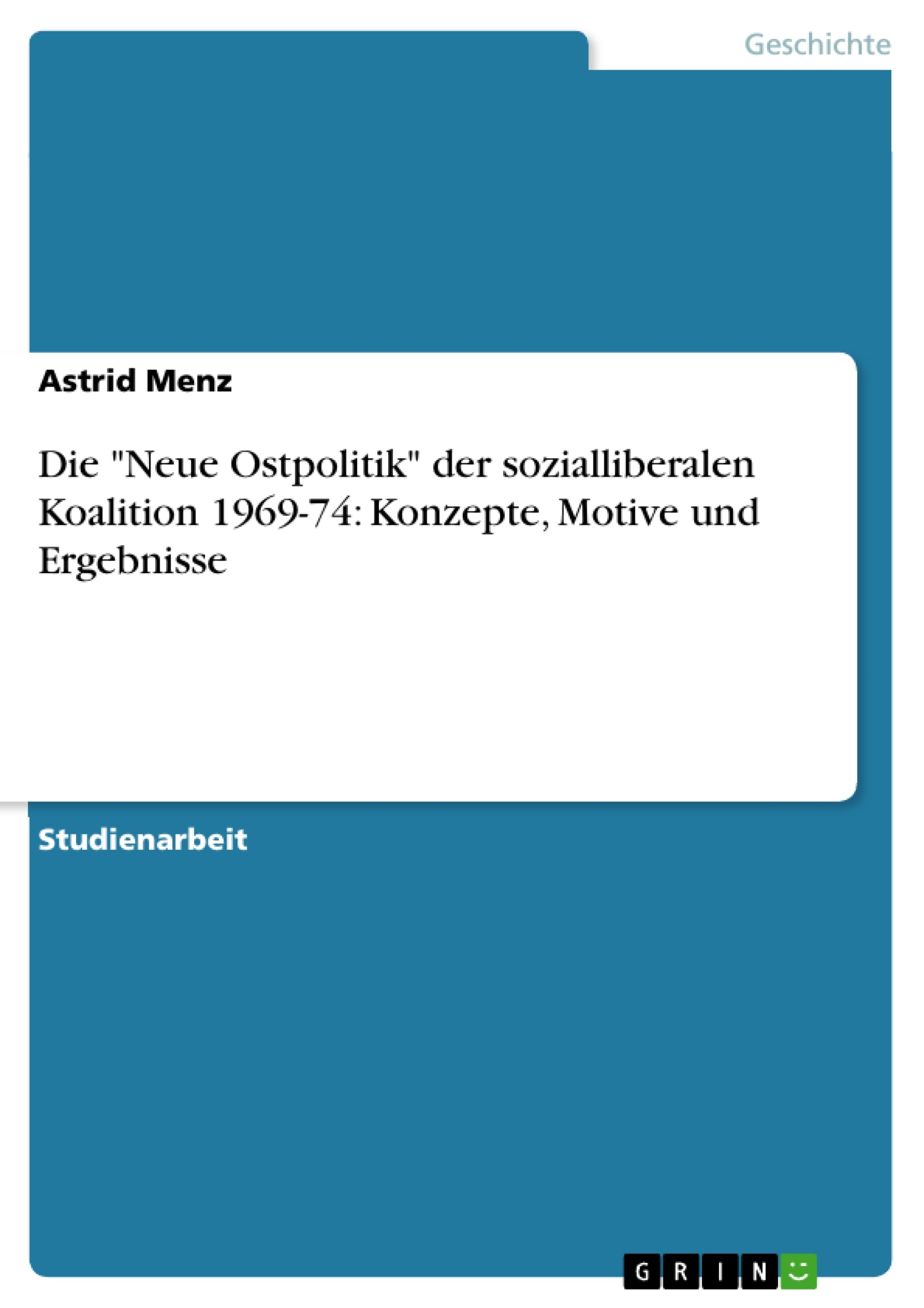Betrachtet man die Außenpolitik der BRD ergeben sich Besonderheiten. Ihre Ziele nach dem 2. Weltkrieg waren: äußere Sicherheit, Souveränität, Gleichberechtigung und Wiedervereinigung.2 Die Bundesrepublik, gegründet durch Ost- West- Konflikt,3 erreichte erst in einem langen Prozess ihre Souveränität und damit außenpolitische Handlungsfreiheit zurück. d.h. sie wandelte sich von einem Objekt der Alliierten zu einem gleichberechtigten Subjekt der Staatengemeinschaft.4 Charakteristisch war ihr Doppelkonflikt: zum einen strebte sie danach, eine westliche, freiheitliche Demokratie zu werden. Ihr Interesse, eine weitere Expansion der Sowjetunion verhindern, deckte sich mit dem Interesse der alliierten Westmächte. Dies war der gemeinsame Konflikt des demokratischen Westens mit dem kommunistischen Osten. Zum anderen befand sie sich mit der Sowjetunion in einem Sonderkonflikt, der sich aus den westdeutschen Forderungen nach Wiedervereinigung mit dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands und der Revision der verlorenen Ostgebiete ergab. Bei diesem speziellen Konflikt konnte Westdeutschland nur bedingt auf Unterstützung des Westen vertrauen.5 Wesentlich für die deutsche Außenpolitik war ihr begrenzter Aktionsraum aufgrund bestehender alliierter Vorbehaltrechte bezüglich Deutschlands und Berlins, sowie deren Absicht, die Bundesrepublik als Vorhut der Freiheit in dem ideologischen und machtpolitischen Ost-West-Konflikt zu präsentieren.6 Um eigene Interessen zu verwirklichen wählte, die Bundesrepublik das Mittel der Westintegration. Sie fügte sich in das westliche Bündnis ein und erreichte 1955 ein gewisses Maß an Sicherheit, Teilsouveränität und teilweise Gleichberechtigung. Auf ihr vorrangiges Ziel (Wiedervereinigung) musste sie vorerst verzichten.7
In den 60er Jahren begann sich die weltpolitische Lage zu verändern. Der Ost-West- Konflikt trat in eine Phase der Entspannung. Das bewirkte eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik, speziell ihres Verhältnisses zur Sowjetunion. Durch die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition gelang es der Bundesrepublik, sich aus der beschriebenen politischen Situation ein Stück zu emanzipieren.8
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auswärtige Beziehungen der BRD mit der SU bis 1969 vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes
- Ostpolitik der BRD unter Bundeskanzler Adenauer
- Ostpolitik der BRD unter Bundeskanzler Erhard: Öffnung nach Osten
- Die Ostpolitik der Großen Koalition: Neuorientierung in den außenpolitischen Beziehungen zum Osten
- Beweggründe und Ideen für eine Annäherung an den Osten bis 1969
- Willy Brandts: Koexistenz- Zwang zum Wagnis
- Egon Bahrs Konzept „Wandel durch Annäherung“
- Politik der „Kleinen Schritte“ – Das Passierscheinabkommen
- Sicherheit und Frieden in Europa
- Zentrale Aspekte der Außen- und Deutschlandpolitik Brandts zur Zeit der Großen Koalition
- Die sozialliberale Koalition
- Beweggründe zur Bildung der Koalition, ihre Motive und Ziele
- Die Ostverträge als Umsetzung der ostpolitischen Konzepte
- Der Moskauer Vertrag und das Berlin-Abkommen
- Verhandlungen mit Moskau
- Das Vier-Mächte- Abkommen über Berlin
- Der Moskauer Vertrag und das Berlin-Abkommen
- Bilanz und Bewertung der Anfänge der Ostpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entstehung und Umsetzung der „Neuen Ostpolitik“ der sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland von 1969 bis 1974. Sie beleuchtet die entscheidenden Motive und Konzepte, die zu dieser neuen außenpolitischen Ausrichtung führten, sowie deren konkrete Ergebnisse in Form der Ostverträge mit der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und der DDR.
- Die Entwicklung der deutschen Ostpolitik von Adenauer bis zur Großen Koalition
- Die Konzepte und Motive von Willy Brandt und Egon Bahr für eine Annäherung an den Osten
- Die Umsetzung der Ostpolitik durch die sozialliberale Koalition und die Bedeutung der Ostverträge
- Die konkrete Ausgestaltung des Moskauer Vertrags und des Berlin-Abkommens
- Die Bewertung der Ergebnisse der „Neuen Ostpolitik“ und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Frage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Besonderheiten der deutschen Außenpolitik im Kontext des Ost-West-Konflikts dar und skizziert die Herausforderungen, die die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg bewältigen musste. Sie führt die Ziele der deutschen Außenpolitik, insbesondere äußere Sicherheit, Souveränität, Gleichberechtigung und Wiedervereinigung, sowie den Doppelkonflikt mit der Sowjetunion und den westlichen Alliierten aus.
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Ostpolitik von 1949 bis 1969. Es werden die unterschiedlichen Ansätze unter den Bundeskanzlern Adenauer, Erhard und der Großen Koalition sowie deren jeweilige Beziehungen zur Sowjetunion und zur DDR beschrieben.
Das zweite Kapitel fokussiert auf die Beweggründe und Ideen für eine Annäherung an den Osten bis 1969. Es stellt die Konzepte von Willy Brandt und Egon Bahr vor, insbesondere Brandts Konzept der Koexistenz und Bahrs Konzept des „Wandel durch Annäherung“. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Rolle der „Kleinen Schritte“ und die Bedeutung der Sicherheit und des Friedens in Europa im Kontext der Ostpolitik.
Das dritte Kapitel behandelt die sozialliberale Koalition und deren ostpolitische Konzepte. Es untersucht die Beweggründe zur Bildung der Koalition, ihre Motive und Ziele sowie die konkrete Umsetzung der Ostpolitik in Form der Ostverträge. Das Kapitel befasst sich mit dem Moskauer Vertrag und dem Berlin-Abkommen, einschließlich der Verhandlungen mit Moskau und dem Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Es schließt mit einer Bilanz und Bewertung der Anfänge der Ostpolitik.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: „Neue Ostpolitik“, sozialliberale Koalition, Willy Brandt, Egon Bahr, „Wandel durch Annäherung“, Ostverträge, Moskauer Vertrag, Berlin-Abkommen, deutsche Frage, Wiedervereinigung, Koexistenz, Sicherheit, Frieden, Ost-West-Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der „Neuen Ostpolitik“ unter Willy Brandt?
Das Ziel war die Entspannung im Ost-West-Konflikt und eine Annäherung an die Sowjetunion sowie die DDR, um die deutsche Frage langfristig zu lösen.
Was verbirgt sich hinter dem Konzept „Wandel durch Annäherung“?
Dieses von Egon Bahr entwickelte Konzept setzte auf kleine Schritte der Kooperation, um durch menschliche und wirtschaftliche Kontakte politische Veränderungen im Osten zu bewirken.
Welche Verträge waren zentral für die Ostpolitik zwischen 1969 und 1974?
Wichtig waren der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag, das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin und der Grundlagenvertrag mit der DDR.
Wie unterschied sich Brandts Politik von der Adenauers?
Während Adenauer auf strikte Westintegration und Nichtanerkennung der DDR setzte, suchte Brandt den direkten Dialog und die vertragliche Absicherung des Status quo.
Was regelte das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin?
Es sicherte den ungehinderten Transitverkehr zwischen der BRD und West-Berlin sowie die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik ab.
- Arbeit zitieren
- Astrid Menz (Autor:in), 2005, Die "Neue Ostpolitik" der sozialliberalen Koalition 1969-74: Konzepte, Motive und Ergebnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63748