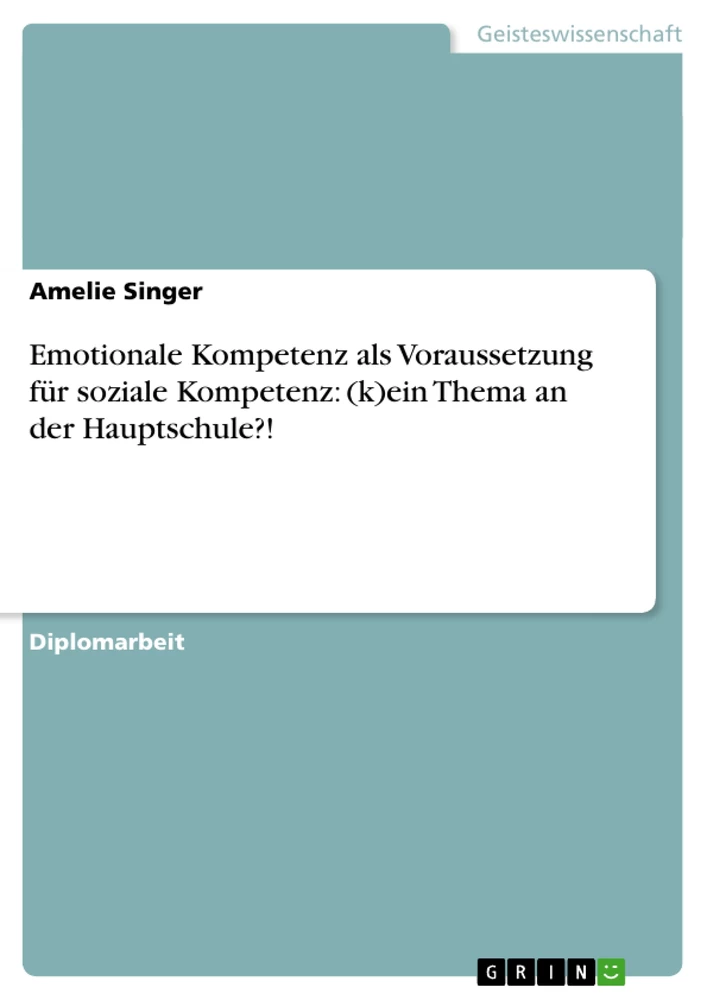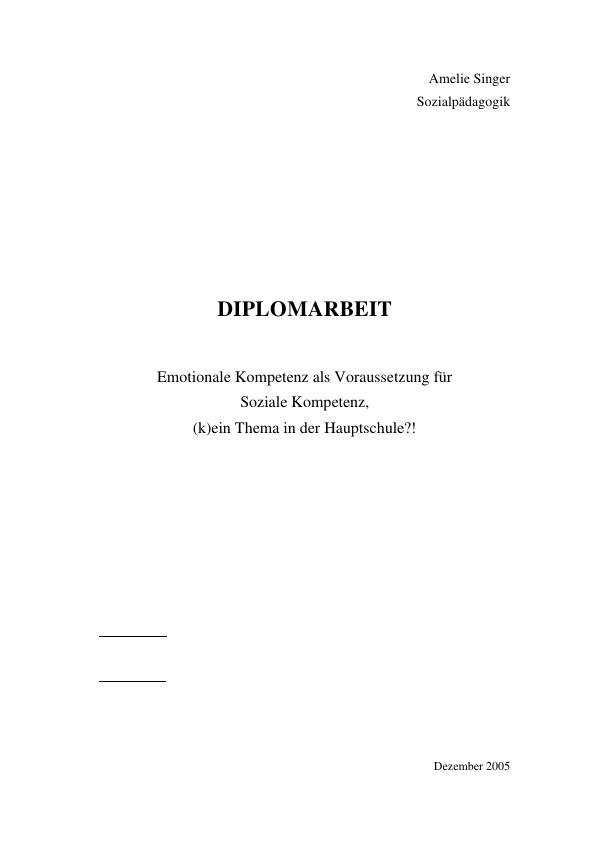Die heutige Jugend wächst in einer Gesellschaft der Pluralisierung, Liberalisierung, und Auflösung traditioneller Lebensformen und Bindungen auf. Normative Autoritäten werden immer weniger, wohingegen Wahlmöglichkeiten durch individuelle Freiheit steigen und Eigenleistung bei der Lebensbewältigung gefragt ist.
Durch diese gesellschaftlichen Umstände erleben Jugendliche heute ihre Biografien als immer weniger voraussagbar und ihre Lebenswelten als komplexer und widersprüchlicher. Im ständigen Wandel unserer Zeit ist keinem mehr ein gesichertes Leben garantiert. Mobilität und Flexibilität sind gefragt, die persönliche Belastung durch die neuen Anforderungen ist gewaltig. Ulrich Beck spricht von einer „Risikogesellschaft“, in der Angst, Beunruhigung wie auch Wut und Überforderung zu Verhaltensauffälligkeiten, Aggression und Gewalt führen können.
So werden auch von Lehrern in letzter Zeit immer mehr Klagen über Rücksichtslosigkeit, Gleichgültigkeit, Gereiztheit und mangelnde
Leistungsbereitschaft ihrer Schüler laut.
Die Jugendlichen, die innerhalb dieser Arbeit im Mittelpunkt des Interesses stehen werden, sind solche, die durch das Fehlen materieller, sozialer oder kultureller Ressourcen von entwicklungsfördernden Erfahrungen ausgegrenzt sind.
Viele davon leben in potentieller Armut, stammen aus Migrantenfamilien oder sind Kinder von Alleinerziehenden. Der breite Markt der Möglichkeiten, auf den ihnen unbegrenzter
Zugriff suggeriert wird, kann von den meisten auf Grund mangelnder materieller sowie sozialer Ressourcen nicht ausgeschöpft werden. Hauptschüler werden durch ihren familiären Hintergrund häufig vor größere Herausforderungen gestellt, sind aber gleichzeitig für deren Bewältigung und die Wahrnehmung von Selbstverantwortung mit weniger Ressourcen ausgestattet. Entwicklungs- und
Lebenschancen sind in unserer heutigen Gesellschaft weit entfernt von gleichberechtigter Verteilung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitungsteil
- Hintergründe für die Wahl des Themas
- Die persönliche Motivation
- Die aktuelle gesellschaftliche Relevanz
- Eingrenzung des Themas und Konkretisierung der Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Hauptteil I – Theoretischer Teil
- Begriffsbestimmungen
- Die Emotionale Kompetenz
- Die Soziale Kompetenz
- Entwicklung und Erwerb Emotionaler und Sozialer Kompetenz
- Interdependenz von Emotionaler und Sozialer Kompetenz
- Jugend als Lebensphase
- Wer sind eigentlich „Die Jugendlichen“?
- Jugend heute - Ergebnisse der 14. Shell-Studie 2002
- Entwicklungsaufgaben Jugendlicher
- Ausgewählte Sozialisationsinstanzen
- Die Notwendigkeit Emotionaler und Sozialer Kompetenz
- Schule – Lern- und Lebensraum
- Schule heute - ein Blick hinter die Kulissen
- Aufgaben und Funktionen des Schulsystems
- Besonderheiten der Hauptschule
- Exkurs - Schülerrolle
- Soziale Kompetenz in der Hauptschule – Förderbedarf und Umsetzung
- Emotionale Kompetenz in der Hauptschule – Förderbedarf und Umsetzung
- Resümee Emotionale und Soziale Kompetenz in der Hauptschule
- Hauptteil II – Methodischer & Empirischer Teil
- Ziel der Untersuchung
- Vorstellung und Begründung der verwendeten Methoden
- Vorbereitung und Durchführung der Interviews
- Die Auswertungsstrategie
- Die Auswertung der Interviews
- Schulische Fördermöglichkeiten Emotionaler Kompetenz und dafür notwendige Rahmenbedingungen
- Methodik und Didaktik im Unterricht
- Vom Ganztagsangebot zum Lebensraum Schule
- Heterogenität im Gesamtschulsystem
- Schulsozialarbeit
- Trainingsprogramme
- Weitere förderliche Rahmenbedingungen und konkrete Fördermöglichkeiten
- Schlussteil
- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und daraus resultierende konkrete Folgerungen und Forderungen
- Schlussbilanz und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung emotionaler Kompetenz als Voraussetzung für soziale Kompetenz im Kontext der Hauptschule. Die Arbeit zielt darauf ab, den Förderbedarf an emotionaler und sozialer Kompetenz bei Hauptschülern aufzuzeigen und mögliche Förderansätze zu diskutieren.
- Bedeutung emotionaler Kompetenz für soziale Kompetenz
- Förderbedarf an emotionaler und sozialer Kompetenz an Hauptschulen
- Analyse bestehender Förderprogramme und -methoden
- Notwendige Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Förderung
- Zusammenhang zwischen familiärer Sozialisation und schulischen Möglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitungsteil: Die Einleitung begründet die Wahl des Themas, legt die persönliche Motivation und die gesellschaftliche Relevanz dar und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert den Forschungsfokus auf die emotionale und soziale Kompetenz an Hauptschulen und die Notwendigkeit ihrer Förderung.
Hauptteil I – Theoretischer Teil: Dieser Teil beinhaltet eine umfassende Auseinandersetzung mit den Begriffen der emotionalen und sozialen Kompetenz, untersucht deren Interdependenz anhand verschiedener theoretischer Ansätze und beleuchtet die Entwicklung dieser Kompetenzen im Jugendalter. Besonderes Augenmerk liegt auf der Situation an Hauptschulen, wo die Förderung dieser Kompetenzen von besonderer Bedeutung ist aufgrund der besonderen Herausforderungen dieser Schulform.
Hauptteil II – Methodischer & Empirischer Teil: Dieser Teil beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die auf qualitativen Experteninterviews basiert. Es werden die Auswahl der Experten, die Gestaltung des Leitfadens, die Durchführung und Auswertung der Interviews detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Interviews liefern Einblicke in die Perspektiven von Experten bezüglich des Förderbedarfs und möglicher Fördermaßnahmen für emotionale Kompetenz an Hauptschulen.
Schlüsselwörter
Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz, Hauptschule, Jugend, Sozialisation, Förderbedarf, Kompetenzförderung, Experteninterview, Qualitative Sozialforschung, Schulische Rahmenbedingungen, Familiäre Sozialisation, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Emotionale und Soziale Kompetenz an Hauptschulen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung emotionaler Kompetenz als Voraussetzung für soziale Kompetenz bei Hauptschülern. Sie analysiert den Förderbedarf und diskutiert mögliche Förderansätze an Hauptschulen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Interdependenz von emotionaler und sozialer Kompetenz, deren Entwicklung im Jugendalter und der besonderen Situation an Hauptschulen. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen familiärer Sozialisation und schulischen Möglichkeiten und analysiert bestehende Förderprogramme und -methoden. Ein empirischer Teil basiert auf qualitativen Experteninterviews, um Einblicke in den Förderbedarf und mögliche Fördermaßnahmen zu gewinnen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, basierend auf Experteninterviews. Die Auswahl der Experten, der Leitfaden, die Durchführung und die Auswertung der Interviews werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Experteninterviews liefern Einblicke in die Perspektiven von Experten bezüglich des Förderbedarfs und möglicher Fördermaßnahmen für emotionale Kompetenz an Hauptschulen. Die Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und leitet daraus konkrete Folgerungen und Forderungen ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz, Hauptschule, Jugend, Sozialisation, Förderbedarf, Kompetenzförderung, Experteninterview, Qualitative Sozialforschung, Schulische Rahmenbedingungen, Familiäre Sozialisation, Chancengleichheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen Einleitungsteil, einen theoretischen Hauptteil, einen methodischen und empirischen Hauptteil sowie einen Schlussteil. Der Einleitungsteil begründet das Thema und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Der theoretische Teil behandelt die Begriffe, die Interdependenz und die Entwicklung der Kompetenzen. Der methodisch-empirische Teil beschreibt die Methodik und Ergebnisse der Experteninterviews. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Förderbedarf an emotionaler und sozialer Kompetenz bei Hauptschülern aufzuzeigen und mögliche Förderansätze zu diskutieren. Sie untersucht die Bedeutung emotionaler Kompetenz für soziale Kompetenz und analysiert die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Förderung.
- Quote paper
- Amelie Singer (Author), 2006, Emotionale Kompetenz als Voraussetzung für soziale Kompetenz: (k)ein Thema an der Hauptschule?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63843