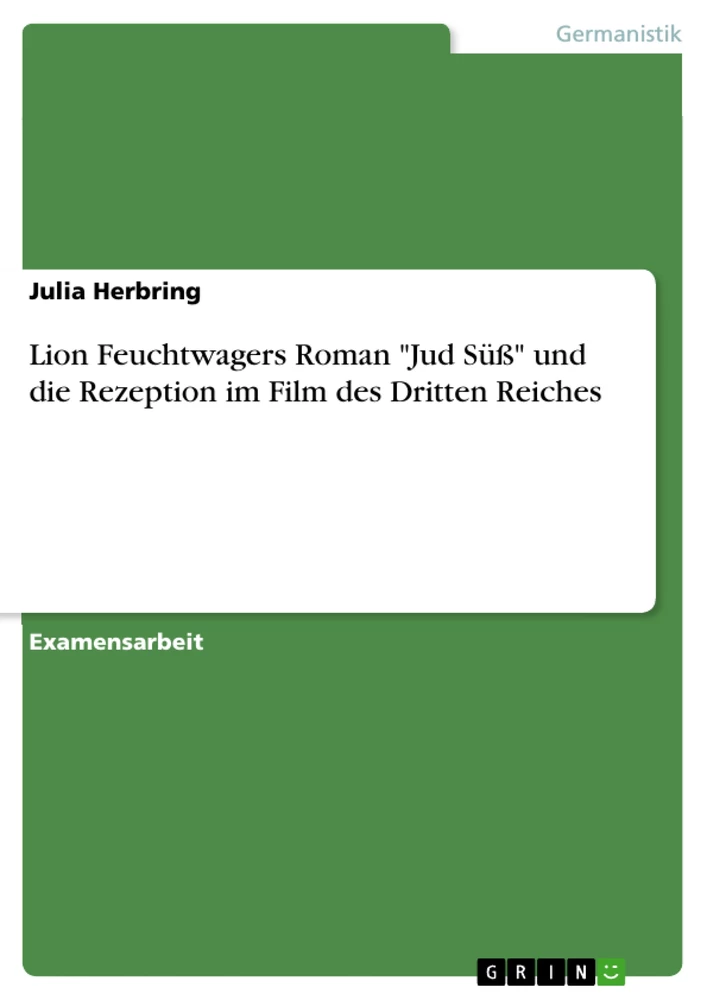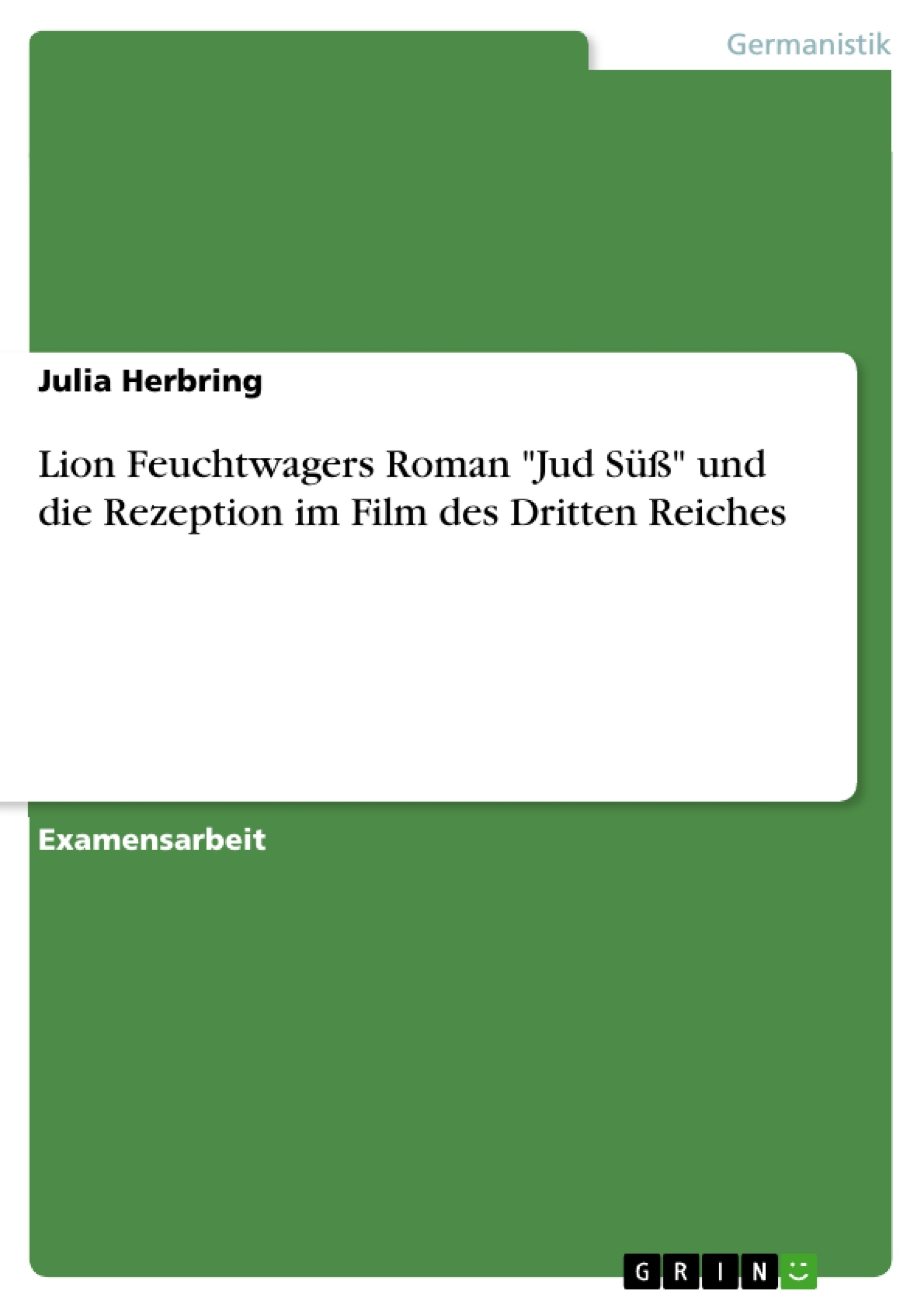Die Besonderheit des Romans ist nicht ein spezieller Sprachstil oder ein bestimmte Gattung, sondern vielmehr das Schicksal des Joseph Süß Oppenheimer - genannt Jud Süß -, der einen widersprüchlichen Weg durch die Gesellschaft geht, der mit dem Unheil endet, das viele Juden teilen: Süß muss als Sündenbock für die Gesellschaft herhalten. Da es keinerlei Beweise gibt, die seine Schuld verdeutlichen, kann man davon ausgehen, dass sein Tod kein juristischer ist, sondern, dass es sich bei seiner Erhängung um Mord handelt, der aus politischen Gründen und wohlüberlegt von den Landständen durchgeführt wird. Diese Besonderheiten wollen alle bei den Überlegungen zum Leben und Schicksal des Joseph Süß Oppenheimer einfließen. In dieser Arbeit werden die verschiedenen Umsetzungen der Thematik um den Juden verdeutlicht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Analyse der literarischen Bearbeitung von Lion Feuchtwanger, die zum Welterfolg avancierte. Des Weiteren beschäftigt sich die Arbeit mit den persönlichen Erfahrungen, die der Autor in seinem Werk einfließen lässt: sein jüdisches Selbstverständnis, seine Erlebnisse im Dritten Reich, der immer größer und schlimmer werdende Antisemitismus, der das Leben des Autors ebenso wie das Leben seines Protagonisten -nur eben zeitversetzt - in groben Maßen beeinflusst. Im Verlauf wird auf die Filme, die sich mit dem Jud Süß-Stoff beschäftigen, verwiesen. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts versuchen sich zwei Regisseure - Veit Harlan 1939 und Lothar Mendes 1934 - mit kongruenten Intentionen und Umsetzungen an der Verfilmung des Lebens des Joseph Süß Oppenheimers. Zu Beginn werden Vorüberlegungen getroffen, um zu verdeutlichen wie sich das Leben der Juden zu Lebzeiten des Joseph Süß Oppenheimers bis zum Erscheinen des Buches Jud Süß verändert hat. Welche prägnanten Erfahrungen mussten Juden mit dem Antisemitismus machen und die Überlegung wird angestellt, ob sie überhaupt eine Chance hatten, gleichberechtigt mit den Christen zu leben. Im Anschluss wird das Leben des Juden Joseph Ben Isacchar Süßkind Oppenheim beleuchtet, um eine Basis zu schaffen, wenn im Zusammenhang mit der Textanalyse des Romans von Lion Feuchtwanger und der Verfilmungen Harlans und Mendes die Frage aufkommt, wer Jud Süß wirklich war. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in die Thematik des Textes
- 2. Untersuchungen zum Judentum
- 2.1. Juden in Deutschland zu Lebzeiten des Joseph Süẞkind Oppenheim und bis zu Beginn des Dritten Reichs
- 2.2. Die Situation der Juden im Dritten Reich
- 3. Lion Feuchtwanger
- 3.1 Lion Feuchtwangers jüdisches Selbstverständnis
- 3.2 Lion Feuchtwangers Erfahrung mit dem Antisemitismus
- 4. Die historische Figur des Jud Süß: Joseph Ben Isacchar Süßkind Oppenheim
- 4.1 Das Leben des Joseph Süẞ Oppenheimer
- 4.2 Joseph Süß Oppenheimers Umgang mit seiner Religion
- 5. Analyse des Romans Jud Süß unter besonderer Berücksichtigung der Projektion von Feuchtwangers Erfahrungen mit dem Antisemitismus
- 5.1 Die Novelle von Wilhelm Hauff als Grundlage für Lion Feuchtwangers Roman
- 5.2 Der Begriff der Neuen Sachlichkeit
- 5.3 Der Roman
- 5.3.1 Die Entstehungsgeschichte
- 5.3.2 Die sprachliche Struktur des Textes
- 5.3.2.1 Der Ort des Geschehens
- 5.3.2.2 Die Zeit in der Jud Süẞ spielt
- 5.3.2.3 Die Erzählperspektive
- 5.3.2.4 Rhetorische Mittel und sprachliche Besonderheiten
- 5.3.2.5 Die Handlungsstränge
- 5.3.3 Die Personenkonstellationen
- 5.3.1 Joseph Süß Oppenheimer alias Jud Süß
- 5.3.2 Der Herzog Karl Alexander
- 5.3.3 Die Tochter Naemi
- 5.3.4 Rabbi Gabriel
- 5.3.5 Isaak Landauer
- 5.3.6 Magdalen Sybillen
- 5.3.7 Das Verhältnis zwischen Jud Süß und dem Herzog
- 5.3.4 Kommentare zum Roman
- 6. Die Rezeption im Film des Dritten Reiches
- 6.1 Die britische Verfilmung „Jew Suess“ von Lothar Mendes
- 6.2 Die deutsche Verfilmung „Jud Süß“ von Veit Harlan
- 6.3 Ein Vergleich der Filme von Mendes und Harlan
- 6.4 Lion Feuchtwangers Reaktion auf die Verfilmung Jud Süß
- 6.5 Der Film und der Roman – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 6.6 Der Prozess um den Regisseur Veit Harlan, Hamburg 1949
- 7. Projektionen des Autors auf seinen Titelhelden Jud Süß
- 8. Schlussfolgerung
- Das Schicksal des Joseph Süẞ Oppenheimer als Metapher für die Verfolgung von Juden im Dritten Reich
- Die Analyse der Projektionen von Lion Feuchtwangers persönlichen Erfahrungen mit dem Antisemitismus auf den Roman
- Der Einfluss von Wilhelm Hauffs Novelle "Jud Süß" auf Feuchtwangers Roman
- Die Unterschiede in der Verfilmung des Stoffes durch Lothar Mendes und Veit Harlan
- Die politische Instrumentalisierung des Jud Süß-Stoffes im Dritten Reich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die literarische Bearbeitung des Romans "Jud Süß" von Lion Feuchtwanger, insbesondere im Kontext der historischen Figur des Joseph Süẞ Oppenheimer und der Rezeption des Romans im Film des Dritten Reiches. Sie analysiert die komplexen Beziehungen zwischen literarischer Fiktion, historischer Realität und politischer Propaganda.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Besonderheit des Romans "Jud Süß" beleuchtet und den Kontext der historischen Figur des Joseph Süẞ Oppenheimer skizziert. Anschließend wird das Judentum in Deutschland im 18. Jahrhundert und im Dritten Reich untersucht, um die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, in denen der Roman angesiedelt ist. Das Kapitel über Lion Feuchtwanger analysiert seine persönlichen Erfahrungen mit dem Antisemitismus und sein jüdisches Selbstverständnis.
Das Kapitel über den historischen Joseph Süẞ Oppenheimer beleuchtet die Fakten seines Lebens und die Mythen, die ihn umgeben. Die Textanalyse des Romans "Jud Süß" befasst sich mit der Entstehung, der Sprache und den Personenkonstellationen. Der Einfluss von Wilhelm Hauffs Novelle wird ebenso berücksichtigt wie die Schreibmethode der Neuen Sachlichkeit. Das Kapitel über die Filmrezeption untersucht die unterschiedlichen Verfilmungen des Jud Süß-Stoffes durch Lothar Mendes und Veit Harlan und die politische Instrumentalisierung des Stoffes im Dritten Reich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Judenverfolgung, Antisemitismus, literarische Bearbeitung, historische Figuren, Filmrezeption, Propaganda, "Jud Süß", Lion Feuchtwanger, Joseph Süẞ Oppenheimer, Wilhelm Hauff, Neue Sachlichkeit, Veit Harlan, Lothar Mendes.
- Arbeit zitieren
- Julia Herbring (Autor:in), 2006, Lion Feuchtwagers Roman "Jud Süß" und die Rezeption im Film des Dritten Reiches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63908