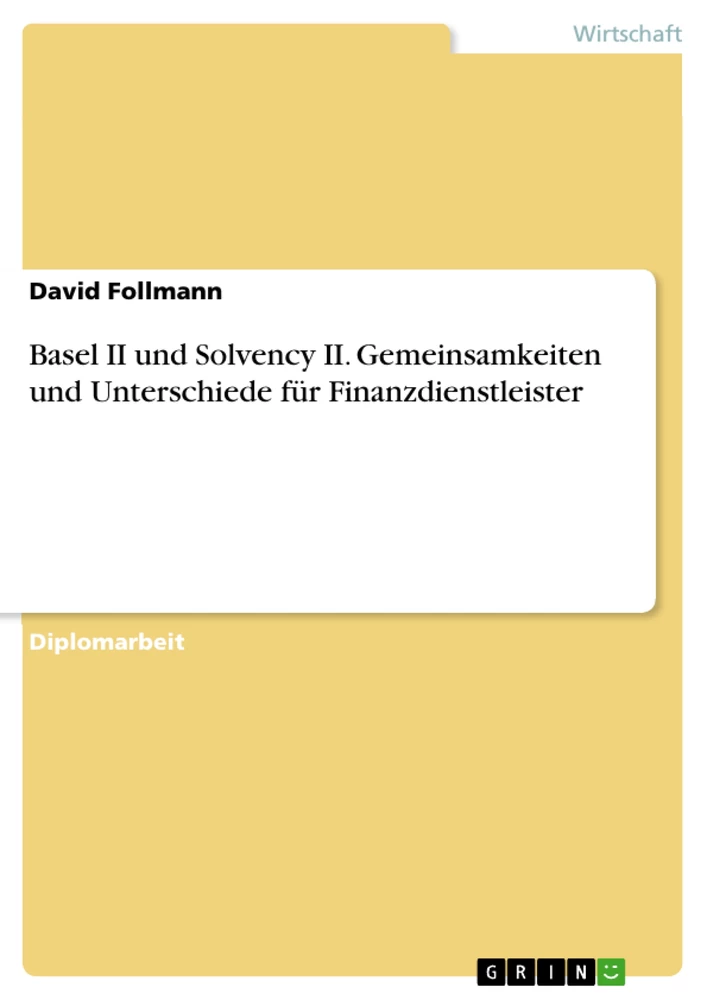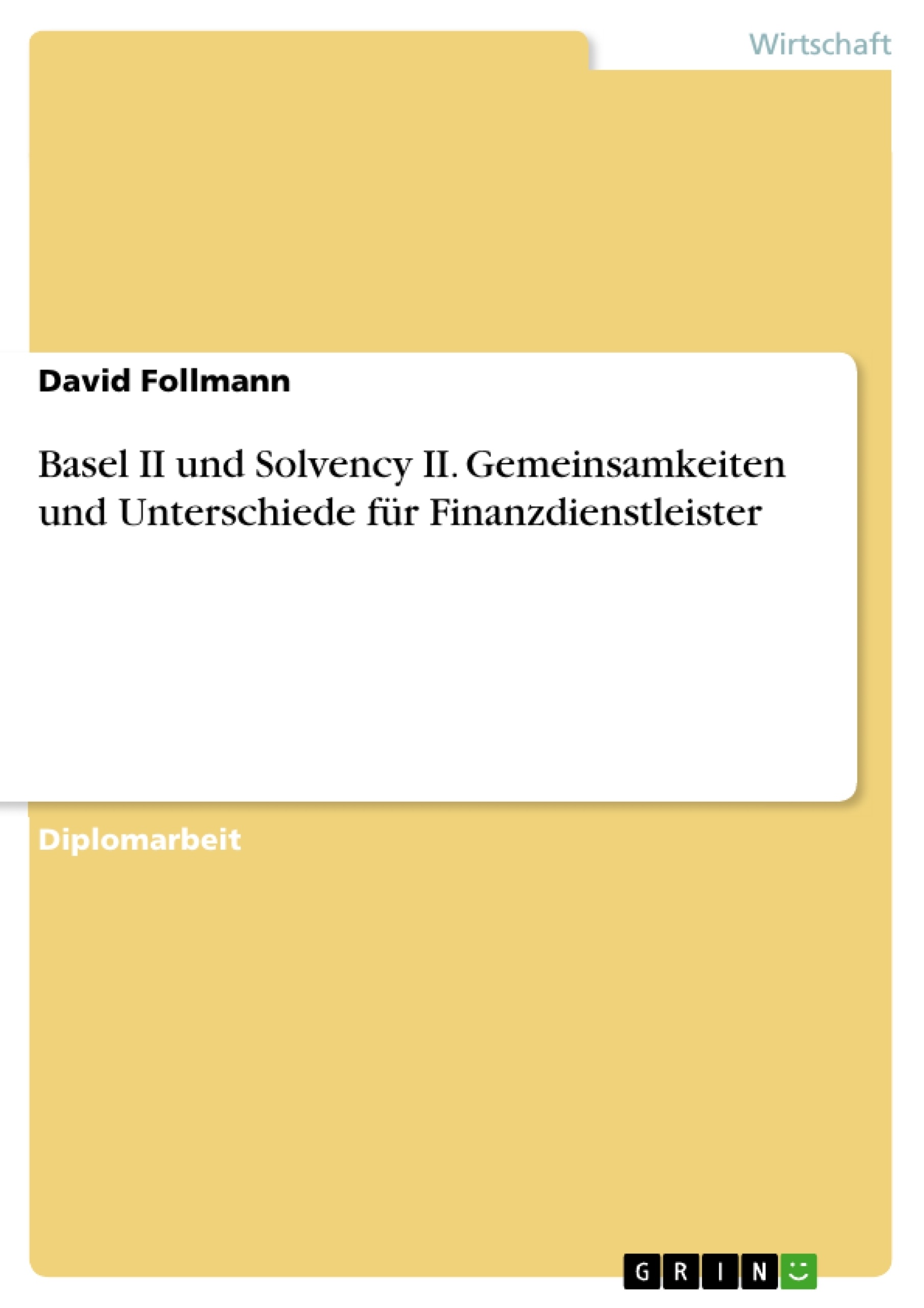Die Weltwirtschaft mit ihren einzelnen Volkswirtschaften befindet sich in einer beschleunigten Phase des Wandels. Die Globalisierung der Märkte und der Wettbewerb, gefördert durch die weltweite Vernetzung, verändern das Wesen der Wirtschaftssysteme. Moderne Kommunikationstechnologien steigern das technisch Mögliche und bewirken ein weltweites und ortsunabhängiges Operieren von Unternehmen und Institutionen.
Innerhalb dieser Ordnung nehmen Finanzsysteme eine entscheidende Rolle ein. Institutionen, meist Banken, regeln im Rahmen des Kapitalmarktes und als Finanzintermediär Angebot und Nachfrage von Geldkapital. Die Regelung zwischen Investitionen auf der einen und Ersparnissen auf der anderen Seite ist die zentrale Aufgabe des Finanzsektors, welcher somit als Kapitalvermittler auftritt. Die Stabilität der einzelnen Systeme ist für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von großer Relevanz. Eine stabile und wachsende Weltwirtschaft basiert auf dem Zusammenspiel funktionierender Finanzsysteme. In Verbindung mit der ökonomischen Bedeutung stehen auch die Vertrauensempfindlichkeit des Kreditgeschäfts und die Schutzbedürftigkeit der Anleger. Der Zusammenbruch eines nationalen Systems kann unter Umständen das gesamte Finanzsystem und damit auch die Weltwirtschaft gefährden. Vielfältige Finanzkrisen aus der Vergangenheit, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene, zeigen wie wichtig eine Absicherung durch die Regulierung der Rahmenbedingungen innerhalb des Finanzsektors ist und dass Schwachpunkte existieren.
Beispiele hierfür sind die Wirtschafts- und Finanzkrise Ostasiens 1997/1998, die Russlandkrise 1999 und das Platzen der Dotcom-Blase an den neuen Märkten im Jahr 2000. In allen Fällen führten verschiedenste Ursachen zu einem massiven Kapitalabfluss. Die Auswirkungen waren Liquiditätsengpässe und Insolvenzen bei den Banken. Aufgrund des hohen Verflechtungsgrades der Kredit- und Realwirtschaft ergeben sich Kettenreaktionen, die zunächst zu einem Übergriff auf andere Banken und anschließend zu einer Krise der gesamten Volkswirtschaft führen.
Die Solidität des internationalen Finanzsystems ist jedoch nicht nur von Banken abhängig. In Zeiten, in denen dieselben Märkte von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen umkämpft sind, muss die Betrachtung dieser Problematik auch auf die Versicherungswirtschaft ausgedehnt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Abgrenzung und Zielsetzung
- 1.3 Gang der Argumentation
- 1.4 Begriffsdefinitionen
- 2. Risiken in der Finanz- und Versicherungsbranche
- 2.1 Risikobegriff
- 2.2 Risiken des Bankgeschäftes
- 2.2.1 Kreditrisiken
- 2.2.2 Marktpreisrisiken
- 2.2.3 Das operationelle Risiko
- 2.3 Risiken des Versicherungsgeschäftes
- 2.3.1 Versicherungstechnische Risiken
- 2.3.2 Kapitalanlagerisiken
- 2.3.3 Asset-Liability-Mismatching
- 3. Basel II - Die neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarungen
- 3.1 Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
- 3.2 Gründe für neue Eigenkapitalregeln
- 3.3 Basel - Ein erster Schritt
- 3.4 Die Entwicklung von Basel II
- 3.5 Der Aufbau von Basel II
- 3.5.1 Säule - Mindestkapitalanforderungen
- 3.5.1.1 Der Standardansatz
- 3.5.1.2 Die IRB-Ansätze - Internal Ratings Based Approaches
- 3.5.1.3 Operationelles Risiko
- 3.5.1.4 Marktrisiko
- 3.5.2 Säule II - Bankenaufsichtlicher Überprüfungsprozess
- 3.5.3 Säule III - Erweiterte Offenlegung
- 3.6 Die Umsetzung von Basel II auf europäischer und nationaler Ebene
- 3.6.1 Die Rolle der Europäischen Union
- 3.6.2 Unterschiede der EU-Richtlinie zum Baseler Rahmenwerk
- 3.6.3 Die nationale Ebene der Umsetzung von Basel II
- 3.6.4 Die Einarbeitung der neuen Regeln im Kreditwesengesetz
- 3.6.5 Der Erlass der Solvabilitätsverordnung
- 3.6.6 Die ergänzende Verordnung der GroMiKV
- 3.6.7 Die Strukturen der MaRisk
- 3.6.7.1 Allgemeiner Teil
- 3.6.7.2 Besonderer Teil
- 3.7 Konsequenzen für die Institute aus Basel II
- 3.7.1 Auswirkungsstudie QIS 5
- 3.7.2 Anforderungen an Kosten und Ressourcen
- 3.7.3 Auswirkungen auf Kreditpreise
- 3.7.4 Auswirkungen auf den Wettbewerb
- 4. Solvency II – Aufsichtsmodell für die Versicherungswirtschaft
- 4.1 Gründe für ein neues Aufsichtsmodell
- 4.2 Die bisherige Situation in der Versicherungsaufsicht
- 4.2.1 Solo-Plus-Aufsicht
- 4.2.2 Vermögensanlage
- 4.2.3 Rückversicherungsaufsicht
- 4.3 Solvency I
- 4.3.1 Änderungen für Schadensversicherungsunternehmen
- 4.3.2 Änderungen für Lebensversicherungsunternehmen
- 4.3.3 Zielerreichung
- 4.4 Die Entwicklung von Solvency II
- 4.4.1 Die Chronologie und die Idee
- 4.4.2 Phase 1 - Der Aufbau der Rahmenbedingungen
- 4.4.3 Phase 2 - Die Ausgestaltung und Implementierung
- 4.5 Erste Säule
- 4.5.1 Modellierung des Kapitalanlagerisikos
- 4.5.2 Leben
- 4.5.3 Schaden
- 4.5.4 Kranken
- 4.6 Zweite Säule
- 4.6.1 Interne Kontrolle und Verwaltung
- 4.6.2 Risikomanagement
- 4.6.3 Zeichnungstätigkeit
- 4.6.4 Vertrags-, Schaden- und Rückstellungsmanagement
- 4.6.5 Aktiva- und Finanzmanagement
- 4.6.6 Rückversicherung
- 4.6.7 Sonstige Risiken
- 4.7 Dritte Säule
- 4.8 Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft
- 4.8.1 Impact Assessment Report
- 4.8.2 Erste quantitative Auswirkungsstudie zu Solvency II (QIS1)
- 4.8.3 Zweite quantitative Auswirkungsstudie zu Solvency II (QIS2)
- 5. Ein Vergleich der beiden Modelle
- 5.1 Gemeinsamkeiten von Basel II und Solvency II
- 5.2 Unterschiede von Basel II und Solvency II
- 5.3 Abgleich der Risikoarten
- 5.3.1 Kapitalanlagerisiko
- 5.3.2 Versicherungstechnisches Risiko contra Kreditrisiko
- 5.3.3 Operationelle Risiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den neuen Aufsichtsmodellen Basel II und Solvency II für Finanzdienstleistungsinstitute. Die Arbeit analysiert die beiden Modelle im Detail und zeigt auf, welche Auswirkungen sie auf die verschiedenen Bereiche der Finanz- und Versicherungsbranche haben.
- Risiken in der Finanz- und Versicherungsbranche
- Die Entwicklung und Struktur von Basel II und Solvency II
- Die Umsetzung der beiden Modelle auf europäischer und nationaler Ebene
- Die Auswirkungen von Basel II und Solvency II auf die Institute
- Ein Vergleich der beiden Modelle und ein Abgleich der Risikoarten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und legt die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel zwei befasst sich mit den verschiedenen Risiken, die in der Finanz- und Versicherungsbranche auftreten. Kapitel drei widmet sich den neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) und deren Aufbau, Entwicklung und Umsetzung. Kapitel vier behandelt das Aufsichtsmodell Solvency II für die Versicherungswirtschaft. Es wird die Entwicklung, der Aufbau und die Auswirkungen von Solvency II untersucht. Schließlich werden in Kapitel fünf die beiden Modelle miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Basel II, Solvency II, Finanzdienstleistungsinstitute, Risiken, Eigenkapitalanforderungen, Aufsichtsmodelle, Vergleich, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
- Arbeit zitieren
- David Follmann (Autor:in), 2006, Basel II und Solvency II. Gemeinsamkeiten und Unterschiede für Finanzdienstleister, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63967