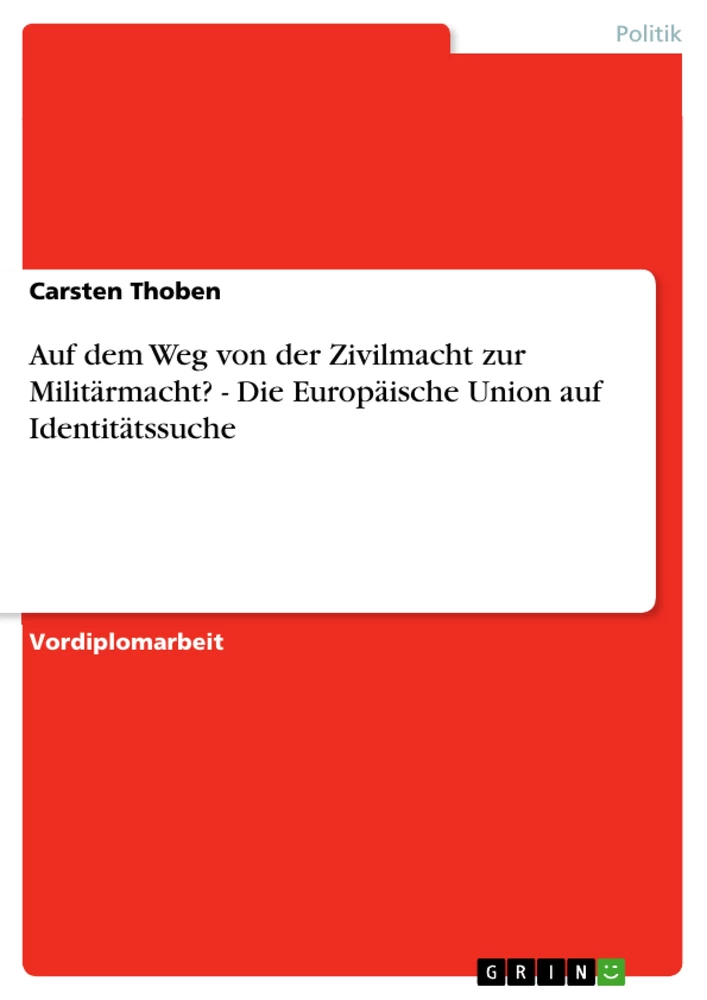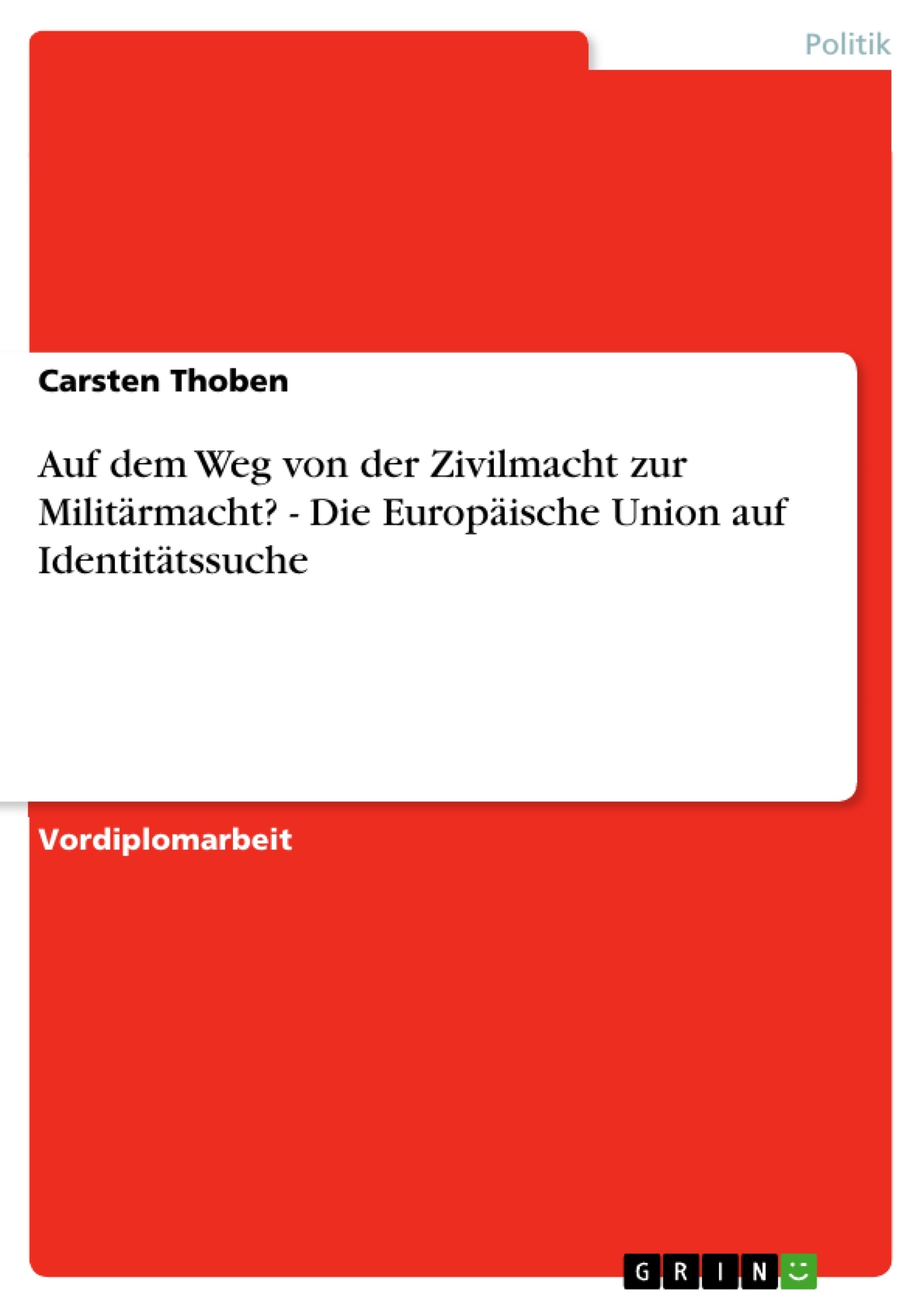Die ehemaligen britischen Premierminister Benjamin Disraeli (von 1874-1880) und Viscount Palmerson (von 1855-58 und 1859-65) sind schon im 19. Jahrhundert zu der Erkenntnis gekommen: „Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen.“ Der dominierenden realistischen Schule der internationalen Beziehungen zufolge sind Allianzen nicht mehr als temporäre Phänomene. Sie haben nur so lange Bestand, wie sie den Interessen der jeweiligen Mitglieder entsprechen.
Der Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa sorgte für neue sicherheitspolitische Verhältnisse. Europa war nicht länger auf den Schutz der USA und der NATO angewiesen, ein Angriff auf das eigene Territorium erschien höchst unwahrscheinlich. Doch nur langsam begibt sich die Europäische Union auf die Suche nach einer neuen sicherheits- und verteidigungspolitischen Identität, ein Unterfangen, das angesichts der Mitgliedschaft von nunmehr 27 Staaten schwer fällt. Jeder einzelne Staat verfügt über eigene nationale Interessen und es muss die Frage erlaubt sein, ob diese unter einem verteidigungspolitischen Dach zu vereinen sind.
Die Reaktion auf die Irak-Krise, die einen „Bruch mit historischen Kontinuitätslinien“ markierte und zu großen Differenzen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten führte, scheint auf den ersten Blick ein „Nein“ als Antwort zu rechtfertigen. Doch die europäischen Staats- und Regierungschefs sind im Angesicht der Krise offensichtlich zu der Einsicht gelangt, dass die EU mit einer Stimme sprechen müsse, um mit den USA in ihrer Position als wirtschaftlicher, aber auch sicherheits- und verteidigungspolitischer Supermacht konkurrieren zu können. In den vergangenen Jahren hat sich das Bild der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) drastisch verändert und wird „mit Lichtgeschwindigkeit“ vorangetrieben, wie es der EU-Außenbeauftragte Javier Solana formulierte.
Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte und Entwicklung sowie den Aufbau der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, setzt sich das Buch mit der Frage auseinander, ob Europa in seiner Identitätssuche auf dem Weg ist, sich vom Konzept der „Zivilmacht“ zu verabschieden. Aufgrund der Vielzahl von Texten und Dokumenten, die ausreichend Material für eine umfangreiche Diplomarbeit bieten würden, liegt das Hauptaugenmerk auf dem „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ sowie der Rede des deutschen Bundeskanzlers auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 12. Februar 2005.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) im Überblick
- Geschichte und Entwicklung der ESVP
- Der Aufbau der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Die „Zivilmacht Europa\" auf dem Weg zur Militärmacht?
- Der Einfluss von 9-11 und Irak-Krise auf die ESVP
- Die Europäische Sicherheitsstrategie
- Das „European Defence Paper”
- Der Vertrag über eine Verfassung für Europa
- Die verteidigungspolitische Identitätssuche am Beispiel der Rede von Bundeskanzler Schröder auf der Münchner Sicherheitskonferenz
- Der Inhalt der Rede
- Reaktionen auf die Rede Schröders und die Diskussion über die zukünftige Identität Europas
- Der Einfluss von 9-11 und Irak-Krise auf die ESVP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob die Europäische Union auf dem Weg ist, sich von der Rolle der „Zivilmacht“ zu verabschieden und eine stärkere militärische Identität anzunehmen. Sie analysiert die Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) im Kontext der Irak-Krise, der „Europäischen Sicherheitsstrategie“ sowie des „European Defence Paper“. Der Fokus liegt dabei auf dem „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ und einer Rede von Bundeskanzler Schröder auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um die Identitätsfindungsprozesse der EU in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beleuchten.
- Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
- Einfluss der Irak-Krise auf die ESVP
- Europäische Sicherheitsstrategie
- „Vertrag über eine Verfassung für Europa“
- Identitätsfindungsprozesse der EU in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Analyse dar, indem sie die historischen und aktuellen Herausforderungen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beleuchtet. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die Geschichte und Entwicklung der ESVP, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung der NATO und der WEU sowie der Herausforderungen der gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik liegt. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Frage der „Zivilmacht Europa“ und analysiert den Einfluss von 9/11 und der Irak-Krise auf die ESVP. Es untersucht die „Europäische Sicherheitsstrategie“, das „European Defence Paper“ sowie den „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ als wichtige Meilensteine in der Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Darüber hinaus werden die Reaktionen auf eine Rede von Bundeskanzler Schröder auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2003 betrachtet, um die Diskussion über die zukünftige Identität Europas zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ESVP, NATO, WEU, Irak-Krise, „Zivilmacht“, Militärmacht, Identitätssuche, Europäische Sicherheitsstrategie, „European Defence Paper“, Vertrag über eine Verfassung für Europa, Münchner Sicherheitskonferenz
- Quote paper
- Carsten Thoben (Author), 2005, Auf dem Weg von der Zivilmacht zur Militärmacht? - Die Europäische Union auf Identitätssuche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64087