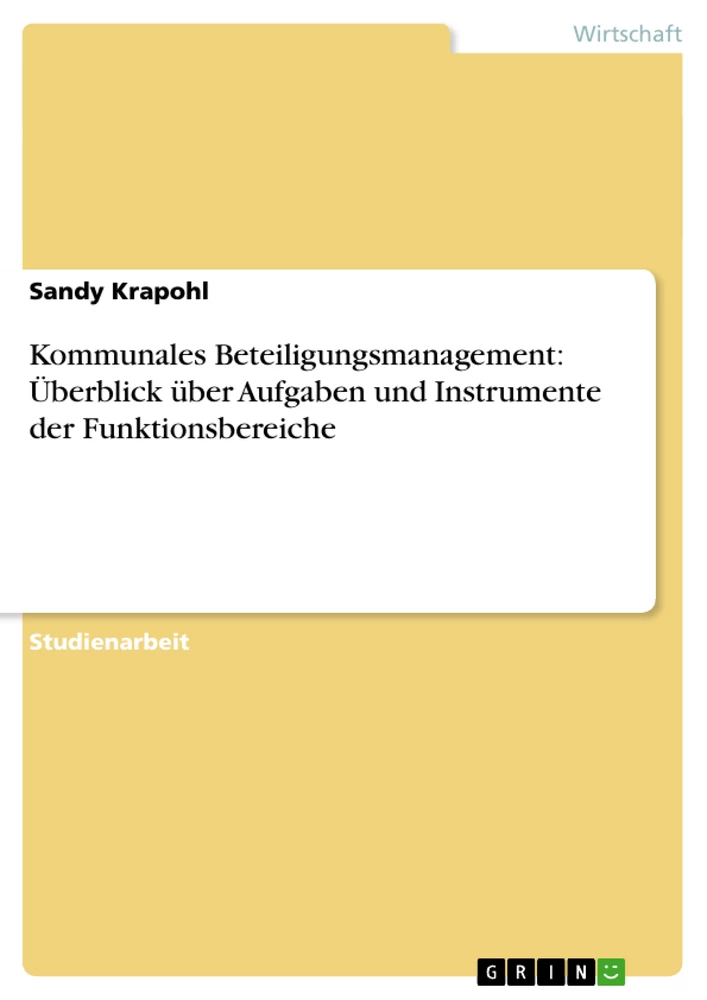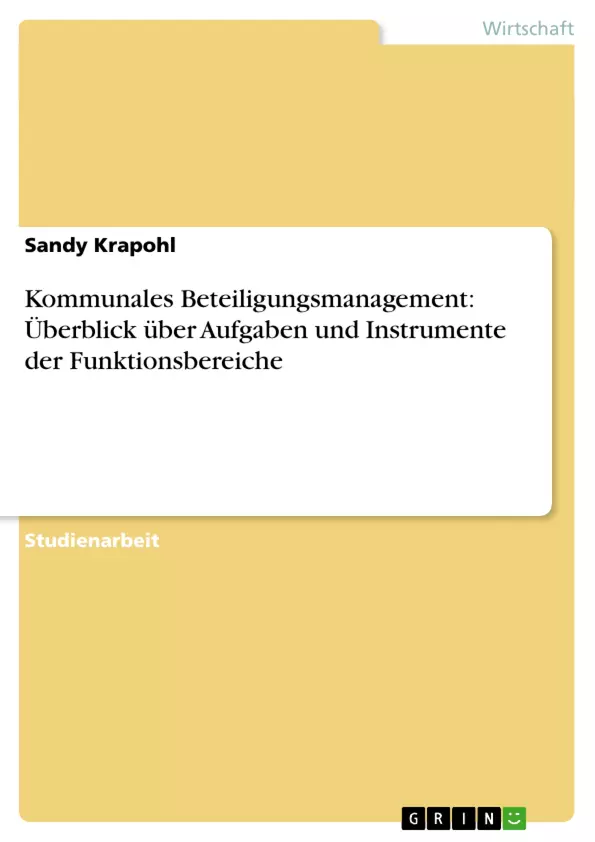Die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Kommunen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Insbesondere die schlechte Finanzsituation und die stetig wachsenden Aufgaben der öffentlichen Hand haben die Kommunen und Städte dazu veranlasst, vermehrt Teile ihrer Aufgabenerfüllung aus der Kommunalverwaltung in öffentlich-rechtliche oder privat-rechtliche Organisationsformen auszugliedern oder an Dritte zu übertragen. Ursprünglich betraf dies vor allem die Aufgabenbereiche der Daseinsvorsorge und Randbereiche der Verwaltung wie das Gebäudemanagement. Heute werden in wachsendem Maße auch typische Kernbereiche wie Wirtschaftsförderung und Kultur ausgegliedert. In der Praxis werden zunehmend kommunale Eigenbetriebe in privatrechtliche Organisationsformen, vorzugsweise in die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Diese sind von kommunalen Gesetzen unabhängig und verfügen über eine eigene Personalhoheit.
Die kommunalen Beteiligungen sind von hoher finanzwirtschaftlicher Bedeutung für die Kommune. In ihnen sind öffentliche Gelder gebunden, die oft die im Kernhaushalt gebundenen Finanzmittel übersteigen. Nach Möglichkeit sollen diese Unternehmen einen positiven Beitrag zum kommunalen Haushalt erwirtschaften. Aus dieser Zielsetzung und der öffentlichen Aufgabenverantwortung heraus ergibt sich die Notwendigkeit, die kommunalen Beteiligungen aktiv zu steuern und mögliche Synergieeffekte zu nutzen. Im Rahmen eines professionellen Beteiligungsmanagements kann die Kommune sicherstellen, dass die Beteiligungsunternehmen die ihnen übertragenen öffentlichen Aufgaben den quantitativen, qualitativen und finanziellen Vorgaben entsprechend erbringen. Dabei sollte aber auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Selbständigkeit der Unternehmen einerseits und der Einflussnahme der Kommune durch steuernde und kontrollierende Maßnahmen andererseits geachtet werden.
Nach der Klärung des Begriffs kommunale Beteiligungen wird das Beteiligungsmanagement in Kommunen kurz erläutert. Im Anschluss werden die jeweiligen Aufgaben und Instrumente der drei Funktionsbereiche des kommunalen Beteiligungsmanagements - Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsträgerbetreuung - beschrieben. Abschließend erfolgt die Betrachtung der organisatorischen Einbindung des Beteiligungsmanagements. Abhängig von der Zielsetzung der Beteiligungspolitik sollte es entweder innerhalb oder außerhalb der Verwaltung angesiedelt sein.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung - „Der Trend zur Ausgliederung kommunaler Aufgaben und die Notwendigkeit eines professionellen Beteiligungsmanagements“
- Grundlagen und Begriffe
- Kommunale Beteiligungen
- Beteiligungsmanagement in Kommunen
- Funktionsbereiche des Beteiligungsmanagements
- Beteiligungsverwaltung
- Vielfältige Aufgaben
- Instrumente
- Beteiligungscontrolling - Steuerung der Beteiligungen
- Begriffsklärung
- Aufgaben des strategischen und operativen Controlling
- Steuerungsinstrumente
- Mandatsträgerbetreuung
- Notwendige Voraussetzungen
- Fachliche Unterstützung der Mandatsträger
- Organisation von Schulungen
- Beteiligungsverwaltung
- Organisatorische Einbindung des Beteiligungsmanagements in der Praxis
- Verwaltungsinterne Organisation
- Verwaltungsexterne Organisation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem kommunalen Beteiligungsmanagement und verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Aufgaben und Instrumente dieses wichtigen Funktionsbereichs zu geben. Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit eines professionellen Beteiligungsmanagements im Kontext der Ausgliederung kommunaler Aufgaben und der Bedeutung der kommunalen Unternehmen für die städtische Finanzwirtschaft. Darüber hinaus werden die wichtigsten Funktionsbereiche, ihre Aufgaben und Instrumente, sowie die organisatorische Einbindung des Beteiligungsmanagements beleuchtet.
- Steigende Ausgliederung kommunaler Aufgaben und die Notwendigkeit eines professionellen Beteiligungsmanagements
- Funktionsbereiche des Beteiligungsmanagements: Verwaltung, Controlling und Mandatsträgerbetreuung
- Aufgaben und Instrumente der einzelnen Funktionsbereiche
- Organisatorische Einbindung des Beteiligungsmanagements: Verwaltungsinterne und Verwaltungsexterne Strukturen
- Die Rolle der Kommunen als Anteilseigner und die Interessenvertretung der Bürger in den kommunalen Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den aktuellen Trend der Ausgliederung kommunaler Aufgaben und die Bedeutung eines professionellen Beteiligungsmanagements vor. Sie verdeutlicht, dass kommunale Beteiligungen eine wesentliche Rolle für die kommunale Finanzwirtschaft spielen.
- Das Kapitel „Grundlagen und Begriffe“ definiert den Begriff der kommunalen Beteiligungen und erläutert die Aufgaben des Beteiligungsmanagements in Kommunen.
- Das Kapitel „Funktionsbereiche des Beteiligungsmanagements“ beschreibt die drei wichtigsten Funktionsbereiche: Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsträgerbetreuung. Hier werden jeweils die relevanten Aufgaben und Instrumente vorgestellt.
- Das Kapitel „Organisatorische Einbindung des Beteiligungsmanagements in der Praxis“ diskutiert die möglichen Organisationsformen des Beteiligungsmanagements innerhalb und außerhalb der Verwaltung.
Schlüsselwörter
Kommunales Beteiligungsmanagement, Aufgaben, Instrumente, Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling, Mandatsträgerbetreuung, Verwaltungsinterne Organisation, Verwaltungsexterne Organisation, Ausgliederung, kommunale Unternehmen, Finanzwirtschaft, öffentliche Aufgabenverantwortung, Einflussnahme, Selbständigkeit, Steuerungsinstrumente.
- Quote paper
- Diplom-Betriebswirtin Sandy Krapohl (Author), 2005, Kommunales Beteiligungsmanagement: Überblick über Aufgaben und Instrumente der Funktionsbereiche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64107