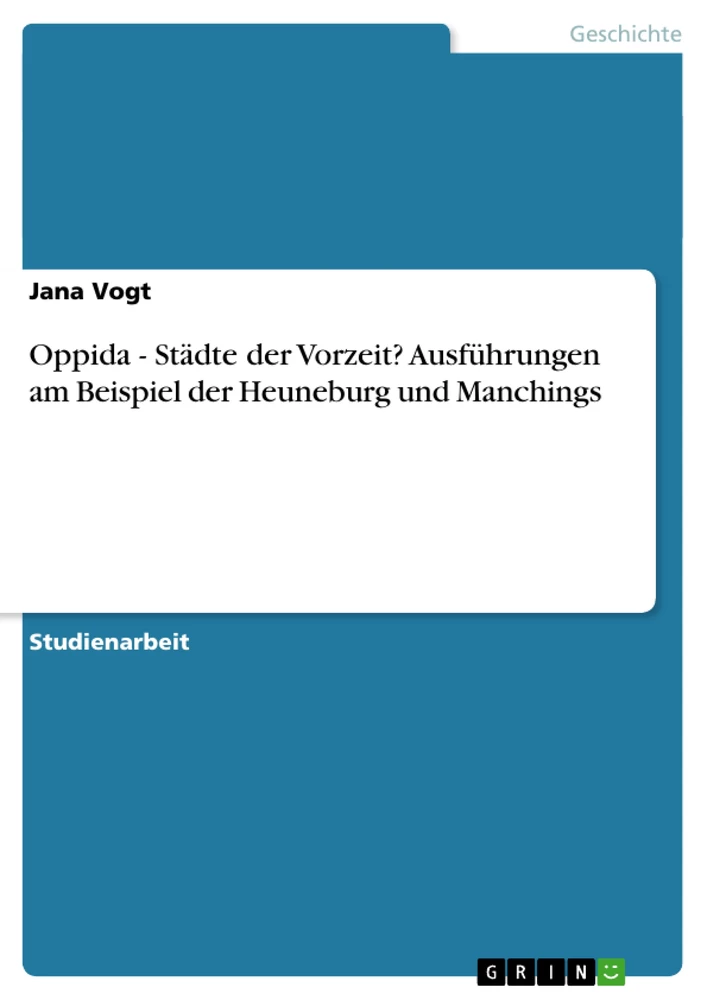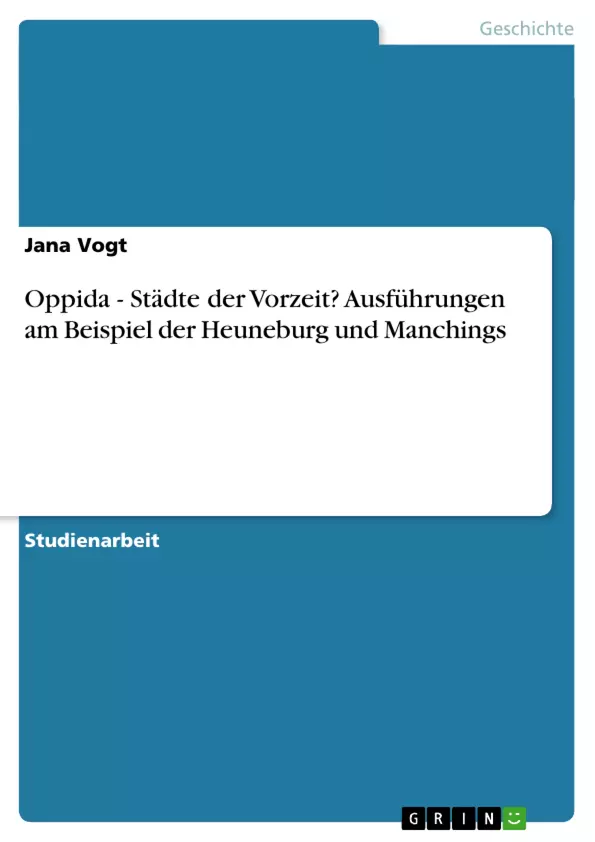[...] Um die eingangs gestellte Frage beantworten zu können, muss zunächst sowohl der Begriff Oppidum als auch der Terminus Stadt einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Oppidum, aus dem Lateinischen übersetzt, bedeutet Feste, geschützter Ort (Döbler 2000, 216), ebenso kleine Landstadt ohne besonderen Rechtsstatus (Fries-Knoblach 2002, 111). Im archäologischen Sinne bezeichnet dieser Terminus Großsiedlung Merkmalen des 2. und 1. Jh.s v. Chr. (RGA 22, 131ff.), der von den Kelten geprägten Spätlatènezeit. Als klassisches Beispiel gilt Manching, welches aufgrund kontinuierlicher Besiedlungsbedingungen am längsten existierte. Es entstand wie viele andere Oppida im heutigen Bayern durch die Ost- bzw. Südexpansion der Kelten zu Beginn des 4. Jh.s v. Chr. (Sievers 1999, 7; Fries-Knoblach 2002, 106f.). Bisweilen werden auch die hallstattzeitlichen Fürstensitze wie etwa die Heuneburg, die ihre Hauptbesiedlungszeit ab der Mitte des 7. Jh.s v. Chr. bis zum Beginn des 4. Jh.s v. Chr. hatten, unter der Begrifflichkeit Oppidum geführt. Hekataios von Milet berichtet um 550 v. Chr. zum ersten Mal von den „Keltoi“: “Massalia, eine Stadt Liturgiens in der Gegend des Keltenlandes, eine Kolonie der Phönikaier.“ (Éluère 1994, 131) Massalia entspricht dem heutigen Marseille. Herodot schrieb dann in seinen „Historien“ um 450 v. Chr.: “Die Donau entspringt im Keltenlande bei der Stadt Pyrene…die Kelten aber leben außerhalb der Säulen des Herakles 1 , sie grenzen an die Kynesier an, die unter allen Bewohnern im äußersten Westen wohnen.“ (Éluère 1994, 131). Somit beweisen beide griechischen Autoren, dass schon während der späten Hallstattzeit in Baden-Württemberg von Kelten zu sprechen ist (Schußmann 2000, 9). Der Begriff Oppidum, welcher als Synonym für die befestigten Siedlungen der Kelten gilt, lässt sich folglich auf die Fürstensitze anwenden. zumal sie einen identischen Charakter wie latènezeitliche Oppida besaßen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- örtliche Begebenheit
- soziales Gefüge
- Bevölkerungsballung
- Verwaltungszentrum
- kultisches und sakrales Zentrum
- Handwerk/Gewerbe
- Handel
- Münzwesen
- Verteidigung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob „Oppida“ als „vorzeitliche“ Städte in Mitteleuropa betrachtet werden können. Die Autorin untersucht diese Frage am Beispiel der Heuneburg und Manchings und analysiert, inwieweit diese Siedlungen die Kriterien einer Stadt im mittelalterlichen Sinne erfüllen.
- Definition des Begriffs Oppidum
- Charakteristik einer Stadt im mittelalterlichen Sinne
- Vergleich der Heuneburg und Manchings mit den Stadtkriterien
- Untersuchung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen hallstattzeitlichen und latènezeitlichen Oppida
- Bedeutung der Oppida im Kontext der keltischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Autorin stellt die Forschungsfrage und definiert die Begriffe Oppidum und Stadt. Sie skizziert die historische Entwicklung der beiden Begriffe und erläutert die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition für Oppida in der Vorzeit zu finden.
- örtliche Begebenheit: Dieses Kapitel behandelt die geographische Lage der Heuneburg und Manchings und analysiert die Bedeutung der jeweiligen Umgebung für die Entwicklung der Siedlungen.
- soziales Gefüge: Hier geht es um die soziale Organisation der beiden Oppida. Die Autorin untersucht die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ihre Rolle im gesellschaftlichen System.
- Bevölkerungsballung: In diesem Kapitel wird die Bevölkerungsdichte der beiden Oppida im Vergleich zum Umland betrachtet. Die Autorin analysiert, ob die Größe und die Bevölkerungszahl der Oppida die Kriterien einer Stadt erfüllen.
- Verwaltungszentrum: Dieses Kapitel untersucht die administrative Funktion der Heuneburg und Manchings. Die Autorin befasst sich mit der Frage, ob es in den Oppida eine zentrale Verwaltung gab und welche Rechte und Pflichten diese hatte.
- kultisches und sakrales Zentrum: Hier geht es um die religiöse Bedeutung der Heuneburg und Manchings. Die Autorin untersucht die Bedeutung von Kultstätten und religiösen Ritualen in der Gesellschaft der Oppida.
- Handwerk/Gewerbe: Dieses Kapitel analysiert die handwerkliche und gewerbliche Produktion in den Oppida. Die Autorin untersucht die Spezialisierung und die Bedeutung des Handwerks für die Wirtschaft der Siedlungen.
- Handel: Hier wird der Handel der Oppida beleuchtet. Die Autorin untersucht die Handelsbeziehungen und den Einfluss des Handels auf die Entwicklung der Siedlungen.
- Münzwesen: In diesem Kapitel befasst sich die Autorin mit dem Münzwesen in den Oppida. Sie analysiert die Rolle des Münzwesens in der Wirtschaft und der Gesellschaft der Siedlungen.
- Verteidigung: Hier untersucht die Autorin die Verteidigungsanlagen der Oppida. Sie analysiert die Bedeutung der Befestigungen und die Rolle des Militärs in der Gesellschaft der Siedlungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Stadtarchäologie, speziell im Kontext der keltischen Kultur. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Oppidum, Stadt, Hallstattzeit, Latènezeit, Heuneburg, Manching, Fürstensitz, Verwaltungszentrum, kultisches Zentrum, Handwerk, Handel, Münzwesen, Verteidigung und Bevölkerungsballung. Die Arbeit zeichnet sich durch eine interdisziplinäre Herangehensweise aus, die archäologische, historische und soziologische Perspektiven vereint.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Oppidum im archäologischen Sinne?
Im archäologischen Sinne bezeichnet der Terminus Oppidum befestigte Großsiedlungen der Spätlatènezeit (2. und 1. Jahrhundert v. Chr.), die maßgeblich von der keltischen Kultur geprägt wurden.
Was sind die bekanntesten Beispiele für Oppida in dieser Untersuchung?
Als zentrale Beispiele werden die Heuneburg (ein hallstattzeitlicher Fürstensitz) und Manching (ein klassisches spätlatènezeitliches Oppidum) herangezogen.
Können Oppida als "vorzeitliche Städte" bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage, indem sie die Siedlungen anhand von Kriterien wie Bevölkerungsballung, Verwaltungsfunktion, Handwerksspezialisierung und Verteidigungsanlagen mit dem mittelalterlichen Stadtbegriff vergleicht.
Welche Rolle spielte das Handwerk in den Oppida?
Das Handwerk war ein zentraler Wirtschaftsfaktor. In den Oppida gab es eine starke Spezialisierung und gewerbliche Produktion, die über den Eigenbedarf hinausging und den Handel förderte.
Wann entstanden die ersten Oppida im heutigen Bayern?
Viele Oppida in Bayern, wie etwa Manching, entstanden durch die Ost- bzw. Südexpansion der Kelten zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr.
Welche Bedeutung hatten sakrale Zentren in diesen Siedlungen?
Oppida dienten oft als kultische und sakrale Zentren, in denen religiöse Rituale und Kultstätten eine wichtige Rolle für den sozialen Zusammenhalt der keltischen Gesellschaft spielten.
- Quote paper
- Jana Vogt (Author), 2004, Oppida - Städte der Vorzeit? Ausführungen am Beispiel der Heuneburg und Manchings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64135