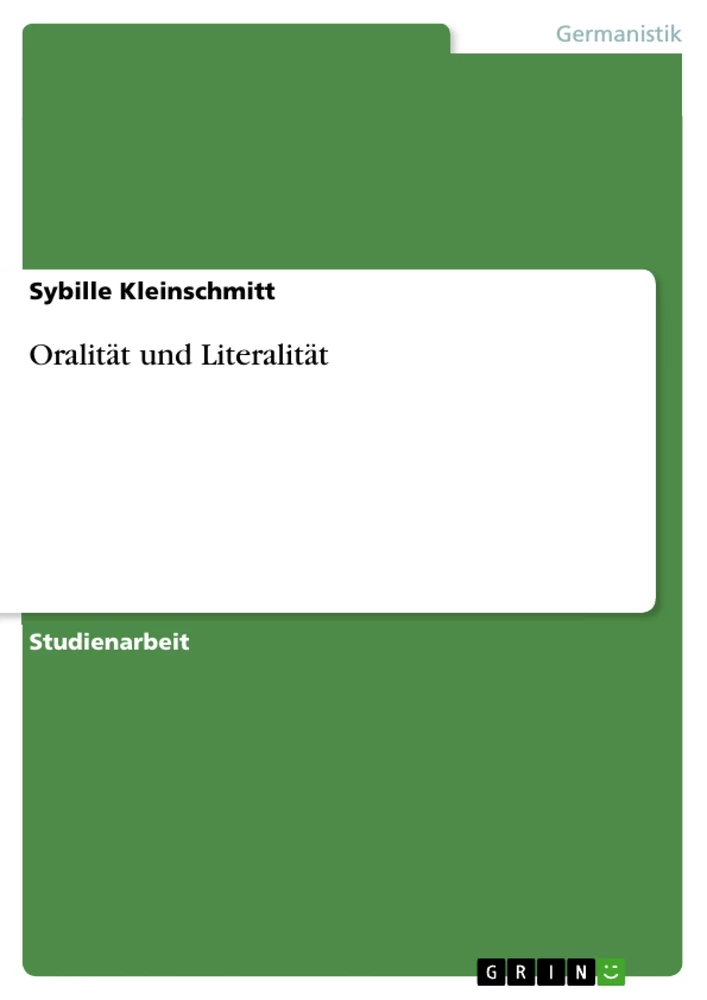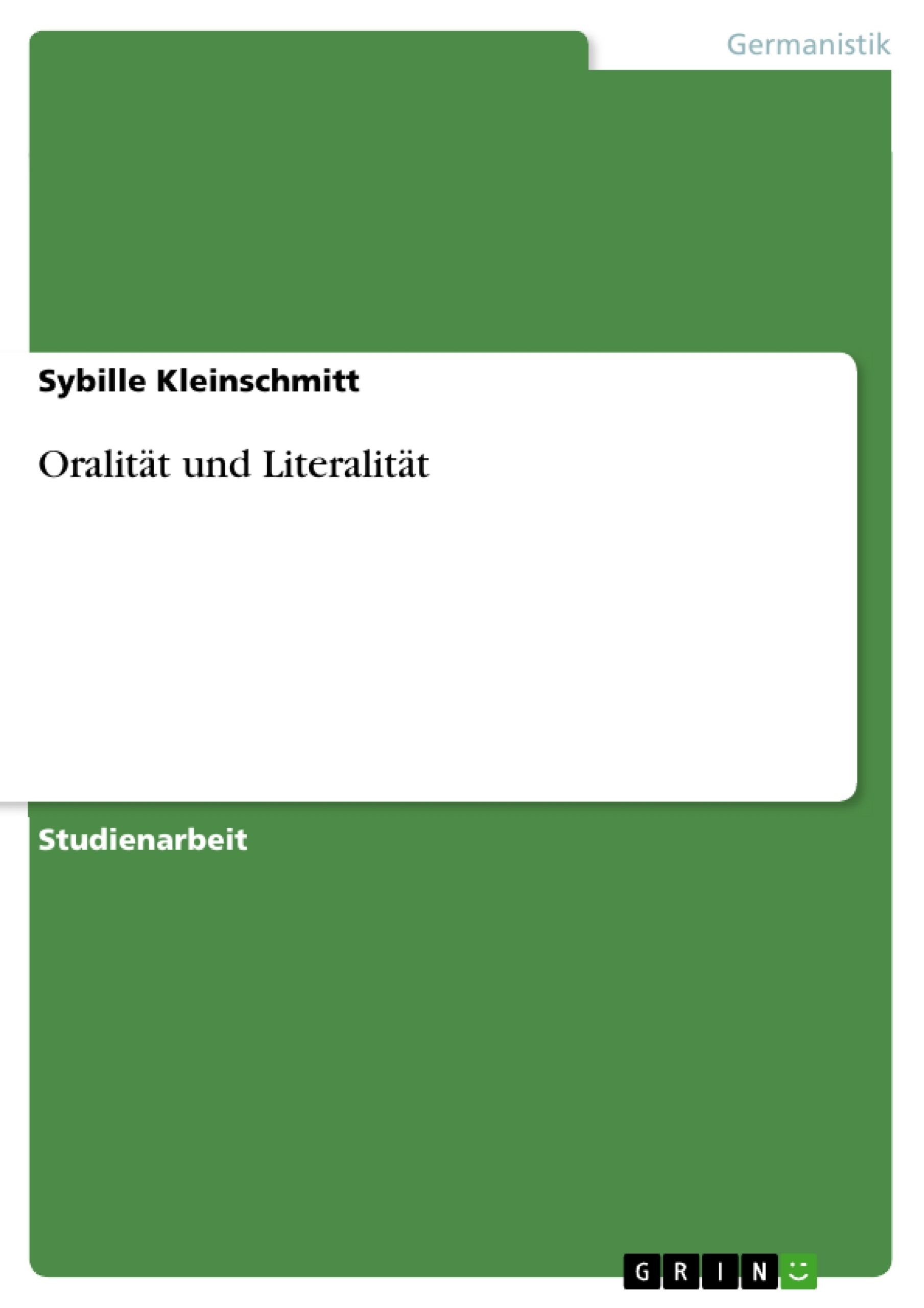Eine kurze, aber hilfreiche Abhandlung über die Entstehung und Entwicklung von Schrift und literalen Kulturen - von den ersten Höhlenmalereien bis zur E-mail und Emoticons. Ideal für Studierende der Germanistik im Grundstudium.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Orale Kulturen
- III. Entwicklungsgeschichte der Schrift
- III. 1. 2.) Definitionen
- III. 2.) Piktographische Schriftsysteme
- III. 3.) Das phonetische Schriftsystem
- IV. Platos Schriftkritik im „Phaidros“
- IV. 1.) Kritikpunkte
- VI. 2.) Erläuterungen
- V. Die Bedeutung der Schrift
- VI. Die Schrift im Wandel der Zeiten (Typographische Schriftsysteme)
- VI. 1.) Der Gutenberg-Druck
- VI. 2.) Digitalisierung von Schrift
- VI. 3.) Das elektronische Zeitalter
- VI. 3.1.) E-mail
- VII. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit Oralität und Literalität und untersucht die Entstehung und Entwicklung beider Phänomene. Die Autorin beschreibt zunächst orale Kulturen und ihre Kennzeichen, wobei sie sich auf die Forschungsarbeiten von Eric Havelock und Jack Goody bezieht. Anschließend beleuchtet sie die Entwicklungsgeschichte der Schrift, von den Ursprüngen der externen Informationsspeicherung über piktographische Schriftsysteme bis hin zur Einführung des griechischen Alphabets und den Folgen der Alphabetisierung. Platos Schriftkritik im „Phaidros“ wird analysiert, um die ambivalenten Aspekte der Schrift zu beleuchten.
- Die Merkmale oraler Kulturen
- Die Entwicklung der Schrift
- Die Bedeutung von Schrift für das menschliche Denken
- Die Folgen der Alphabetisierung
- Die Schrift im Wandel der Zeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Themen und Ziele der Arbeit, die sich mit dem Verhältnis von Oralität und Literalität befassen.
- II. Orale Kulturen: Dieses Kapitel untersucht die Kennzeichen oraler Kulturen anhand der Theorien von Eric Havelock und Jack Goody. Es werden die besonderen mentalen Strukturen, die selektive Wissensüberlieferung und die Rolle des Geschichtenerzählers in oralen Gesellschaften beleuchtet.
- III. Entwicklungsgeschichte der Schrift: Das Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Schrift, beginnend mit den Anfängen der externen Informationsspeicherung und den verschiedenen Schriftsystemen.
- IV. Platos Schriftkritik im „Phaidros“: In diesem Kapitel wird Platos kritische Auseinandersetzung mit der Schrift in seinem Dialog „Phaidros“ analysiert.
- V. Die Bedeutung der Schrift: Dieses Kapitel widmet sich der allgemeinen Bedeutung der Schrift für das menschliche Denken und die Entwicklung der Gesellschaft.
- VI. Die Schrift im Wandel der Zeiten (Typographische Schriftsysteme): Das Kapitel behandelt die Veränderungen der Schrift im Laufe der Geschichte, beginnend mit der Erfindung des Gutenberg-Drucks und der Digitalisierung von Schrift.
Schlüsselwörter
Orale Kulturen, Literalität, Schriftgeschichte, Alphabetisierung, Platos Schriftkritik, Gutenberg-Druck, Digitalisierung von Schrift, elektronisches Zeitalter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Oralität und Literalität?
Oralität bezeichnet Kulturen, die primär auf mündlicher Überlieferung basieren, während Literalität Gesellschaften beschreibt, in denen Schriftlichkeit das Denken und Handeln prägt.
Wie entwickelte sich die Schrift historisch?
Die Entwicklung verlief von frühen Höhlenmalereien über piktographische Systeme bis hin zum phonetischen Alphabet, das Informationen effizient speichert.
Warum kritisierte Plato die Schrift im „Phaidros“?
Plato befürchtete, dass die Schrift das Gedächtnis schwäche und nur den Anschein von Weisheit vermittle, ohne echtes Verständnis im Dialog zu fördern.
Welchen Einfluss hatte der Gutenberg-Druck?
Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte die Massenverbreitung von Wissen und markierte den Beginn eines neuen Zeitalters der Literalität.
Wie verändert die Digitalisierung unsere Schriftkultur?
Digitale Kommunikation wie E-Mails und Emoticons führt zu einer Hybridform zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, oft als „sekundäre Oralität“ bezeichnet.
- Quote paper
- Sybille Kleinschmitt (Author), 2005, Oralität und Literalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64160