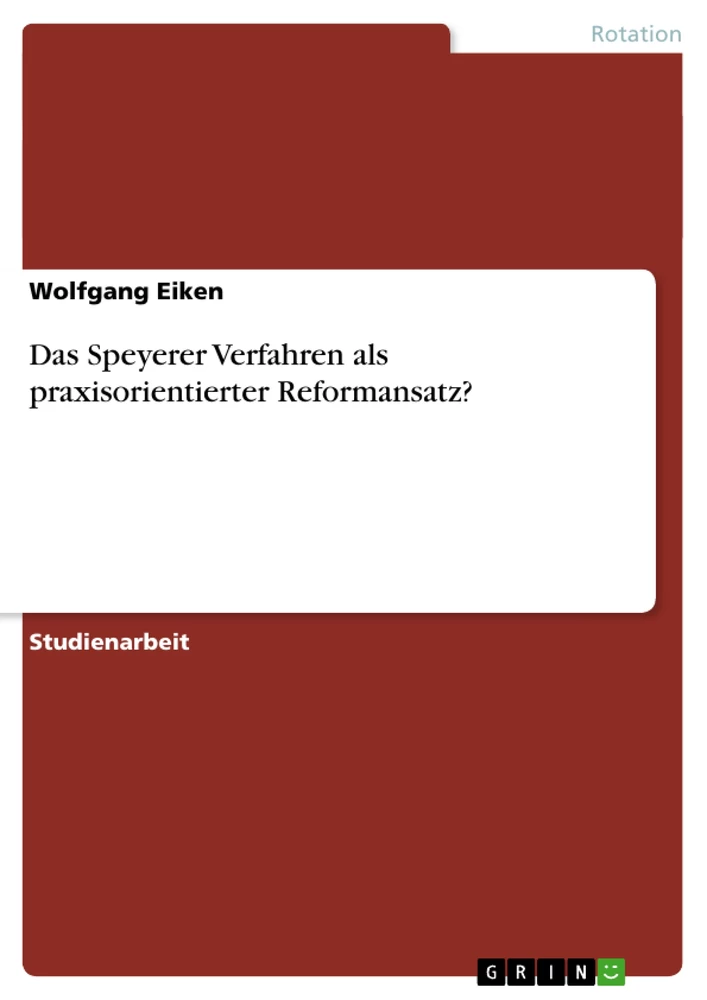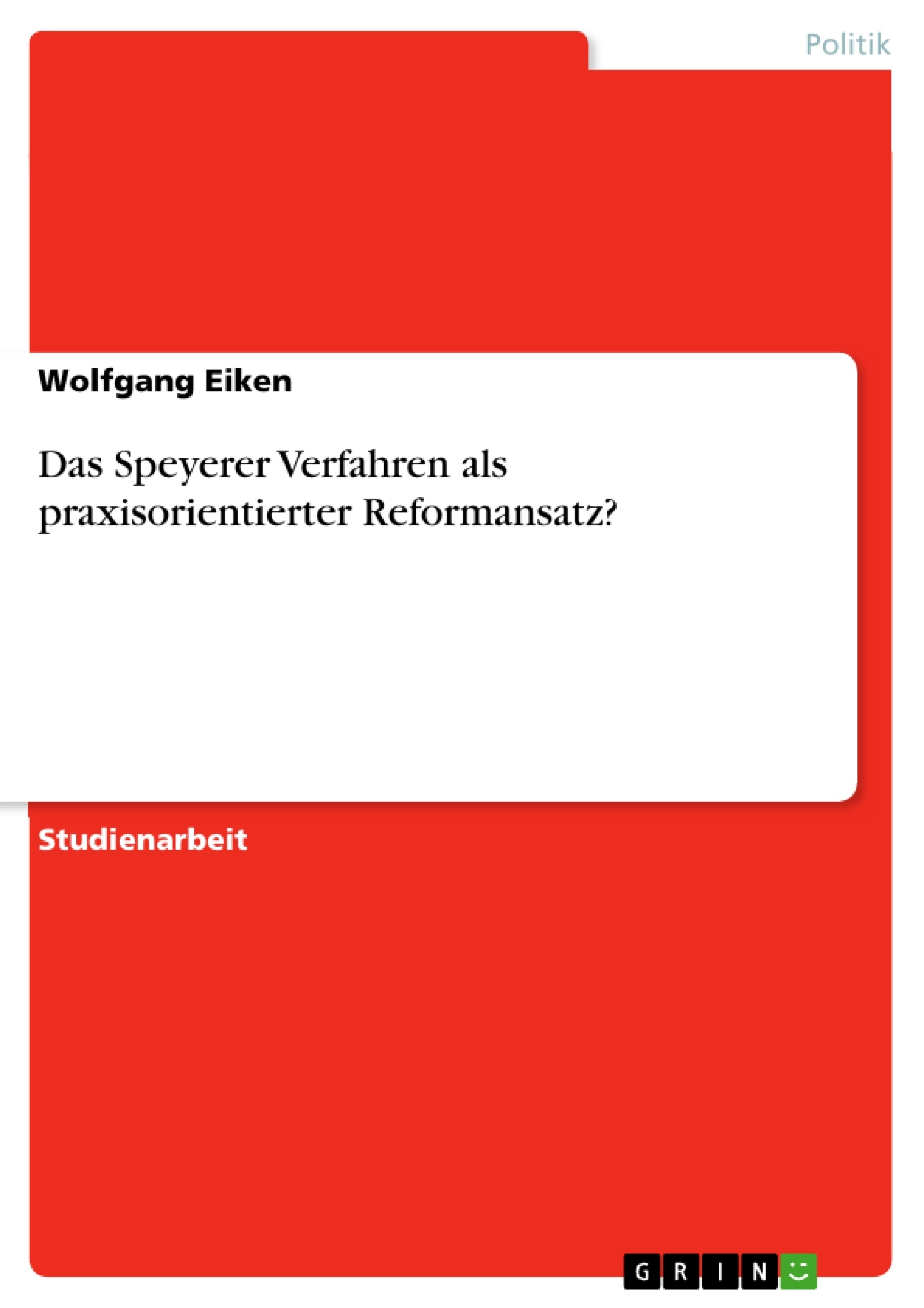Ausgelöst durch die Finanzkrise der Kommunen wurde eine Reform ins Leben gerufen, die in Deutschland eine grundlegende Neukonzeption und Umgestaltung der Kommunalverwaltung zur Folge hat. Die KGSt hat zu diesem Zweck nach dem Vorbild des "Tilburger Modell" das "Neue Steuerungsmodell" ins Leben gerufen, dessen Sinn es ist, öffentliche Verwaltungen dahin zu führen, dass auch betriebswirtschaftlich genutzte Elemente in den Kommunen eingeführt werden. Dieses Steuerungsmodell wird zur Zeit von den Kommunen angestrebt. Hierbei spielt das Haushalts- und Rechnungswesen eine sehr große Rolle. "Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen kann als Informationssystem verschiedenen Zielsetzungen und Informationsfunktionen dienen. Neben der quantitativen Information über alle güter- und geldmäßigen Bestände und deren Veränderungen in der Verwaltung kommt ihm als Managementtechnik in allen Phasen des Führungsprozesses eine zentrale Bedeutung zu" . Die kamerale Haushaltsführung ist als traditionelles Instrument der Kommunen die systematische Zusammenstellung der für eine Haushaltperiode geplanten Ausgabenansätze und der vorausgeschätzten, zur Deckung dieser Ausgaben benötigten Einnahmen. Hierbei dient der Haushaltsplan verschiedenen Gruppen (Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit und anderen übergeordneten staatlichen Instanzen) als Informations-, Entscheidungs- und Kontrollinstrument. Auf Grund der schon weiter oben angesprochenen Finanzkrise genügt dieser Haushaltsplan nicht mehr den Anforderungen der Adressaten. Es fehlen u.a. Leistungs- und Produktinformationen, die mittlerweile für die Ausübung der politischen Programmfunktion notwendig sind. Die Produkte bilden hierbei die Grundlage der neuen Steuerung und sind somit für das neue Haushaltwesen wichtig.
Die Stadt Wiesloch, eine Stadt mit ca. 26.000 Einwohnern in Baden-Würtemberg, sah sich Anfang der im Jahre 1992 einem akuten Einbruch der Finanzen gegenübergestellt. Die Gewerbesteuereinnahmen gingen um 60 % zurück. Somit blieb für die eigenen Aufgaben der Stadt Wiesloch nur noch ein Minimum an Mitteln. Die Verwaltungsspitze beschloß, mit verschiedenen Projekten u.a. die Aufbau- und Ablauforganisation zu verbessern. Somit kam der Stadt Wiesloch die Anfrage des Innenministeriums Baden-Würtemberg, ob sie als Modell-Gemeinde ein neues Rechnungswesen in Anlehnung an die doppelte kaufmännische Buchführung erproben würden, sehr gelegen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
- Das „Speyerer Verfahren“
- Das Drei-Komponenten-Modell des NKR
- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Struktur des neuen Haushalts- und Rechnungswesens
- Der Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Verknüpfung der Teilhaushalte mit dem Gesamthaushalt
- Der Gesamthaushalt
- Ansatz und Bewertungsregeln
- Zahlungen
- Erträge und Aufwendungen
- Schlüsselaggregate und Deckungsregeln
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Rechnungslegung und Konsolidierung
- Grundstruktur des management-orientierten (internen) Rechnungswesens
- Implementationshinweise
- Rechtliche Grundlagen
- Aufstellungverfahren
- Schlussbetrachtung
- Das Drei-Komponenten-Modell des NKR
- Reformnotwendigkeit des traditionellen Haushalts- und Rechnungswesens
- Das „Speyerer Verfahren“ als Modell für ein produktorientiertes Rechnungswesen
- Das Drei-Komponenten-Modell des NKR: Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
- Struktur und Funktionsweise des neuen Haushalts- und Rechnungswesens
- Implementationshinweise und rechtliche Grundlagen
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ein und beleuchtet die Notwendigkeit einer Neuausrichtung aufgrund der Finanzkrise der Kommunen. Die Entwicklung des „Neuen Steuerungsmodells“ durch die KGSt und die Bedeutung des „Speyerer Verfahrens“ als konkretes Beispiel für eine produktorientierte Reform werden dargestellt.
- Die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens: Dieses Kapitel analysiert die Schwächen des traditionellen Haushalts- und Rechnungswesens und zeigt die Gründe für die Reformnotwendigkeit auf. Die Fokus liegt auf den Defiziten in Bezug auf Leistungs- und Produktinformationen, der mangelnden Vermögens- und Schuldenrechnung sowie der fehlenden Transparenz für die Informationsadressaten.
- Das „Speyerer Verfahren“: Dieses Kapitel stellt das „Speyerer Verfahren“ als ein konkretes Modell für ein produktorientiertes Rechnungswesen vor. Der Fokus liegt auf dem Drei-Komponenten-Modell des NKR, das aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung besteht.
- Struktur des neuen Haushalts- und Rechnungswesens: Dieses Kapitel erläutert die Struktur des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, das sich auf die Messung des Nettoressourcenverbrauchs konzentriert. Es werden die Bestandteile des Gesamthaushalts (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) und der Teilhaushalte sowie die Verknüpfung zwischen diesen Elementen betrachtet.
- Ansatz und Bewertungsregeln: Dieses Kapitel behandelt die Bewertungsgrundlagen des neuen Rechnungswesens, insbesondere die Regelungen für Zahlungen, Erträge und Aufwendungen.
- Schlüsselaggregate und Deckungsregeln: Dieses Kapitel fokussiert auf die wichtigsten Kennzahlen und Deckungsregeln im Rahmen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt.
- Rechnungslegung und Konsolidierung: Dieses Kapitel behandelt die Rechnungslegung und Konsolidierungsprozesse im neuen Rechnungswesen.
- Grundstruktur des management-orientierten (internen) Rechnungswesens: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundstruktur des management-orientierten Rechnungswesens, das als wichtiges Instrument zur Steuerung und Kontrolle der kommunalen Verwaltung dient.
- Implementationshinweise: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen und die Aufstellungsprozesse für die Implementierung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens in der Praxis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland. Ziel ist es, das "Speyerer Verfahren" als praxisorientierten Reformansatz zu beleuchten und dessen Bedeutung im Kontext des „Neuen kommunalen Haushaltswesens“ (NKH) zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, Reform, Speyerer Verfahren, Neues kommunales Haushaltswesen (NKH), Drei-Komponenten-Modell, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Ressourcenverbrauch, Produktorientierung, Steuerungsmodell, Output-Steuerung, Implementationshinweise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Speyerer Verfahren“?
Das Speyerer Verfahren ist ein Reformansatz für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der auf Produktorientierung und betriebswirtschaftliche Steuerung setzt.
Was beinhaltet das Drei-Komponenten-Modell des NKR?
Es besteht aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung (ähnlich der GuV) und der Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung).
Warum wurde eine Reform des kommunalen Haushaltswesens notwendig?
Die traditionelle Kameralistik bot zu wenig Informationen über den Ressourcenverbrauch und die erbrachten Leistungen (Produkte), was angesichts der Finanzkrise der Kommunen unzureichend war.
Welche Rolle spielt die Stadt Wiesloch in dieser Arbeit?
Wiesloch diente als Modell-Gemeinde in Baden-Württemberg, um das neue Rechnungswesen in Anlehnung an die doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) zu erproben.
Was ist das Ziel des „Neuen Steuerungsmodells“ (NSM)?
Das NSM zielt darauf ab, öffentliche Verwaltungen durch betriebswirtschaftliche Elemente effizienter zu steuern und die Output-Orientierung zu stärken.
- Quote paper
- Wolfgang Eiken (Author), 2002, Das Speyerer Verfahren als praxisorientierter Reformansatz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6417