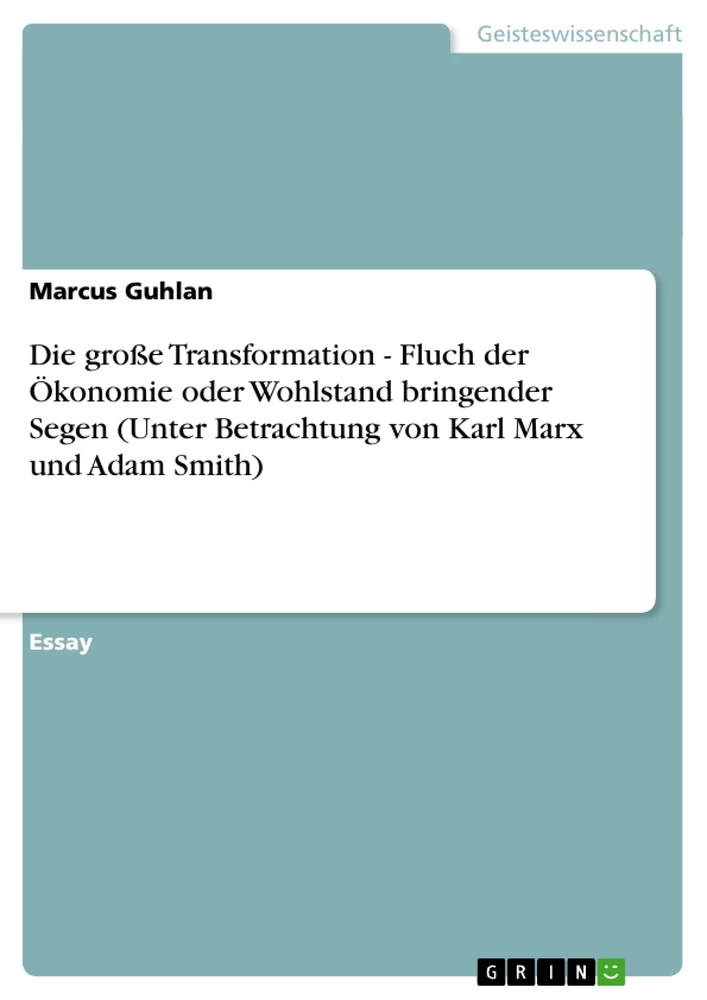Die Industrielle Revolution und der damit einhergehende Umbruch von der feudalen Agrargesellschaft hin zur modernen Industriegesellschaft war in den Meinungen der Apologeten der Beginn von wunderbarer Freiheit und ökonomischer Entfaltung. Die Skeptiker jedoch sind sich einig: diese Revolution ist der Ursprung von Pauperismus und Klassengegensätzen, von dem also, was wir heute die “soziale Schere“ nennen. Die wohl zwei wichtigsten Vertreter dieser Antithetik sollen im folgenden genauer betrachtet werden und dies wird dazu dienen, die unterschiedlichen Interpretationen der industriellen Transformation aus soziologischer Sicht zu verdeutlichen. Hierzu werden die Theorien von Karl Marx und Adam Smith herangezogen und, nach einer kurzen Darstellung der “Großen Transformation“, gegenübergestellt. Da die formalen Schranken für den folgenden Essay keine universelle Analyse beider Strömungen zulassen, werde ich allein auf die von Marx und Smith in Teilen diametral dargestellten Funktionen und Auswirkungen von Arbeit bzw. Arbeitsteilung eingehen.
Doch gehen wir zunächst einer Frage nach: Was löste die Metamorphose aus, wie entstand die moderne Gesellschaftsform? Wenn wir versuchen diese Frage zu beantworten, sollten wir jedoch strikt beachten, dass diese Große Transformation, die im England des 18. Jahrhunderts ihren Ursprung nimmt, keineswegs ein abgeschlossener, hinter uns liegender Umbruch ist. Noch immer - und schneller denn je - müssen wir Veränderungen globalen Ausmaßes Stand halten. Nun ist es allerdings sicher nicht falsch zu behaupten, dass diese Veränderungen auch die Konsequenzen dessen sind, was sich ökonomisch, politisch und kulturell im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts zu entfalten begann. Da für das Thema des Essays ausschließlich die ökonomische Revolution von Relevanz ist, wird auch nur diese in Grundzügen dargestellt.
Talcott Parsons stellte in seiner Analyse der industriellen Revolution fest, dass es sich dabei nicht um „eine plötzliche Revolution“ handelte, sondern vielmehr „eine lange und stetige Evolution“ voranging. Mit den Enclosure Acts in England im 16. Jahrhundert und der sich ausbreitenden Schafzucht wurde zwar zum einen das Fundament der späteren Baumwoll-Textilindustrie geschaffen, andererseits waren sie jedoch auch der Beginn der Vertreibungen der Bauern, die nun zum Zweck der Erwerbssuche in die Städte pilgerten.
Inhaltsverzeichnis
- Die große Transformation - Fluch der Ökonomie oder Wohlstand bringender Segen?
- Einleitung
- Die Industrielle Revolution und ihre Folgen
- Enclosure Acts und Verstädterung
- Technologischer Fortschritt und Massenproduktion
- Die Rolle des Staates und der Entstehung der Unternehmerklasse
- Die Arbeiterschicht und ihre Lebensbedingungen
- Adam Smith und die Arbeitsteilung
- Der Zweck von Kapital und die Arbeitsteilung als Motor des Wohlstands
- Smith's Theorie der natürlichen Ordnung und der “unsichtbaren Hand“
- Karl Marx und die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise
- Das Verhältnis von Kapital und Arbeit
- Ausbeutung und die Entstehung von Klassenkampf
- Die Folgen der industriellen Revolution für die Arbeiterschicht
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der industriellen Revolution und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Er untersucht die kontroversen Perspektiven von Adam Smith und Karl Marx auf die “Große Transformation” und analysiert die Funktionen und Auswirkungen von Arbeit und Arbeitsteilung.
- Die Folgen der industriellen Revolution auf die Gesellschaft
- Die Rolle der Arbeit und Arbeitsteilung in der Wirtschaft
- Die unterschiedlichen Theorien von Adam Smith und Karl Marx
- Der Einfluss von Kapital und Arbeit auf die Produktionsweise
- Die Entstehung von Klassenkampf und sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Kontroverse um die industrielle Revolution dar und benennt die beiden wichtigsten Vertreter dieser Antithetik: Adam Smith und Karl Marx. Der Essay fokussiert auf die unterschiedlichen Interpretationen der industriellen Transformation aus soziologischer Sicht, insbesondere im Hinblick auf die Funktionen und Auswirkungen von Arbeit und Arbeitsteilung.
- Das Kapitel “Die Industrielle Revolution und ihre Folgen” beschreibt den historischen Kontext der industriellen Revolution, beginnend mit den Enclosure Acts in England und der Verstädterung, sowie den technologischen Fortschritt und die Entstehung der Massenproduktion. Es werden die Rolle des Staates und die Entstehung der Unternehmerklasse beleuchtet, sowie die Lebensbedingungen der Arbeiterschicht beschrieben.
- Im Kapitel “Adam Smith und die Arbeitsteilung” wird die Theorie von Adam Smith dargestellt, die die Arbeitsteilung als Motor des Wohlstands betrachtet. Smith argumentiert, dass der Mensch durch die Arbeitsteilung mehr produzieren kann, als er zum Leben benötigt, und dass die “unsichtbare Hand” des Marktes für einen allgemeinen Wohlstand sorgt.
Schlüsselwörter
Industrielle Revolution, Adam Smith, Karl Marx, Arbeitsteilung, Kapital, Arbeit, Klassenkampf, soziale Ungleichheit, Wohlstand, ökonomisches Wachstum, “Große Transformation”
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Großen Transformation“?
Es beschreibt den Umbruch von der feudalen Agrargesellschaft hin zur modernen Industriegesellschaft, beginnend im England des 18. Jahrhunderts.
Wie bewertete Adam Smith die Arbeitsteilung?
Smith sah in der Arbeitsteilung den Motor des allgemeinen Wohlstands, der durch die „unsichtbare Hand“ des Marktes zu ökonomischem Wachstum führt.
Welche Kritik übte Karl Marx an der industriellen Revolution?
Marx kritisierte die Ausbeutung der Arbeiterschicht, die Entstehung von Klassengegensätzen und den Pauperismus als direkte Folge der kapitalistischen Produktionsweise.
Was waren die Enclosure Acts?
Dies waren Gesetze zur Einzäunung von Gemeindeland in England, die zur Vertreibung von Bauern führten und die Basis für das industrielle Proletariat in den Städten schufen.
Ist die industrielle Revolution ein abgeschlossener Prozess?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass wir uns immer noch in einem globalen Wandel befinden, dessen Ursprünge in den ökonomischen Umbrüchen des 18. Jahrhunderts liegen.
- Citation du texte
- Marcus Guhlan (Auteur), 2005, Die große Transformation - Fluch der Ökonomie oder Wohlstand bringender Segen (Unter Betrachtung von Karl Marx und Adam Smith), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64246