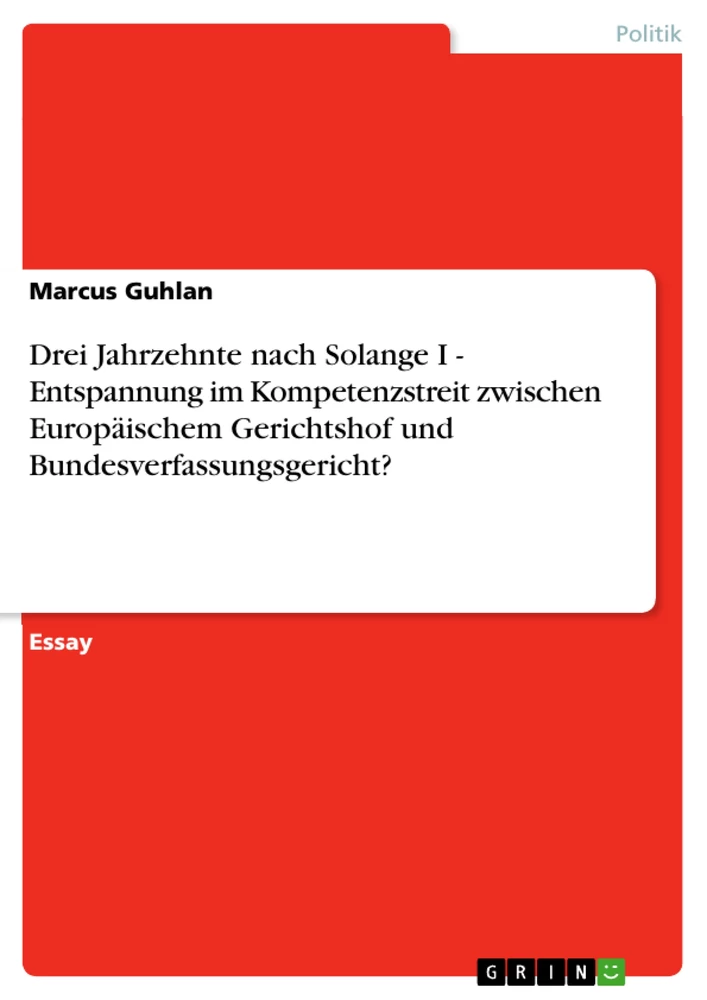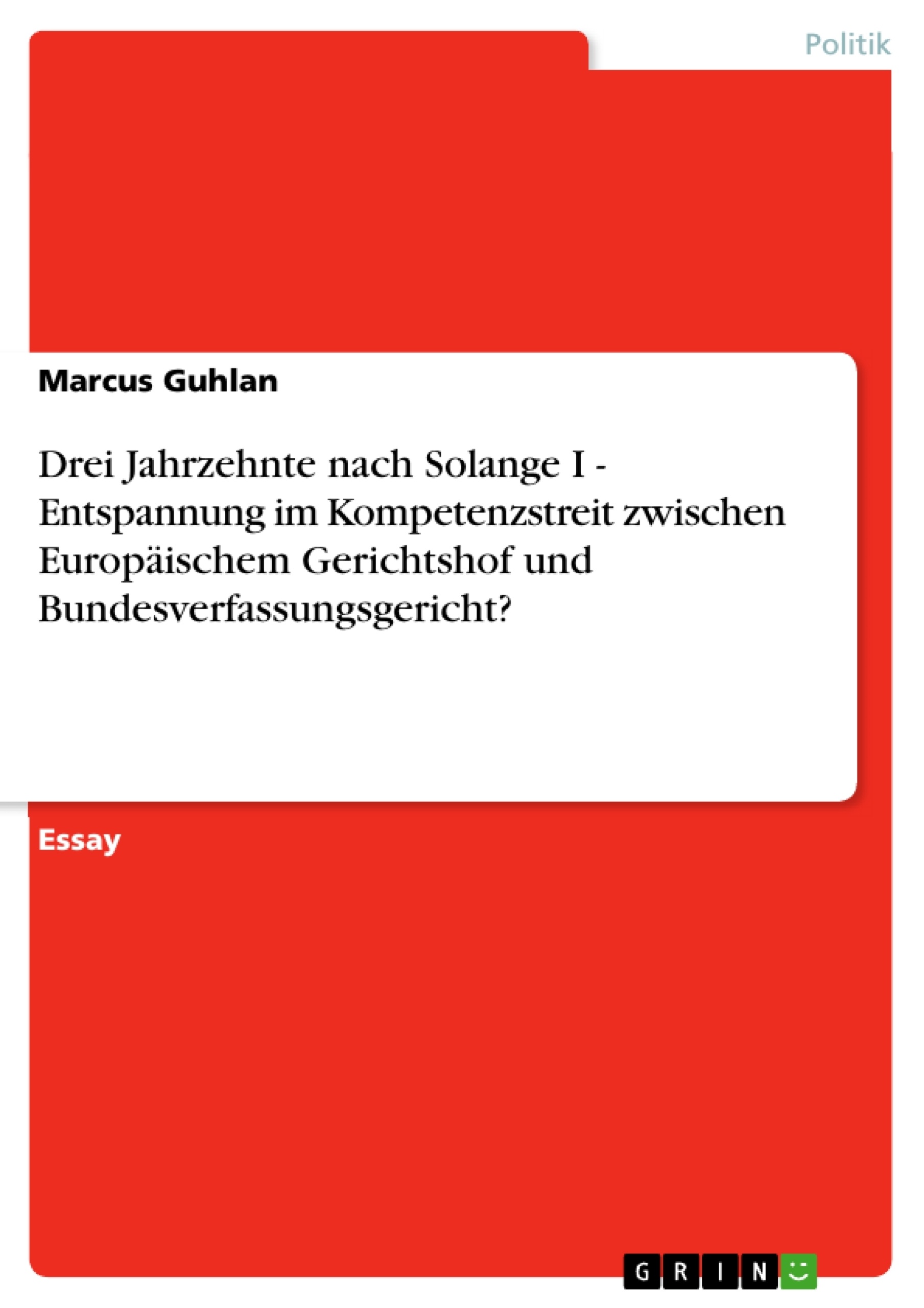Das BVerfG genießt in der Bevölkerung ein besonderes Maß an Vertrauen. Dies ist eine Legitimation, welche sich das BVerfG in den Jahren seit seiner Gründung 1951 vor allem in seiner Funktion als “Decodierer“ zwischen Rechtsstaat und Gesellschaft sukzessive erworben hat. Doch schon allein die Urteilspraxis des Gerichts samt der immer wieder deutlich zu Tage tretenden Autonomie der Karlsruher Richter vermittelt dem Bürger die rechtsstaatliche Funktion des deutschen Grundgesetzes, das nicht zuletzt die Einhegung der politischen Macht gegenüber dem gesellschaftlichen Individuum garantieren soll. Im Falle einer scheinbaren Ungerechtigkeit bleibt dem Bürger also nach Art. 93 Abs. 4a GG immer noch der “Gang nach Karlsruhe“ - dem BVerfG kommt hier also auch eine gewaltige Funktion als „Klagemauer“ zu (siehe auch Korte/ Fröhlich, 2004: 62). Synonyme wie “Ersatzgesetzgeber“ oder “Karlsruher Republik“ unterstreichen den Handlungsraum des BVerfG auf politischer Ebene. Besonders im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle, wenn diese von oppositionellen Minderheiten angestrengt wird, kann sich das BVerfG nicht den politischen Konflikten entziehen und kommt bei Nichtigerklärungen von verfassungswidrigen Gesetzen seiner Funktion als bedeutender „Vetospieler“ (Korte/Fröhlich, 2004, S. 35) nach, gerade weil die ersten Adressaten der Kontrolle politische Akteure sind. Durch die Annahme von Verfassungsbeschwerden, Entscheidungsbegründungen, Reforminitiierungen und Normsetzungen trat bzw. tritt das BVerfG zudem immer wieder als politischer Motor auf, der Themen auf Tagesordnungen setzt. Das BVerfG hat sich also im Laufe seiner Entwicklung nicht zuletzt wegen seines Funktionskatalogs zu einer im Gewaltensystem Deutschlands herausragenden Institution entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Parallelexistenz von BVerfG und EuGH bis "Solange II"
- 1 BVerfG als Hüter der deutschen Verfassung
- 2 EuGH - Judikativorgan der EG
- 3 Rechtsprechung von EuGH und BVerfG bis Solange II
- II Das "Kooperationsverhältnis" nach dem Maastricht-Urteil
- 1 Maastricht-Urteil
- 2 Entwicklung nach "Maastricht"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht das Verhältnis zwischen dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Kontext der historischen Entwicklung der Grundrechtsgewähr beider Institutionen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob es nach dem "Solange II"-Urteil zu einer Entspannung im Kompetenzstreit zwischen beiden Gerichten gekommen ist. Der Essay analysiert die Funktionen und Konflikte der beiden Gerichte vor und nach dem "Solange II"-Urteil und untersucht, ob das Urteil zu einer Neuordnung des Verhältnisses zwischen Karlsruhe und Luxemburg geführt hat.
- Die Funktionen und Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs
- Die Entwicklung des Kompetenzstreits zwischen den beiden Gerichten bis zum "Solange II"-Urteil
- Die Auswirkungen des "Solange II"-Urteils auf das Verhältnis zwischen BVerfG und EuGH
- Die aktuelle Situation des Verhältnisses zwischen BVerfG und EuGH
- Die Bedeutung des "Solange II"-Urteils für die Anerkennung des EuGH als "gesetzlicher Richter"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Essays analysiert die Parallelexistenz von BVerfG und EuGH bis zum "Solange II"-Urteil. Es beschreibt die Funktionen und Kompetenzen der beiden Gerichte sowie die Entwicklung des Kompetenzstreits zwischen ihnen. Das zweite Kapitel widmet sich dem "Kooperationsverhältnis" zwischen den beiden Gerichten nach dem Maastricht-Urteil. Es untersucht die Auswirkungen des Urteils auf das Verhältnis zwischen BVerfG und EuGH und analysiert die Entwicklung dieses Verhältnisses bis heute.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof, Grundrechte, Kompetenzstreit, "Solange II"-Urteil, "Maastricht"-Urteil, Rechtsstaatlichkeit, Gemeinschaftsrecht, Rechtsprechung, Kooperation, Konflikt, Rechtssicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des Kompetenzstreits zwischen BVerfG und EuGH?
Es ging um die Frage, wer die letzte Entscheidungsgewalt über den Schutz der Grundrechte hat, wenn europäisches Recht mit dem deutschen Grundgesetz kollidiert.
Was besagt das "Solange II"-Urteil?
Das BVerfG erklärte, dass es seine Prüfungskompetenz über EU-Recht "solange" nicht mehr ausübt, wie der EuGH einen Grundrechtsschutz garantiert, der dem des Grundgesetzes im Wesentlichen entspricht.
Warum wird das BVerfG als "Vetospieler" bezeichnet?
Durch die abstrakte Normenkontrolle kann das Gericht verfassungswidrige Gesetze für nichtig erklären und somit politische Entscheidungen blockieren.
Welche Bedeutung hatte das Maastricht-Urteil für das Verhältnis?
Es definierte ein "Kooperationsverhältnis", in dem das BVerfG zwar die Integration unterstützte, sich aber vorbehielt, die Einhaltung der Kompetenzgrenzen der EU zu prüfen.
Gilt der EuGH als "gesetzlicher Richter"?
Ja, durch die Rechtsprechung wurde anerkannt, dass der EuGH im Rahmen seiner Zuständigkeit der gesetzliche Richter im Sinne des Grundgesetzes ist.
- Citation du texte
- Marcus Guhlan (Auteur), 2005, Drei Jahrzehnte nach Solange I - Entspannung im Kompetenzstreit zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64248