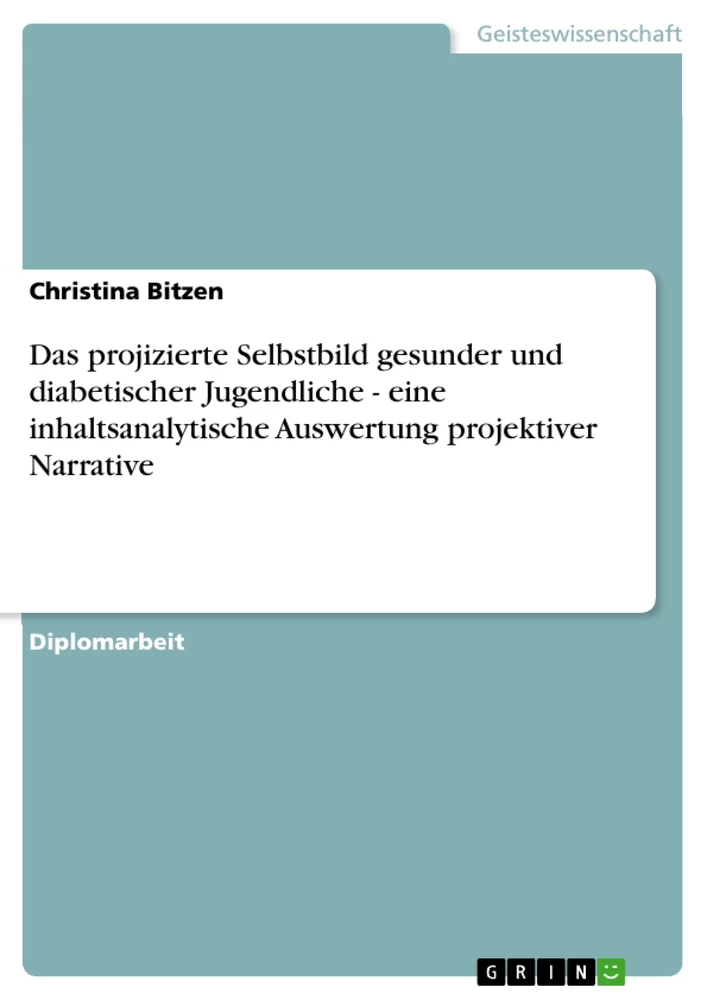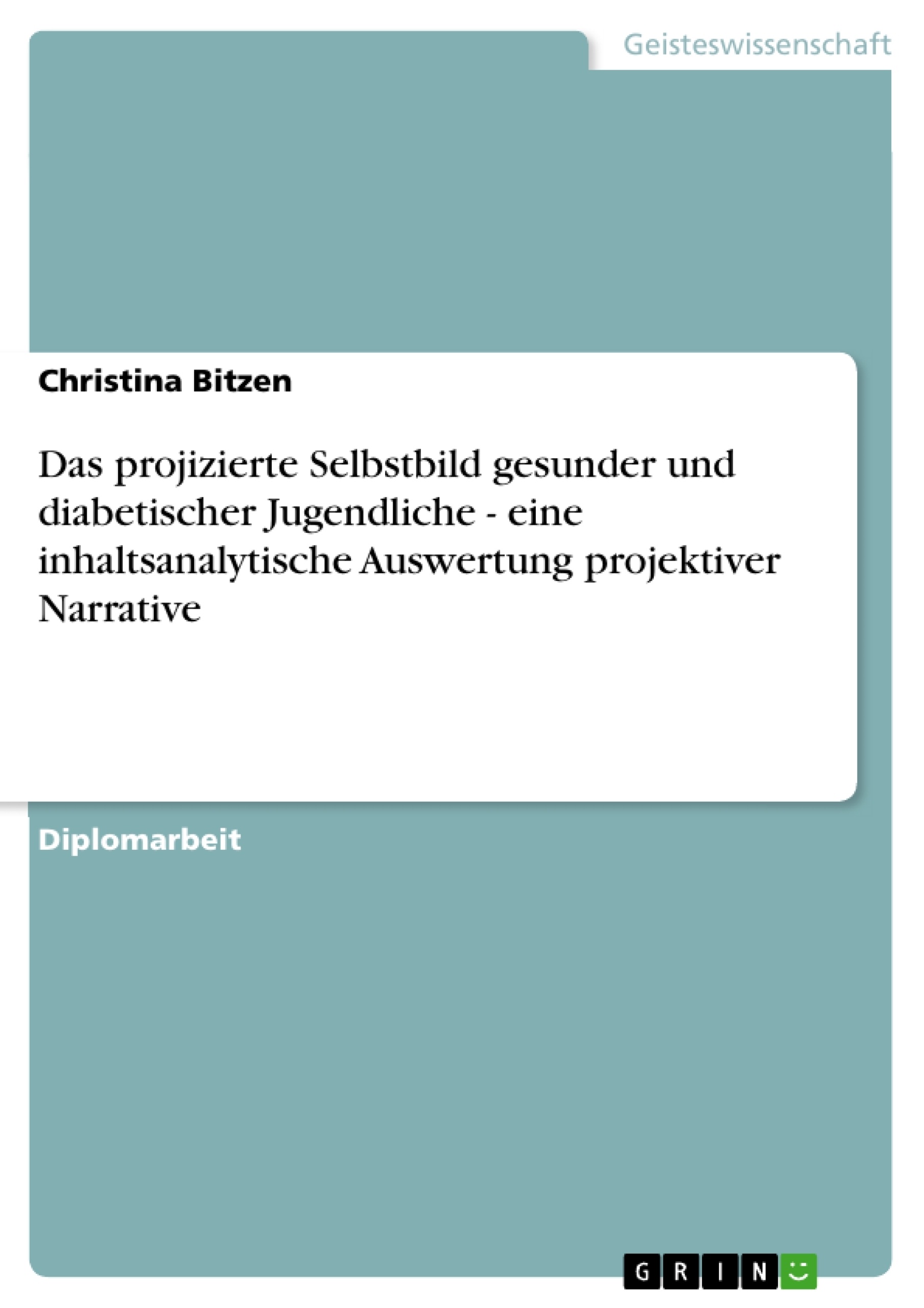Das Jugendalter ist eine Phase, in der die Bearbeitung vielfältiger Übergänge und Entwicklungsaufgaben sowie die Herausbildung eines kongruenten Selbstkonzeptes erforderlich ist. Bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes kommt als zusätzlicher, non-normativer Stressor der Umgang mit einer chronischen Krankheit hinzu, die im Alltag ständig präsent ist und zu Einschränkungen in zahlreichen Bereichen des Alltags führt. In empirischen Studien wurde festgestellt, dass diabetische Adoleszente im Vergleich zu gesunden Altersgenossen Retardierungen bei der Bewältigung typischer Entwicklungsaufgaben aufwiesen. Zur Untersuchung dieser Fragen wurden 35 gesunde und 37 an Diabetes mellitus erkrankte Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren mit dem Thematischen Apperzeptionstest konfrontiert. Dieses projektive Verfahren wurde benutzt, weil es wenig durchschaubar ist und individuelle Persönlichkeitsdaten erhebt. In der vorliegenden Untersuchung wurden die TAT-Protokolle der Probanden hinsichtlich Selbstkonzept, Entwicklungsaufgaben und Konflikten anhand eines dafür entworfenen formal-inhaltlichen Kategoriensystem analysiert. Diese Daten wurden zum Alter, Geschlecht, Gesundheitsstatus und zur Güte der Stoffwechseleinstellung bei diabetischen Jugendlichen in Beziehung gesetzt. Neben Altersunterschieden bezogen auf die Tönung des Selbstkonzeptes wurden Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Jugendlichen gefunden. Männliche und weibliche Jugendliche haben ein deutlich verschiedenes Selbstkonzept: Mädchen beschreiben sich negativer, während die männlichen Jugendlichen über eher positive Anteile des Selbstkonzepts berichteten. Ein weiterer geschlechtsspezifischer Befund ist die höhere Relevanz zwischenmenschlicher Themen für weibliche Probanden, während männliche Jugendliche sich eher mit leistungsthematischen Aspekten befassen. An Diabetes mellitus erkrankte Jugendliche unterscheiden sich von der gesunden Kontrollgruppe in wesentlichen und entwicklungsrelevanten Variablen. Sie zeigten Behinderungen in jugendtypischen Entwicklungsaufgaben ( wie Ablösung von den Eltern, Aufbau enger Freundschaftsbeziehungen ) und weisen mehr intrapsychische Konflikte auf, während höhere Werte bei den interpsychischen Konflikten ausschließlich bei gesunden Jugendlichen gefunden wurden. Außerdem konnte diabetischen Jugendlichen ein vermehrtes Abwehrverhalten gegenüber der Enthüllung ihrer Persönlichkeit nachgewiesen werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1. Zur Definition von Lebensphasen
- 2.2. Jugendalter
- 2.2.1. Frühe Entwicklungstheorien der Adoleszenz
- 2.2.2. Neuere Entwicklungstheorien der Adoleszenz
- 2.2.3. Zusammenfassung
- 2.3. Entwicklungsaufgaben
- 2.3.1. Identitätsentwicklung in der Adoleszenz
- 2.3.2. Das Selbstkonzept im Jugendalter
- 2.3.3. Kritische Lebensereignisse im Jugendalter
- 2.3.4. Zusammenfassung Anforderungen in der Adoleszenz
- 2.4. Chronische Krankheit als non-normative Entwicklungsaufgabe
- 2.4.1. Diabetes mellitus; Prävalenz, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten
- 2.4.2. Wechselbeziehungen zwischen Diabetes mellitus und Entwicklungsaufgaben
- 2.4.3. Zusammenfassung Diabetes mellitus als non-normative Entwicklungsaufgabe
- 3. Hypothesen
- 3.1. Entwicklungspsychologische Fragestellung
- 3.1.1. Geschlechtsunterschiede
- 3.1.2. Altersunterschiede
- 3.2. Gesundheitspsychologische Fragestellungen
- 3.2.1. Gesundheitsstatus
- 3.2.2. Stoffwechselgüte
- 4. Methodik
- 4.1. Stichprobenbeschreibung und Gruppenbildung
- 4.1.1. Unabhängige Variablen
- 4.2. Der Thematische Apperzeptionstest (TAT)
- 4.2.1. Theoretischer Hintergrund
- 4.2.2. Auswahl der Testmaterialien
- 4.2.3. Die verschiedenen Auswertungsansätze des TAT
- 4.3. Die modifizierte Version des Bonner Auswertungssystems
- 4.3.1. Operationalisierung der Variable „Selbstkonzept“
- 4.3.1.1. Kodierung der Bezeichnung der handelnden Figuren
- 4.3.1.2. Kodierung der Eigenschaften / Gefühle der Figuren
- 4.3.2. Operationalisierung der Variable „Entwicklungsaufgaben“
- 4.3.3. Operationalisierung der Variable „Konflikte“
- 4.3.4. Operationalisierung der Variable „Abwehr“
- 4.4. Durchführung
- 4.4.1. Die Instruktion des TAT
- 4.4.2. Bildung des Kategoriensystems
- 4.4.3. Beurteilerübereinstimmung
- 4.5. Aufbereitung der qualitativen Daten für die statistische Auswertung
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Entwicklungspsychologische Fragestellung
- 5.1.1. Entwicklungsaufgaben
- 5.1.2. Selbstkonzept
- 5.1.3. Konflikte
- 5.2. Gesundheitspsychologische Fragestellung
- 5.2.1. Entwicklungsaufgaben
- 5.2.2. Selbstkonzept
- 5.2.3. Konflikte
- 6. Diskussion
- 6.1. Interpretation der Ergebnisse
- 6.1.1. Entwicklungspsychologische Fragestellung
- 6.1.2. Gesundheitspsychologische Fragestellung
- 6.2. Methodische Kritik
- 6.3. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung des projizierten Selbstbildes bei gesunden und diabetischen Jugendlichen. Sie zielt darauf ab, Unterschiede im Selbstbild zwischen den beiden Gruppen aufzudecken und die Auswirkungen des Diabetes mellitus auf die Entwicklungsaufgaben und das Selbstbild von Jugendlichen zu erforschen.
- Das projizierte Selbstbild von Jugendlichen im Kontext der Identitätsentwicklung
- Der Einfluss chronischer Krankheiten, insbesondere Diabetes mellitus, auf die Identitätsentwicklung
- Die Rolle von Entwicklungsaufgaben und Selbstkonzept in der Adoleszenz
- Die Anwendung des Thematischen Apperzeptionstests (TAT) als Instrument zur Erforschung des Selbstbildes
- Die Bedeutung von qualitativen Forschungsmethoden in der Psychologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Selbstbildes bei Jugendlichen, insbesondere bei chronisch kranken Jugendlichen, vor. Sie erläutert den Forschungsstand und formuliert die Forschungsfragen der Arbeit.
- Kapitel 2: Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Begriff der Adoleszenz und die relevanten Entwicklungstheorien. Es werden die Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, insbesondere im Kontext von chronischen Erkrankungen, sowie die Bedeutung des Selbstkonzepts erörtert.
- Kapitel 3: Hypothesen: In diesem Kapitel werden die Hypothesen der Arbeit formuliert. Es werden sowohl entwicklungspsychologische als auch gesundheitspsychologische Fragestellungen behandelt.
- Kapitel 4: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Es wird die Stichprobenbeschreibung und Gruppenbildung, der Thematische Apperzeptionstest (TAT) und die modifizierte Version des Bonner Auswertungssystems vorgestellt.
- Kapitel 5: Ergebnisse: Die Ergebnisse der statistischen Auswertung werden in diesem Kapitel präsentiert. Es werden sowohl die entwicklungspsychologischen als auch die gesundheitspsychologischen Fragestellungen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Selbstbild, Adoleszenz, Identitätsentwicklung, chronische Krankheit, Diabetes mellitus, Thematischer Apperzeptionstest (TAT), qualitative Forschung, Entwicklungsaufgaben, Selbstkonzept.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Typ-1-Diabetes das Selbstbild von Jugendlichen?
Diabetische Jugendliche zeigen oft Retardierungen bei Entwicklungsaufgaben wie der Ablösung von den Eltern und weisen häufiger intrapsychische Konflikte auf.
Was ist der Thematische Apperzeptionstest (TAT)?
Ein projektives Verfahren, bei dem Probanden zu Bildern Geschichten erfinden. Es wird genutzt, um unbewusste Persönlichkeitsanteile, Konflikte und das Selbstkonzept zu untersuchen.
Gibt es Geschlechtsunterschiede im Selbstkonzept Jugendlicher?
Ja, die Studie fand heraus, dass Mädchen sich oft negativer beschreiben und zwischenmenschliche Themen priorisieren, während Jungen positiver berichten und leistungsorientierter sind.
Was sind "non-normative Stressoren" in der Adoleszenz?
Dazu gehört zum Beispiel eine chronische Krankheit wie Diabetes, die über die normalen Entwicklungsaufgaben (Pubertät, Identitätssuche) hinaus eine zusätzliche Belastung darstellt.
Warum zeigen diabetische Jugendliche vermehrt Abwehrverhalten?
Aufgrund der ständigen Kontrolle durch die Krankheit und das soziale Umfeld neigen sie dazu, ihre Persönlichkeit stärker zu schützen und weniger preiszugeben.
Welchen Einfluss hat die Stoffwechseleinstellung auf die Psyche?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Güte der Einstellung (HbA1c-Wert) und der psychischen Stabilität bzw. der Bewältigung von Konflikten.
- Quote paper
- Christina Bitzen (Author), 2002, Das projizierte Selbstbild gesunder und diabetischer Jugendliche - eine inhaltsanalytische Auswertung projektiver Narrative, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6428