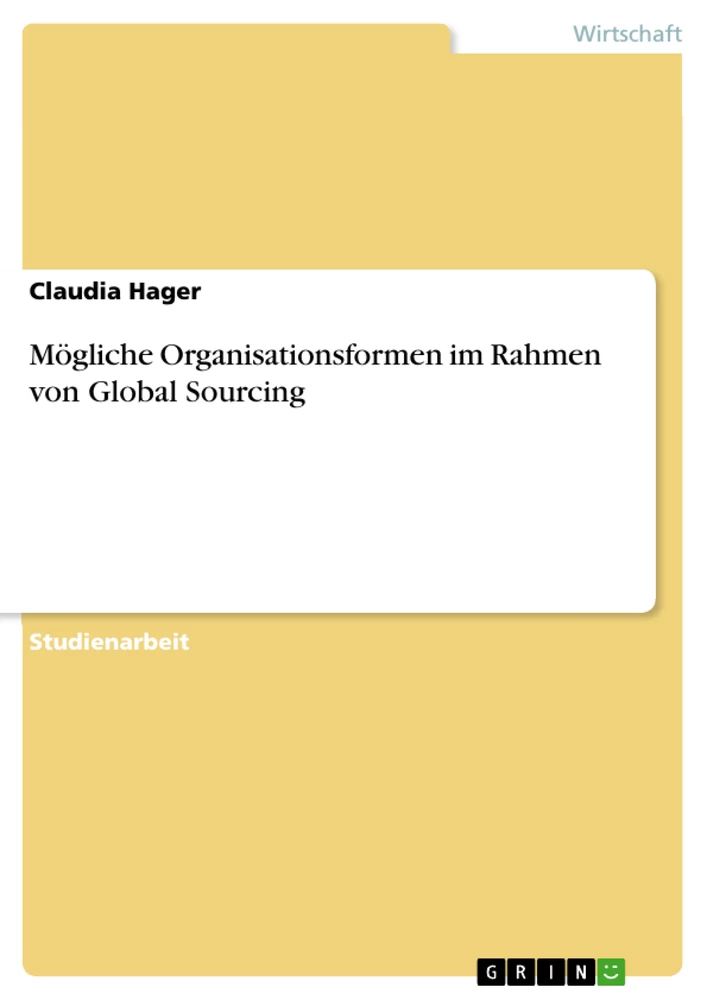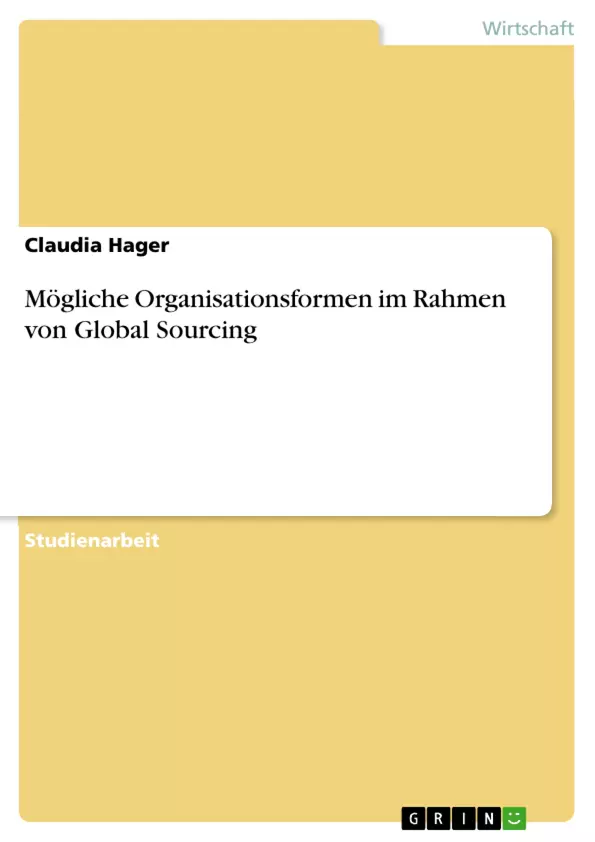Die Globalisierung eröffnete Unternehmen in den letzten Jahren neue Möglichkeiten im Bereich der Beschaffung. Durch niedrigere Arbeitskosten, günstigere Steuern- und Abgabenbelastungen sowie längere Arbeitszeiten und erhöhte Produktivität lassen sich heute in Schwellenländern in Südostasien oder Osteuropa gegenüber Industriestaaten enorme Kostenvorteile bei der Produktion von Gütern erzielen.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei Unternehmen in Industriestaaten der Anteil fremdbezogener Güter heute bei bis zu 60% liegt, werden Einsparpotentiale im Bereich der Beschaffung bedeutsam. Die globale Ausdehnung der Beschaffungsaktivitäten mit dem Ziel weltweit nach günstigen Beschaffungsquellen zu suchen, ist daher für Unternehmen zur Notwendigkeit geworden, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Die Internationalisierung der Beschaffung
- Der Begriff „Global Sourcing“
- Mögliche Internationalisierungsformen zur Nutzung ausländischer Beschaffungsmärkte
- Indirekter Import
- Direkter Import
- Internationale Einkaufsbüros
- Kapitalbeteiligung
- Bewertung der Alternativen
- Abgrenzung des Global Sourcing
- Unterteilung des Global Sourcing
- Zwischenfazit
- Die Organisationsstruktur des Global Sourcing
- (De-)Zentralisation von Kompetenzen
- Totale Zentralisation und totale Dezentralisation
- Die Wahl eines geeigneten Zentralisationsgrades
- Alternative Strukturdesigns
- Der Ansatz von ARNOLD
- Markt vs. Hierarchie
- Gestaltungsalternativen im Rahmen des Global Sourcing
- Der Zentraleinkaufs-Typ
- Der Outsourcing-Typ
- Der Koordinations-Typ
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den möglichen Organisationsformen im Rahmen von Global Sourcing. Sie analysiert die Internationalisierung der Beschaffung und die damit verbundenen Herausforderungen, beleuchtet die verschiedenen Formen der Internationalisierungsstrategie und untersucht die Organisationsstrukturen, die im Rahmen des Global Sourcing zum Einsatz kommen können.
- Internationalisierung der Beschaffung
- Organisationsstrukturen im Global Sourcing
- Zentraleinkauf, Outsourcing und Koordination
- Bewertung der Alternativen
- Strategische Bedeutung von Global Sourcing
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel widmet sich der Internationalisierung der Beschaffung und stellt den Begriff „Global Sourcing“ vor. Es diskutiert die verschiedenen Internationalisierungsformen zur Nutzung ausländischer Beschaffungsmärkte, wie z.B. indirekten und direkten Import, internationale Einkaufsbüros und Kapitalbeteiligungen. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Formen sowie die Abgrenzung des Global Sourcing von anderen Begriffen wie „internationaler Einkauf“ oder „Auslandsbeschaffung“ erläutert.
Kapitel 2: In diesem Kapitel wird die Organisationsstruktur des Global Sourcing näher beleuchtet. Die (De-)Zentralisation von Kompetenzen und die Wahl eines geeigneten Zentralisationsgrades stehen im Fokus. Außerdem werden alternative Strukturdesigns vorgestellt, wie z.B. der Ansatz von ARNOLD und die Abwägung zwischen Markt und Hierarchie.
Kapitel 3: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Gestaltungsalternativen im Rahmen des Global Sourcing. Es werden drei Typen vorgestellt: der Zentraleinkaufs-Typ, der Outsourcing-Typ und der Koordinations-Typ. Für jeden Typ werden die spezifischen Aufgaben und Funktionen sowie die Vor- und Nachteile im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Global Sourcing, Internationalisierung, Beschaffung, Organisationsstrukturen, Zentralisation, Dezentralisation, Outsourcing, Koordination, Zentraleinkauf, Wettbewerbsvorteil, Kostenreduktion, Lieferantenmanagement, Internationalisierungsformen, Direkter Import, Indirekter Import, Kapitalbeteiligung, Einkaufsbüros.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Global Sourcing in der Beschaffung?
Global Sourcing bezeichnet die weltweite Ausdehnung der Beschaffungsaktivitäten eines Unternehmens, um Kostenvorteile und Ressourcen auf internationalen Märkten zu nutzen.
Welche Internationalisierungsformen gibt es beim Einkauf?
Mögliche Formen sind der direkte und indirekte Import, die Einrichtung internationaler Einkaufsbüros oder Kapitalbeteiligungen an ausländischen Lieferanten.
Was ist der Unterschied zwischen zentralem und dezentralem Einkauf?
Zentraler Einkauf bündelt die Macht an einem Ort für bessere Konditionen, während dezentraler Einkauf den einzelnen Standorten mehr Flexibilität und Marktnähe ermöglicht.
Was sind die Risiken von Global Sourcing?
Zu den Risiken zählen lange Lieferzeiten, Qualitätsmängel, politische Instabilität in Schwellenländern und Währungsschwankungen.
Wann lohnt sich ein internationales Einkaufsbüro?
Es lohnt sich bei hohem Beschaffungsvolumen in einer bestimmten Region, um die Qualität vor Ort besser kontrollieren und engere Lieferantenbeziehungen pflegen zu können.
- Quote paper
- Claudia Hager (Author), 2005, Mögliche Organisationsformen im Rahmen von Global Sourcing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64320