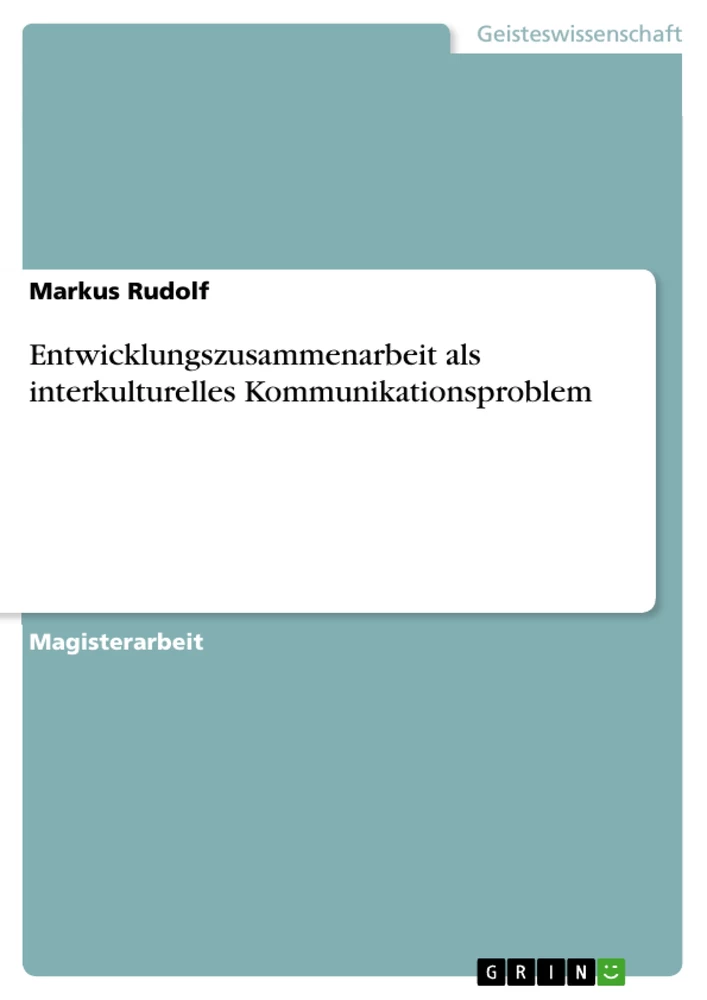Das Problem der interkulturellen Kommunikation steht nicht erst seit einer – als global erkannten – Bedrohung und der Prophezeiung vom Kampf der Kulturen im Mittelpunkt des Interesses. In einer sich vernetzenden Welt und mit der viel beschworenen Globalisierung scheinen seit längerem schon neue und vielfältige Handlungsunsicherheiten bei den Akteuren zu entstehen.
Während sich die Vernetzung rasant verstärkt, sind innerhalb dieser gegensätzliche Tendenzen zu erkennen. Die Weltgesellschaft offenbart sich immer mehr in Widersprüchen, die sich scheinbar gegenseitig bedingen: In der Individualisierung und der Vereinheitlichung der Lebensstile, in der wirtschaftlichen Differenzierung und Homogenisierung, im Freihandel und Protektionismus, in der Inklusion vieler und der Ausgrenzung anderer. In dieser komplexen, schwer zu fassenden Situation sind handlungsanleitende Übersichten und Analysen gefragt.
Aber bei den aktuellen Prozessen handelt es sich um vielfältige, sich überschneidende und verändernde Vorgänge. Es gibt nicht nur einen, einzig zum Ziel führenden Entwicklungsweg, nur eine quasi vorgezeichnete, heilsversprechende Einbahnstraße in die Zukunft. Uniforme Entwicklung erscheint unwahrscheinlich . Anstatt also monokausale Modelle und unilineare Entwicklungspfade zu suchen, geht es darum, Zusammenhänge zu ergründen. Ziel ist, die Entwicklungszusammenarbeit als Kommunikationsproblem darzustellen, ohne der facettenreicher Vielfalt den Überblick zu opfern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Sprache
- 1.1. Regeln der Sprachspiele
- 1.2. Horizont der Realität
- 1.3. Konstruktion sozialer Realität
- 2. Kommunikation
- 2.1. Miteinander Sprechen
- 2.2. Kommunikative Rationalität
- 2.3. Ausschlussmechanismen des Diskurses
- 2.4. Exkurs: Wissenschaftliche Wahrheit
- 3. Kultur
- 3.1. Genese der Kultur
- 3.2. Kontakt der Kulturen
- 3.3. Kultur als Symbolprozess
- 4. Interkulturelle Kommunikation
- 4.1. Bedingungen und Auswirkungen
- 4.2. Das Fremde und das Eigene?
- 4.3. Verstehen anderer Kulturen
- 5. Entwicklung
- 5.1. Sozialer Wandel
- 5.2. Ideologisierte Wahrnehmung
- 5.3. Antrieb des Fortschritts?
- 6. Entwicklungszusammenarbeit
- 6.1. Globale Strukturpolitik?
- 6.2. Modernisierung
- 6.3. Zivilgesellschaft und Partizipation
- 7. Modelle
- 7.1. Emanzipatorischer Dialog?
- 7.2. Kommunikative Rahmensetzung
- 7.3. Interkulturelles Handeln
- 8. Grenzen
- 8.1. Dependenzen
- 8.2. Intendierte Asymmetrien
- 8.3. System und Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Entwicklungszusammenarbeit als interkulturelles Kommunikationsproblem. Sie betrachtet dabei die jeweiligen Voraussetzungen, Grundlagen und Kontexte von Kommunikation und Entwicklung, um die Problematik der Entwicklungszusammenarbeit im Detail zu analysieren. Der Fokus liegt darauf, die Entwicklungszusammenarbeit nicht nur als pragmatisches Instrument, sondern auch als kulturelles Phänomen zu verstehen und die Grenzen und Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation in diesem Kontext zu beleuchten.
- Interkulturelle Kommunikation als Grundlage der Entwicklungszusammenarbeit
- Entwicklungszusammenarbeit als Ausdruck von Machtverhältnissen und Asymmetrien
- Kritik an der Modernisierungstheorie und monokausalen Modellen in der Entwicklungszusammenarbeit
- Die Bedeutung des Verstehens und der Transzendentalität von kulturellen Modellen
- Die Bedeutung von Kommunikation und Dialog für eine nachhaltige Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der interkulturellen Kommunikation im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit vor. Sie verweist auf die komplexen und widersprüchlichen Entwicklungen in der Weltgesellschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit.
- Kapitel 1: Sprache: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Sprache als Grundlage der Kommunikation. Es geht dabei um die Regeln der Sprachspiele, den Horizont der Realität und die Konstruktion sozialer Realität durch Sprache.
- Kapitel 2: Kommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Aspekte von Kommunikation, vom Miteinander-Sprechen bis hin zu Ausschlussmechanismen des Diskurses. Es wird auch die Frage der wissenschaftlichen Wahrheit im Kontext der Kommunikation diskutiert.
- Kapitel 3: Kultur: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der Kultur, ihrer Genese, dem Kontakt der Kulturen und der Bedeutung von Kultur als Symbolprozess.
- Kapitel 4: Interkulturelle Kommunikation: Dieses Kapitel analysiert die Bedingungen und Auswirkungen interkultureller Kommunikation und stellt die Frage nach dem Verständnis des Fremden und des Eigenen.
- Kapitel 5: Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Dimensionen von Entwicklung, dem sozialen Wandel, der ideologisierten Wahrnehmung und dem vermeintlichen Antrieb des Fortschritts.
- Kapitel 6: Entwicklungszusammenarbeit: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklungszusammenarbeit als globale Strukturpolitik, als Instrument der Modernisierung und in Bezug auf die Rolle der Zivilgesellschaft und Partizipation.
- Kapitel 7: Modelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle der Entwicklungszusammenarbeit vor, darunter der emanzipatorische Dialog, die kommunikative Rahmensetzung und das interkulturelle Handeln.
- Kapitel 8: Grenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit Dependenzen, intendierten Asymmetrien und dem Verhältnis von System und Kommunikation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Entwicklungszusammenarbeit, interkulturelle Kommunikation, Kultur, Modernisierung, Globalisierung, Machtverhältnisse, Asymmetrien, Dialog, Partizipation und Nachhaltigkeit. Sie analysiert die Herausforderungen und Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext komplexer kultureller und gesellschaftlicher Prozesse und beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation und Verständnis für eine nachhaltige Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Entwicklungszusammenarbeit ein Kommunikationsproblem?
Weil unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Sprachspiele und Realitätskonstruktionen oft zu Missverständnissen und ineffektiven Maßnahmen führen.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Entwicklungshilfe?
Sprache konstruiert soziale Realität; ohne das Verständnis der lokalen "Sprachspiele" können westliche Konzepte von Fortschritt nicht nachhaltig vermittelt werden.
Was sind intendierte Asymmetrien?
Es beschreibt das Machtgefälle zwischen Geber- und Nehmerländern, das oft trotz des Ziels der Partnerschaft die Kommunikation dominiert.
Was kritisiert die Arbeit an der Modernisierungstheorie?
Die Annahme eines einzigen, universellen Entwicklungspfades nach westlichem Vorbild, der lokale kulturelle Eigenheiten ignoriert.
Wie wichtig ist Partizipation für den Projekterfolg?
Echte Partizipation und zivilgesellschaftlicher Dialog sind essenziell, um Projekte an der Lebenswelt der Menschen auszurichten und Akzeptanz zu schaffen.
- Quote paper
- Markus Rudolf (Author), 2003, Entwicklungszusammenarbeit als interkulturelles Kommunikationsproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64405