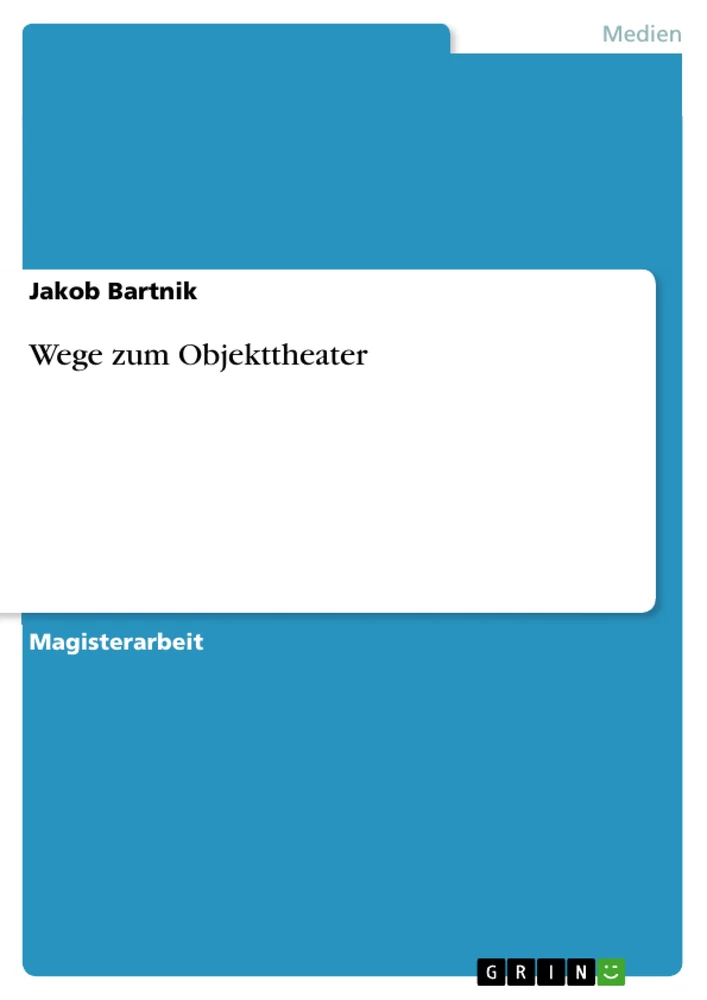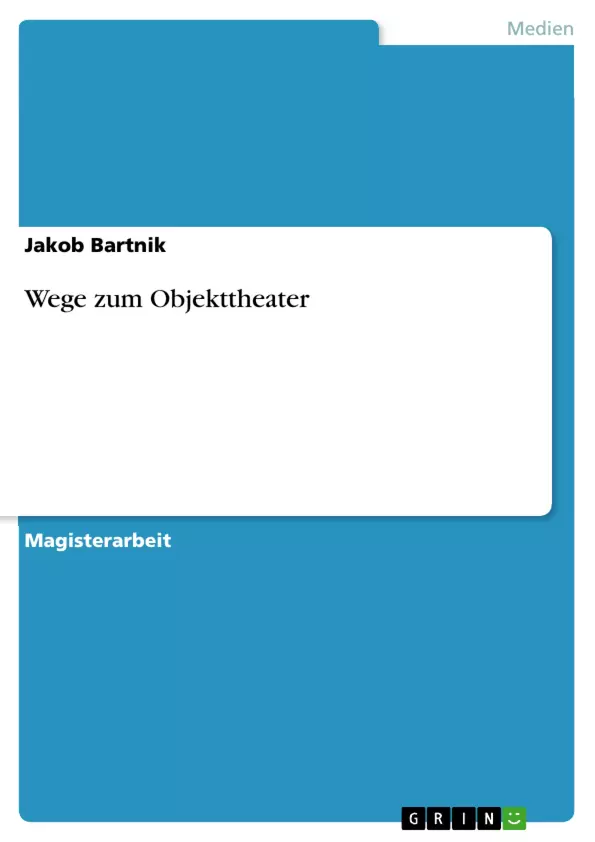Was ist mit dem Begriff Objekttheater gemeint? Lässt sich ein Oberbegriff finden? Was sind die wesentlichen darstellerischen Mittel? Mit welchen Kriterien muß dieses spezielle Theater untersucht werden? Auf welchen Wegen kann ein Theaterstück dieser Gattung erarbeitet werden? Wovon geht ein solches Stück aus? Diese Fragen werden in dieser Arbeit untersucht. Dabei gehe ich nicht nur von ästhetischen Theorien aus, sondern auch von eigenen Erfahrungen die ich mit dem Objekttheater gemacht habe. Es werden also theoretische und praktische Aspekte herangezogen, um das Phänomen des Objekttheaters zu umgrenzen. In diesem Sinne könnte die Grundfrage der Arbeit so formuliert werden: Welche theoretischen und welche praktischen Wege führen zum Objekttheater?
Dabei ist es insgesamt nicht der Anspruch der Arbeit, eine „Definition“ der Gattung des Objekttheaters zu finden. Es soll vor allem nicht bestimmt werden, was „reines Objekttheater“ sein muß. Das heißt, es wird eher eine Näherung versucht. Die wichtigsten Merkmalen, im Sinne von Symptomen, sollen herausgearbeitet werden. Dabei wird auch sichtbar werden, daß zwischen ästhetischer Theorie und künstlerischer Praxis auch einige Spannung besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Wege zum Objekttheater: Drei Ansätze.
- Die Loslösung von der traditionellen Form: Die Vorgeschichte des Objekttheaters nach Hans Hoppe
- Grundbegriffe
- Die traditionelle Form
- Widersprüche und ihre Aufhebung
- Schicksalsrequisiten und Tücke des Objekts
- Verdinglichung als inhaltliche Bedingung
- Die Entstehung der neuen Form
- Theoretische Erneuerung: Appia und Craig
- Konkrete Erneuerung: Schlemmer und Léger
- Objekte in Aktion
- Objekttheater als Form des Figurenspiels: Werner Knoedgen und das „unmögliche Theater“
- Figurentheater: Darstellung mit materiellen Mitteln
- Die Formen des Figurentheaters
- Objekttheater und Materialtheater
- Die Rollendarstellung
- Objekte
- Materialien
- Zwei Beispiele: Tuch und Stock
- Zusammenfassung
- Das Objekttheater als Bildzeichentheater: Peter Weitzners ästhetische Standpunktbestimmung
- Visuelles Theater und Objekte als Bildzeichen
- Die Rolle der Zeit
- Der Mensch als Kunstfigur
- Objekttypen und ihre theatrale Funktion
- Gebrauchsgegenstände
- Fundstücke / Objets-Trouvés
- Naturgegenstände und Material
- Gestaltete Objekte
- Der Mensch als Objekt bzw. Kunstfigur
- Das Objekt als Person: Masken und Puppen
- Der Raum als Objekt
- Das Theater des Unbekannten
- Zwischenergebnis: Grundelemente des Objekttheaters
- Praktische Wege zum Objekttheater:
- Eigene Erfahrungen im Studio Spiel und Bühne
- Erstes Beispiel: Die Inszenierung movens
- Wahl des Materials und Experimente
- Grundelemente der Inszenierung
- Die Beschaffenheit der Spieler
- Die Plastiktüten als Figuren
- Bewegungsmöglichkeiten
- Zur Objektwahl nach Knoedgen und Weitzner
- Knoedgen
- Weitzner
- Zur Inszenierung
- Endgültige Spieltechnik: Magneten
- Zusammenfassung
- Zweites Beispiel: Die Inszenierung oo
- Objekte und Experimente
- Grundelemente
- Ein- und Ausstieg
- Drehen in der Tonne
- Die Objekte
- Die Tonne als Transportmittel
- Erfindung und körperliche Disposition
- Die Spieler . . .
- Das Objekt und seine Wirkungsweise
- Ergebnis: Drei Varianten
- Das Stück oo
- 00-Solo
- Zusammenfassung
- Drittes Beispiel: 176 x 178
- Der Stock als Figur
- Stock und Körper
- Eigene Experimente
- Die Bewegung
- Rahmen und Raum
- Der Spieler
- Zur Bilderfolge
- Materialtheater im Lokschuppen
- Zusammenfassung
- Die Vorgeschichte des Objekttheaters und die Loslösung von der traditionellen Form
- Die Einordnung des Objekttheaters als Form des Figurenspiels
- Das Objekttheater als Bildzeichentheater und die Rolle der Objekte als visuelle Elemente
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Inszenierung mit Objekten
- Die Verknüpfung von theoretischen Konzepten mit praktischen Erfahrungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, das Phänomen des Objekttheaters zu erforschen und zu umgrenzen. Dabei werden sowohl theoretische Ansätze als auch praktische Erfahrungen im Studio Spiel und Bühne herangezogen, um die wesentlichen Merkmale dieser besonderen Theaterform zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen zum Objekttheater. Kapitel 1.1 beleuchtet die Vorgeschichte dieser Theaterform, ausgehend von Hans Hoppes Analysen der traditionellen Form und ihren Widersprüchen. In Kapitel 1.2 wird das Objekttheater im Kontext des Figurenspiels durch die Überlegungen von Werner Knoedgen betrachtet, der den Schwerpunkt auf die Möglichkeiten der Materialität legt. Kapitel 1.3 präsentiert Peter Weitzners ästhetische Sichtweise auf das Objekttheater als Bildzeichentheater, die sich auf die visuelle Gestaltung und die Bedeutung von Zeit und Raum konzentriert.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den praktischen Erfahrungen des Autors im Studio Spiel und Bühne. Kapitel 2.1 stellt die Inszenierung „movens“ vor, wobei der Fokus auf die Wahl des Materials, die experimentelle Arbeit und die Grundelemente der Inszenierung liegt. Kapitel 2.2 beleuchtet die Inszenierung „oo“, die sich mit den Möglichkeiten der Bewegung und der Interaktion von Objekten und Spielern auseinandersetzt. Kapitel 2.3 befasst sich schließlich mit dem Stück „176 x 178“, das die Verwendung des Stocks als Figur und die daraus resultierenden Bewegungsmöglichkeiten in den Vordergrund stellt.
Schlüsselwörter
Objekttheater, Figurentheater, Bildzeichentheater, Materialtheater, Inszenierung, Objekte, Material, Raum, Bewegung, Zeit, visuelle Gestaltung, traditionelle Form, Spieltechnik, Praxis, Theorie.
- Citation du texte
- Jakob Bartnik (Auteur), 2004, Wege zum Objekttheater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64421