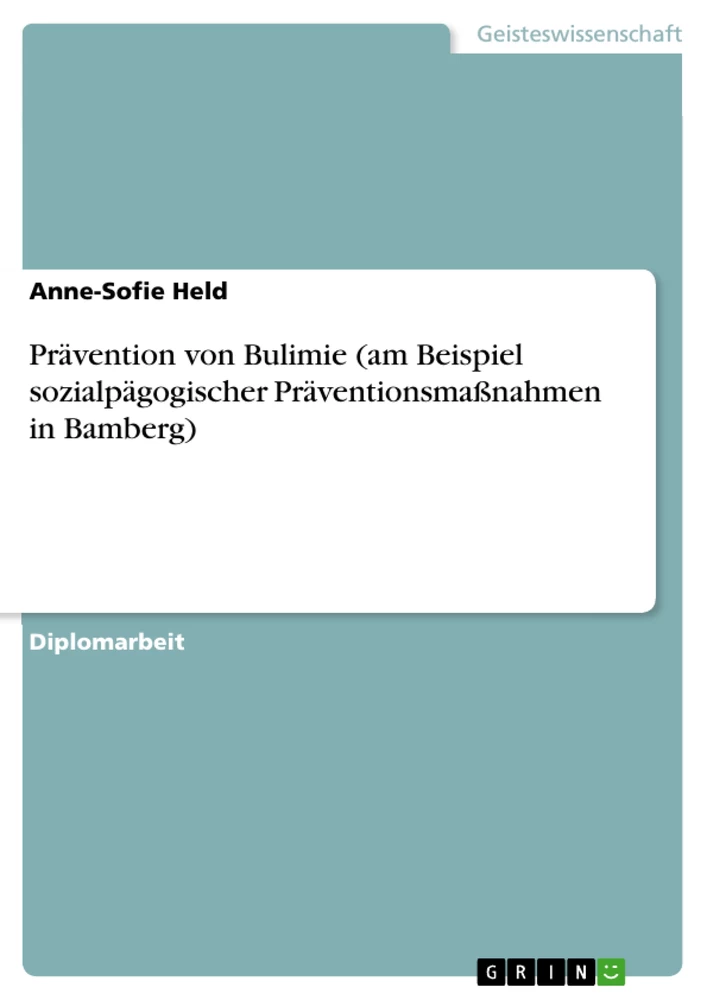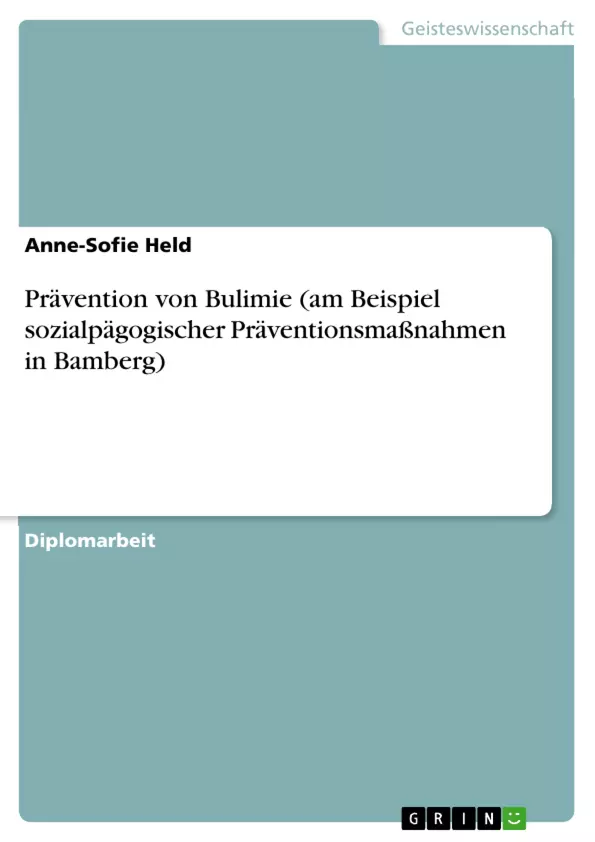„Über 50% der nicht so topmodeligen Deutschen sind zu dick“ und „Jedes zehnte Kind in Deutschland leidet an Fettleibigkeit“. Diese und andere Schlagzeilen liest man in letzter Zeit immer häufiger. Laut dem Ernährungsbericht 2004 der deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e.V. sind mehr als 65% der Männer und ca. 55% der Frauen in Deutschland übergewichtig. Solche Zahlen sind immer Definitionssache - Wo fängt Übergewicht an? Und wer bestimmt überhaupt, ab wann ein Mensch übergewichtig ist? Dieses Thema soll später an anderer Stelle erörtert werden. Hier geht es vielmehr darum, dass die Ergebnisse auf eine satte und zufriedene Wohlstandsgesellschaft hindeuten.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Deutschen sind keineswegs zufrieden, wofür Pudel und Westenhöfer in einer eigenen Untersuchung Bestätigung fanden: „Weniger als 15% der Bevölkerung entsprechen ihren selbstgewählten Idealvorstellungen“ (ebd. 1998, S. 198). In unserer Gesellschaft hat sich in den letzten 40 Jahren ein Körperideal entwickelt, dass sich immer weiter vom realen Körperbild entfernt. Während die Ernährungswissenschaftler von einer drohenden Verfettung der deutschen Bevölkerung sprechen, bewegen sich immer mehr Models auf ein lebensbedrohliches Untergewicht zu. Wissenschaftler der Universität Ontario in Kanada stellten bei einer Untersuchung von 240 Playmates aus den Jahren 1978 bis 1998 fest, dass 70 Prozent dieser Mädchen mit einem BMI von unter 18,1 untergewichtig sind (vgl. Katzmarzyk und Davis 2001), wobei diese Models in der Regel noch ein paar Kilo mehr auf die Waage bringen, als die Models der internationalen Modeagenturen. Diäten haben seitdem Hochkonjunktur. Der Wunsch, schlank zu sein, wird heute nicht mehr nur durch die Frühjahrsausgaben diverser Frauenzeitschriften bestimmt, sondern setzt sich langsam als Norm unserer westlichen Gesellschaft durch, der sich vor allem Jugendliche immer mehr unterordnen. Es herrscht die verbreitete Illusion, dass ein schlanker Körper zu Erfolg, Beliebtheit, Schönheit und Gesundheit verhelfe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Essverhalten und Bulimie bei Jugendlichen
- 2.1 Gestörtes Essverhalten – Normalität und Abweichung
- 2.2 Bulimie
- 3. Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen als Aufgabe der Sozialpädagogik
- 3.1 Prävention
- 3.2 Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen
- 4. Präventionsmaßnahmen sozialer Institutionen in Bamberg
- 4.1 Prävention von Essstörungen in Bamberg – Ein Überblick
- 4.2 Interviews mit Betroffenen
- 4.3 Zusammenfassung und Diskussion der Prävention von Essstörungen in Bamberg
- 5. Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht präventive Maßnahmen gegen Bulimie bei Jugendlichen in Bamberg. Ziel ist es, bestehende Strategien und Ansätze sozialpädagogischer Präventionsarbeit zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Prävention im Kontext des gesellschaftlichen Drucks auf ein bestimmtes Körperideal.
- Bulimie als Essstörung: Ursachen, Symptome und Folgen
- Präventionsstrategien in der Sozialpädagogik: Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention
- Analyse bestehender Präventionsmaßnahmen in Bamberg
- Die Rolle sozialer Institutionen und deren Kooperationsmöglichkeiten
- Betroffenenperspektiven und deren Bedeutung für die Präventionsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit aktuellen Schlagzeilen über Übergewicht und Fettleibigkeit in Deutschland, um den Kontext der Arbeit zu setzen. Sie hebt den Widerspruch zwischen den Statistiken über Übergewicht und dem gleichzeitig existierenden gesellschaftlichen Druck auf Schlankheit hervor, besonders bei Jugendlichen. Die zunehmende Verbreitung von Diäten und der Wunsch nach einem schlanken Körper als Weg zu Erfolg und Beliebtheit werden als zentrale Problematik dargestellt, die letztendlich zu Essstörungen wie Bulimie beitragen können.
2. Essverhalten und Bulimie bei Jugendlichen: Dieses Kapitel beschreibt gestörtes Essverhalten und Bulimie im Detail. Es differenziert zwischen normalem und gestörtem Essverhalten, beleuchtet die historische Entwicklung der Bulimie, ihre Klassifizierungskriterien, Verlaufsformen und Prävalenz. Ein besonderer Fokus liegt auf den Risikofaktoren, wie gesellschaftlichem Druck, körperlicher und sexueller Missbrauch, dysfunktionalen Familienstrukturen und geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen. Schließlich werden die physischen und psychischen Folgen der Bulimie behandelt.
3. Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen als Aufgabe der Sozialpädagogik: Das Kapitel erläutert den Begriff der Prävention und unterscheidet zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention sowie Verhaltens- und Verhältnisprävention. Es untersucht die Strategien und Ziele der Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen, betrachtet die relevanten Zielgruppen (Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Ärzte) und beschreibt methodische Ansätze der Präventionsarbeit. Die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung sowie die Grenzen der Prävention werden ebenfalls thematisiert.
4. Präventionsmaßnahmen sozialer Institutionen in Bamberg: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über Präventionsmaßnahmen in Bamberg, einschließlich Schulveranstaltungen, Wanderausstellungen, Informationsveranstaltungen für Eltern, Multiplikatorenschulungen, Arbeitskreise und Beratungsangebote verschiedener Institutionen. Ein wichtiger Teil des Kapitels ist die Darstellung von Interviews mit Betroffenen, deren Erkenntnisse für die Präventionsarbeit relevant sind. Die methodische Vorgehensweise bei der Interviewführung und die Auswertung der Ergebnisse werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Bulimie, Essstörung, Prävention, Sozialpädagogik, Jugendliche, Bamberg, Risikofaktoren, Präventionsmaßnahmen, Körperbild, gesellschaftlicher Druck, Interviews, Betroffenenperspektiven, Kooperation, Vernetzung.
FAQ: Präventive Maßnahmen gegen Bulimie bei Jugendlichen in Bamberg
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht präventive Maßnahmen gegen Bulimie bei Jugendlichen in Bamberg. Ziel ist die Analyse und Bewertung bestehender Strategien und Ansätze sozialpädagogischer Präventionsarbeit, unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Drucks auf ein bestimmtes Körperideal.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Bulimie als Essstörung (Ursachen, Symptome, Folgen), Präventionsstrategien in der Sozialpädagogik (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention), die Analyse bestehender Präventionsmaßnahmen in Bamberg, die Rolle sozialer Institutionen und deren Kooperationsmöglichkeiten sowie Betroffenenperspektiven und deren Bedeutung für die Präventionsarbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Essverhalten und Bulimie bei Jugendlichen, Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen als Aufgabe der Sozialpädagogik, Präventionsmaßnahmen sozialer Institutionen in Bamberg und Diskussion und Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen.
Wie wird Bulimie in der Arbeit dargestellt?
Kapitel 2 beschreibt Bulimie detailliert, einschließlich ihrer historischen Entwicklung, Klassifizierungskriterien, Verlaufsformen, Prävalenz und Risikofaktoren (gesellschaftlicher Druck, Missbrauch, familiäre Strukturen, geschlechtsspezifische Rollenerwartungen). Die physischen und psychischen Folgen werden ebenfalls behandelt.
Wie wird Prävention in der Arbeit definiert und betrachtet?
Kapitel 3 erläutert den Begriff der Prävention (primär, sekundär, tertiär, verhaltens- und verhältnispräventiv) im Kontext von Essstörungen bei Jugendlichen. Es untersucht Strategien und Ziele, relevante Zielgruppen (Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Ärzte) und methodische Ansätze der Präventionsarbeit, Kooperation, Vernetzung und die Grenzen der Prävention.
Welche Präventionsmaßnahmen in Bamberg werden untersucht?
Kapitel 4 gibt einen Überblick über Präventionsmaßnahmen in Bamberg (Schulveranstaltungen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Schulungen, Arbeitskreise, Beratungsangebote). Interviews mit Betroffenen und deren Auswertung spielen eine wichtige Rolle in diesem Kapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bulimie, Essstörung, Prävention, Sozialpädagogik, Jugendliche, Bamberg, Risikofaktoren, Präventionsmaßnahmen, Körperbild, gesellschaftlicher Druck, Interviews, Betroffenenperspektiven, Kooperation, Vernetzung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, bestehende Strategien und Ansätze sozialpädagogischer Präventionsarbeit gegen Bulimie bei Jugendlichen in Bamberg zu analysieren und zu bewerten. Sie beleuchtet die Bedeutung von Prävention im Kontext des gesellschaftlichen Drucks auf ein bestimmtes Körperideal.
- Citar trabajo
- Anne-Sofie Held (Autor), 2006, Prävention von Bulimie (am Beispiel sozialpägogischer Präventionsmaßnahmen in Bamberg), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64451