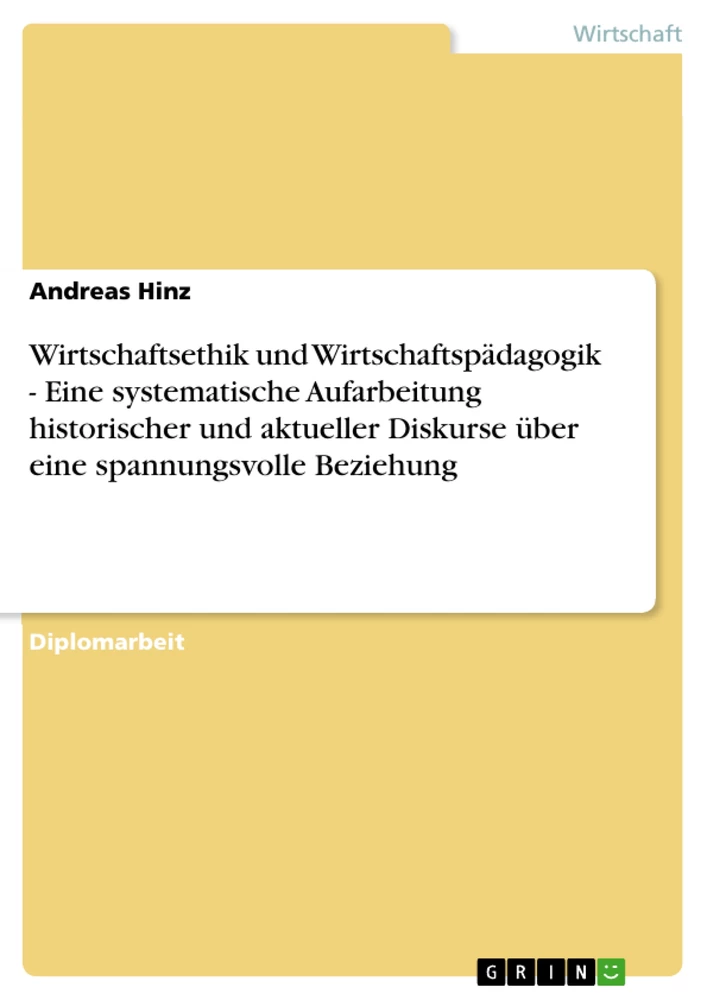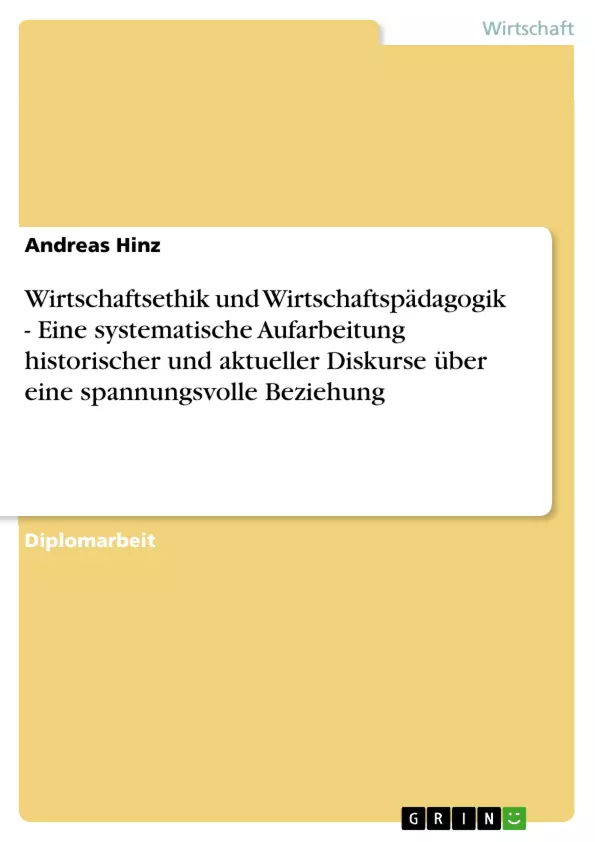Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen die Religion die Antworten gab oder der Staat Handlungsvorgaben machte, müsse moralisches Verhalten heute in jeder Situation neu definiert werden. Moralisches Verhalten (in jeder Situation) neu zu definieren, scheint auch der Berufs- und Wirtschaftspädagoge Prof. Dr. Klaus Beck zu versuchen, wenn er im Kontext der „Revision der kaufmännischen Moralerziehung“ von der „Betriebsmoral“ spricht. Seine Empfehlungen zur kaufmännischen Moralerziehung werden von Jürgen Zabeck aufs Schärfste kritisiert und verurteilt, so dass es im Rahmen zahlreicher Veröffentlichungen zu einer heftigen Diskussion kommt.
Dieser Streit soll Ausgangspunkt dieser Arbeit sein und stellt gleichzeitig eine Art Kompass dar, mit dessen Hilfe durch das unendlich groß erscheinende Meer der Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik navigiert werden soll. Beide Standpunkte werden dargestellt, zuvor soll aber auf die Argumentationsgrundlagen (Immanuel Kant, Adam Smith, der Utilitarismus) beider Kontrahenten eingegangen werden, um deren Argumente (besser) verstehen und bewerten zu können.
Beck definiert Moral aus „Sicht der neoklassischen ökonomischen Theorie als ein knappes Gut, das durch Konsumverzicht gebildet wird, um dauerhafte Erträge abzuwerfen“ . Beck ist der Meinung, dass universalistische Ethikansichten (siehe Zabeck) in Zeiten der Globalisierung und moderner pluralistischer Großgesellschaften nicht mehr zweckmäßig, son-dern realitätsfern seien und rechtfertigt damit „die wirksameren Binnenmoralen“ . Im Ge-gensatz zur universalistischen Morallehre sieht er keinen Konflikt darin, wenn Kaufleute sich im Beruf moralisch anders verhalten als im Privatleben.
Zabeck ist der Ansicht, dass Becks „als eine Bereichsmoral konstituierende Betriebsmoral“ den einzelnen streng darauf verpflichte, „seine Handlungen dem betrieblichen Vorteilsstreben zu subsumieren“ und verurteilt Becks Überlegungen zur kaufmännischen Moralerziehung. Zabeck vertritt eine universalistische und philosophisch begründete Morallehre.
Im Rahmen seiner Argumentation stellt Zabeck der Theorie Lawrence Kohlbergs das „Stufenkonzept ethischer Begründungen und Entscheidungen“ des Philosophen Hermann Krings entgegen, um darzustellen, welchen „ethischen Ansprüchen Handlungsbegründungen genügen müssen“.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 1. Einführung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Problemstellung
- 1.2.1 Klaus Becks Binnenmoral
- 1.2.2 Jürgen Zabecks universalistische Morallehre
- 1.2.3 Präzisierung der Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- 2. Einführung in die Begriffe der Ethik
- 2.1 Ethik
- 2.2 Moral
- 2.3 Formen der Ethik
- 2.4 Sozialethik, Individualethik & Individualismus, Institutionenethik und Institutionenökonomik
- 2.5 Wirtschaftsethik
- 2.6 Werte, Normen, Wertethik & Pluralismus der Werte
- 3. Die Entwicklung des Wirtschaftsdenkens seit der Antike
- 3.1 Wirtschaftsdenken im Zeitalter der Antike
- 3.2 Wirtschaftsdenken im Mittelalter
- 3.3 Wirtschaftsdenken seit der Neuzeit
- 3.4 Die Entstehung und Weiterentwicklung der Nationalökonomie – Die klassische Phase
- 3.5 Die Entsoziologisierung der ökonomischen Theorie – Die neoklassische Phase
- 3.6 Vorläufer der ethisch-praktischen Revision bisheriger Wirtschaftstheorie
- 4. Moralphilosophische Denkrichtungen – Die Argumentationsgrundlagen Becks und Zabecks
- 4.1 Die transzendentale Ethik Immanuel Kants
- 4.2 Adam Smith über Mensch, Wirtschaft, Ethik, Politik und Erziehung
- 4.3 Utilitaristisches Gedankengut
- 5. Beck und Zabeck zur kaufmännischen Moralerziehung
- 5.1 Ein Überblick
- 5.2 Klaus Beck zur Moralerziehung (1996-2002)
- 5.2.1 Grundlegung, Motive und Skizzierung der Revision der Berufserziehung
- 5.2.2 Klaus Beck zur Betriebs- und Berufsmoral
- 5.2.3 Klaus Beck zur Theorie der moralischen Urteilsbildung – Lawrence Kohlbergs Stufenmodell
- 5.2.3.1 Aufbau der Stufentheorie Lawrence Kohlbergs
- 5.2.3.2 Anwendung und Kritik der Kohlbergtheorie – Ergebnisse und Schlussfolgerungen Becks Forschungsprojekts
- 5.2.4 Pädagogische Implikationen und didaktische Folgeproblem
- 5.3 Jürgen Zabeck zur Moralerziehung – Kritik an Klaus Becks Revision der Berufserziehung
- 5.3.1 Grundlegung, Motive und Skizzierung Zabecks Kritik
- 5.3.2 Zur Problematik des Beckschen Moralbegriffs und der Ethik
- 5.3.3 Zabeck zur Stufentheorie Lawrence Kohlbergs
- 5.3.4 Perspektiven einer kaufmännischen Moralerziehung jenseits des ethischen Partialismus
- 5.3.4.1 Das Stufenkonzept Hermann Krings
- 5.3.4.2 Pädagogische Implikationen
- 5.4 Klaus Beck zur Moralerziehung (seit 2002)
- 6. Versuch einer Synthese und deren pädagogische Implikationen
- 7. Schlussbetrachtung
- ANHANG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der spannungsvollen Beziehung zwischen Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik. Sie verfolgt das Ziel, die historischen und aktuellen Diskurse zu dieser Beziehung systematisch aufzuarbeiten. Die Arbeit analysiert dabei verschiedene philosophische Denkrichtungen, die für die Debatte relevant sind, und untersucht die Ansätze von Klaus Beck und Jürgen Zabeck zur kaufmännischen Moralerziehung.
- Die Entwicklung des Wirtschaftsdenkens von der Antike bis zur Gegenwart
- Die Relevanz ethischer Prinzipien in der Wirtschaftswissenschaft
- Die Bedeutung der Moralerziehung in der kaufmännischen Berufsausbildung
- Die Kritik an der konventionellen ökonomischen Rationalität und die Notwendigkeit einer ethischen Erweiterung
- Die Analyse unterschiedlicher Ansätze zur kaufmännischen Moralerziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Thema der Diplomarbeit ein und stellt die Motivation und Problemstellung dar. Es werden die Konzepte der Binnenmoral von Klaus Beck und der universalistischen Morallehre von Jürgen Zabeck vorgestellt.
- Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe Ethik und Moral und beleuchtet verschiedene Formen der Ethik sowie die Bereiche der Sozialethik, Individualethik, Individualismus, Institutionenethik, Institutionenökonomik und Wirtschaftsethik. Es werden außerdem die Konzepte der Werte, Normen, Wertethik und des Pluralismus der Werte diskutiert.
- Kapitel 3 analysiert die Entwicklung des Wirtschaftsdenkens von der Antike bis zur Gegenwart, einschließlich der klassischen und neoklassischen Phase. Es werden wichtige Vorläufer der ethisch-praktischen Revision bisheriger Wirtschaftstheorie betrachtet.
- Kapitel 4 beleuchtet die Argumentationsgrundlagen von Beck und Zabeck im Kontext moralphilosophischer Denkrichtungen, insbesondere der transzendentalen Ethik Immanuel Kants, der Moraltheorie Adam Smiths und des utilitaristischen Gedankenguts.
- Kapitel 5 widmet sich den Ansätzen von Beck und Zabeck zur kaufmännischen Moralerziehung. Es werden die Grundlegung, Motive und Skizzierung der Revision der Berufserziehung durch Klaus Beck sowie seine Ansichten zu Betriebs- und Berufsmoral, der Theorie der moralischen Urteilsbildung nach Lawrence Kohlberg und den pädagogischen Implikationen betrachtet. Anschließend werden die Kritik von Jürgen Zabeck an Becks Revision der Berufserziehung, seine Positionen zur Problematik des Beckschen Moralbegriffs, seine Sichtweise auf Kohlbergs Stufentheorie und die Perspektiven einer kaufmännischen Moralerziehung jenseits des ethischen Partialismus untersucht.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Wirtschaftsethik, Wirtschaftspädagogik, kaufmännischer Moralerziehung, philosophischen Denkrichtungen, transzendentaler Ethik, Utilitarismus, moralische Urteilsbildung, Lawrence Kohlberg, Klaus Beck, Jürgen Zabeck und ethischer Partialismus. Es werden die Konzepte der Binnenmoral und der universalistischen Morallehre sowie die Kritik an der konventionellen ökonomischen Rationalität im Kontext der ethischen Erweiterung des Wirtschaftsdenkens untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Streit zwischen Klaus Beck und Jürgen Zabeck?
Es handelt sich um eine Diskussion über die kaufmännische Moralerziehung, wobei Becks „Binnenmoral“ gegen Zabecks „universalistische Morallehre“ steht.
Was versteht Klaus Beck unter „Binnenmoral“?
Beck sieht Moral als knappes Gut und rechtfertigt bereichsspezifische Verhaltensweisen im Beruf, die von privaten Moralvorstellungen abweichen können.
Was kritisiert Jürgen Zabeck an Becks Ansatz?
Zabeck lehnt den ethischen Partialismus ab und vertritt eine universelle Moral, die auf philosophischen Grundlagen wie denen von Immanuel Kant basiert.
Welche Rolle spielt Lawrence Kohlberg in dieser Debatte?
Becks Forschung nutzt Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Urteilsbildung, während Zabeck diesem das Stufenkonzept von Hermann Krings entgegenstellt.
Welches Ziel verfolgt die Diplomarbeit?
Die Arbeit will die historische Entwicklung des Wirtschaftsdenkens aufarbeiten und eine Synthese der pädagogischen Implikationen für die Wirtschaftsethik finden.
- Arbeit zitieren
- Andreas Hinz (Autor:in), 2006, Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik - Eine systematische Aufarbeitung historischer und aktueller Diskurse über eine spannungsvolle Beziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64668