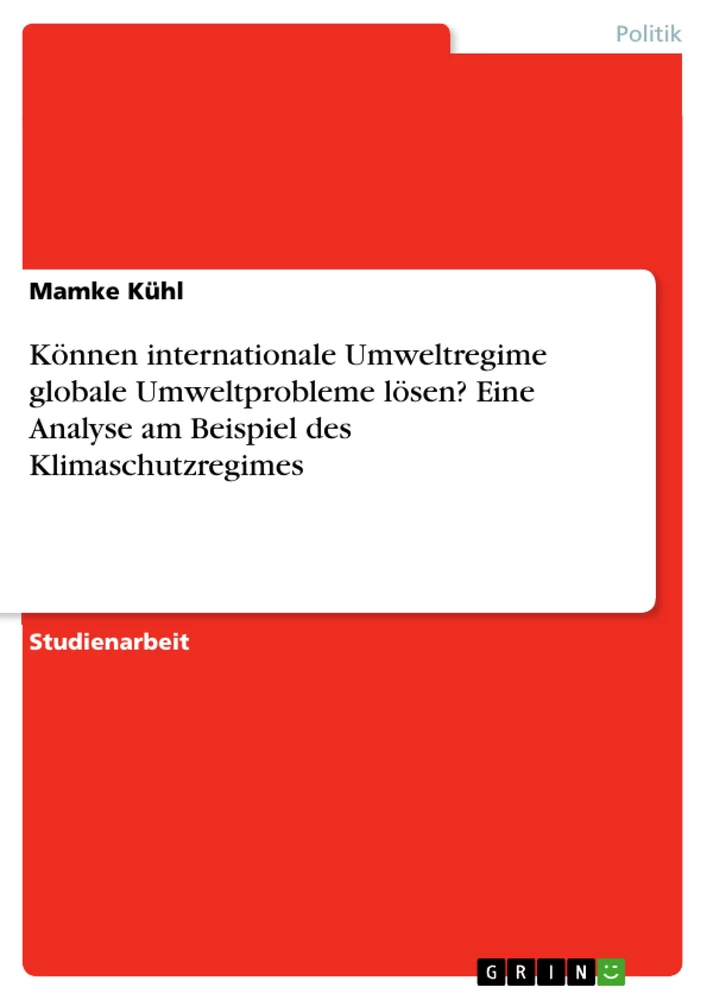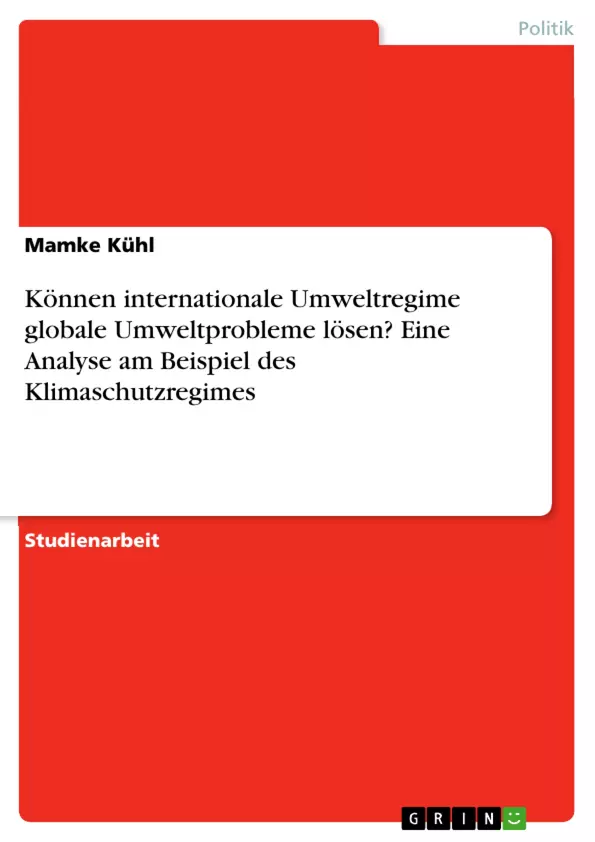„Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sieht sich die Menschheit einer historisch einmaligen Bedrohung gegenüber: Die zivilisatorische Selbstgefährdung als Folge der drohenden Klimakatastrophe kann nur durch entschiedene Schritte in den nächsten ein bis zwei Generationen, also innerhalb der nächsten 20 bis 40 Jahre, abgewendet werden. Die Nutzung der Atmosphäre als Müllkippe für die vom Menschen verursachten Treibhausgase hat eine unumkehrbare Erwärmung der Erde in Gang gesetzt. Wenn der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, vor allem durch die Verbrennung fossiler Energien, weiter zunimmt, droht ein flächendeckender Zusammenbruch der ökologischen und gesellschaftlichen Systeme. Die Zukunft der Menschheit hängt somit von der Fähigkeit der Völkergemeinschaft ab, wirksame Maßnahmen zur Abwehr der schlimmsten Klimagefahren sowie zur Anpassung an die heute schon nicht mehr aufzuhaltenden Erwärmung zu ergreifen“(Fues 2003: 195). Das Zitat von Thomas Fues zeigt deutlich, wie dringend und zeitnah das Problem der globalen Klimaveränderung von der internationalen Staatengemeinschaft gelöst werden muss. Die Erkenntnis, dass Nationalstaaten allein den bestehenden globalen Umweltproblemen nicht mehr Herr werden können, zieht als logische Konsequenz die Frage nach sich, wie sich diese Probleme im internationalen System lösen lassen. Einen Lösungsansatz bieten internationale Regime. Ob diese Art von internationaler Zusammenarbeit jedoch eine Lösung von globalen Umweltproblemen darstellt, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Um mich der Beantwortung der Frage theoretisch zu nähern, werde ich zunächst allgemein die Regimetheorie als Erklärungsansatz für Kooperation im internationalen System vorstellen. Im Folgenden werde ich dann auf die Entwicklung und Funktion von internationalen Umweltregimes eingehen. Um zu prüfen, ob und inwieweit internationale Regime eine Lösung für globale Umweltprobleme darstellen, werde ich das sogenannte internationale Klimaregime vorstellen. Da die Verhandlungen über eine internationale Klimapolitik bis zum heutigen Tage noch nicht abgeschlossen sind, wird mein besonderer Augenmerk auf den Verhandlungen zu einer Klimarahmenkonvention im Rahmen des International Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC), der United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro sowie auf dem sogenannten Kyoto-Protokoll von 1997 liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Die Regimetheorie
- Entwicklung und Funktion von internationalen Umweltregimes
- Die Entwicklung der internationalen Klimapolitik
- Verhandlungen über eine globale Klimarahmenkonvention (KRK)
- Ergebnisse der Rahmenkonvention von Rio de Janeiro
- Das Kyoto-Protokoll
- Fazit / Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob internationale Regime globale Umweltprobleme lösen können. Der Fokus liegt auf der Analyse des internationalen Klimaregimes als Beispiel. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Regimes, berücksichtigt dabei die Verhandlungen zur Klimarahmenkonvention und zum Kyoto-Protokoll, und bewertet schließlich den Erfolg des Regimes.
- Die Regimetheorie als Erklärungsansatz für internationale Kooperation
- Die Entwicklung und Funktion internationaler Umweltregime
- Die Herausforderungen der internationalen Klimapolitik
- Die Rolle nationaler Interessen (USA und EU)
- Bewertung des Erfolgs des internationalen Klimaregimes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Dringlichkeit des Problems der globalen Klimaveränderung und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Lösungsfähigkeit internationaler Regime für globale Umweltprobleme und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse des internationalen Klimaregimes, insbesondere der Verhandlungen zur Klimarahmenkonvention und zum Kyoto-Protokoll.
Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel führt in die Regimetheorie ein, einen Erklärungsansatz für Kooperation im internationalen System, insbesondere im Kontext von Umweltpolitik. Es hebt die Bedeutung von Institutionen in einer anarchisch strukturierten Welt hervor und differenziert sich vom Neorealismus, indem es den Fokus auf internationale Zusammenarbeit legt. Das Kapitel beleuchtet die Entstehung der Regimetheorie in den 1970er und 80er Jahren und ihre zentrale These, dass selbst in Abwesenheit einer zentralen Herrschaftsinstanz Kooperation durch internationale Regime möglich ist. Die Rolle nationaler Interessen und das rationale Handeln von Staaten im internationalen System werden als wichtige Faktoren für die Entstehung und den Erfolg von Regimen hervorgehoben.
Die Entwicklung der internationalen Klimapolitik: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der internationalen Klimapolitik, beginnend mit den Verhandlungen über eine globale Klimarahmenkonvention. Es analysiert die Ergebnisse der UNCED 1992 in Rio de Janeiro und die Entstehung des Kyoto-Protokolls von 1997. Der Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Kompromissen bei der Aushandlung internationaler Abkommen im Kontext von unterschiedlichen nationalen Interessen. Die Schwierigkeiten, ein verbindliches und effektives globales Klimaschutzregime zu etablieren, werden beleuchtet. Das Kapitel zeigt auf, wie die Interessen verschiedener Staaten, besonders der USA und der EU, die Verhandlungen und die Ergebnisse beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Internationale Regime, Umweltpolitik, Klimawandel, Klimarahmenkonvention, Kyoto-Protokoll, Regimetheorie, Neoinstitutionalismus, internationale Kooperation, nationale Interessen, USA, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Internationale Regime und globale Umweltprobleme - Analyse am Beispiel der internationalen Klimapolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob internationale Regime globale Umweltprobleme lösen können. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des internationalen Klimaregimes als Beispiel. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung des Regimes, berücksichtigt die Verhandlungen zur Klimarahmenkonvention und zum Kyoto-Protokoll, und bewertet schließlich den Erfolg des Regimes.
Welche Theorie wird verwendet?
Die Arbeit nutzt die Regimetheorie als Erklärungsansatz für internationale Kooperation im Kontext der Umweltpolitik. Sie beleuchtet die Bedeutung internationaler Institutionen und unterscheidet sich damit vom Neorealismus, indem sie den Fokus auf internationale Zusammenarbeit legt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Regimetheorie, die Entwicklung und Funktion internationaler Umweltregime, die Herausforderungen der internationalen Klimapolitik, die Rolle nationaler Interessen (insbesondere der USA und der EU) und eine Bewertung des Erfolgs des internationalen Klimaregimes. Konkret werden die Verhandlungen über die Klimarahmenkonvention und das Kyoto-Protokoll analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zum theoretischen Rahmen (Regimetheorie), einem Kapitel zur Entwicklung der internationalen Klimapolitik (inkl. der Verhandlungen zu KRK und Kyoto-Protokoll) und einem Fazit/Bewertung. Die Einleitung beschreibt die Problematik des Klimawandels und stellt die Forschungsfrage. Der theoretische Rahmen erläutert die Regimetheorie. Das Kapitel zur Klimapolitik analysiert die Verhandlungen und die Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit. Das Fazit bewertet den Erfolg des internationalen Klimaregimes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Internationale Regime, Umweltpolitik, Klimawandel, Klimarahmenkonvention, Kyoto-Protokoll, Regimetheorie, Neoinstitutionalismus, internationale Kooperation, nationale Interessen, USA, Europäische Union.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne detaillierte Ergebnisse)?
Das Fazit bewertet den Erfolg des internationalen Klimaregimes basierend auf der Analyse der Entstehung, Entwicklung und der Herausforderungen bei der internationalen Kooperation im Bereich des Klimawandels. (Die konkreten Ergebnisse der Bewertung sind nicht in diesem FAQ enthalten.)
Welche Rolle spielen nationale Interessen?
Die Arbeit untersucht, wie nationale Interessen, insbesondere der USA und der EU, die Verhandlungen und die Ergebnisse der internationalen Klimapolitik beeinflusst haben. Die unterschiedlichen nationalen Interessen stellen eine zentrale Herausforderung für die Erreichung eines effektiven globalen Klimaschutzregimes dar.
- Citation du texte
- Mamke Kühl (Auteur), 2005, Können internationale Umweltregime globale Umweltprobleme lösen? Eine Analyse am Beispiel des Klimaschutzregimes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64669