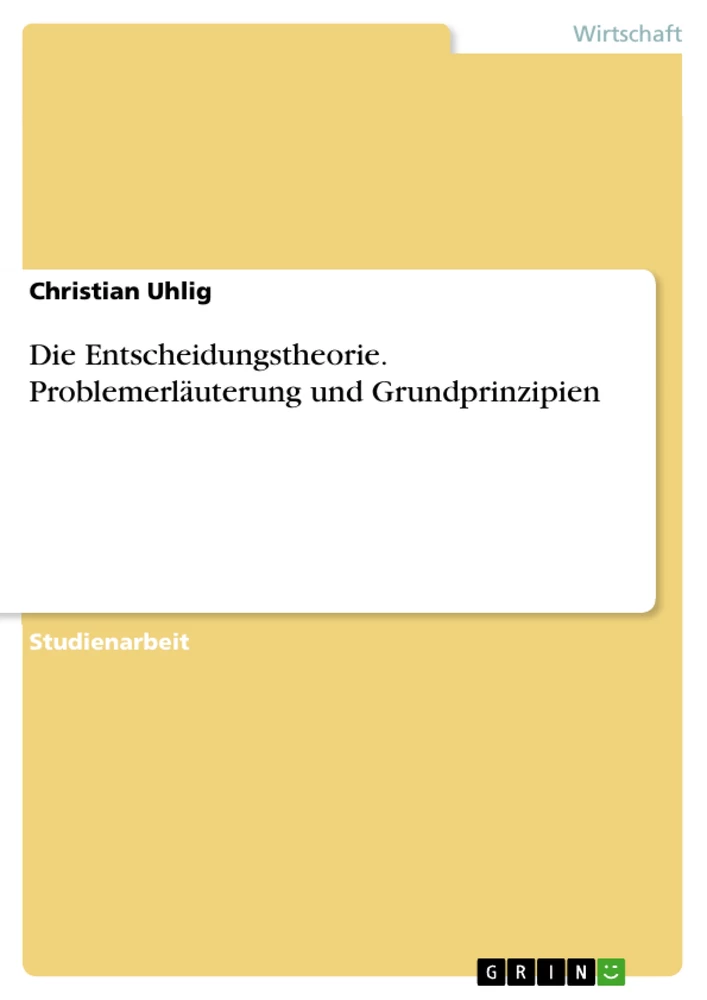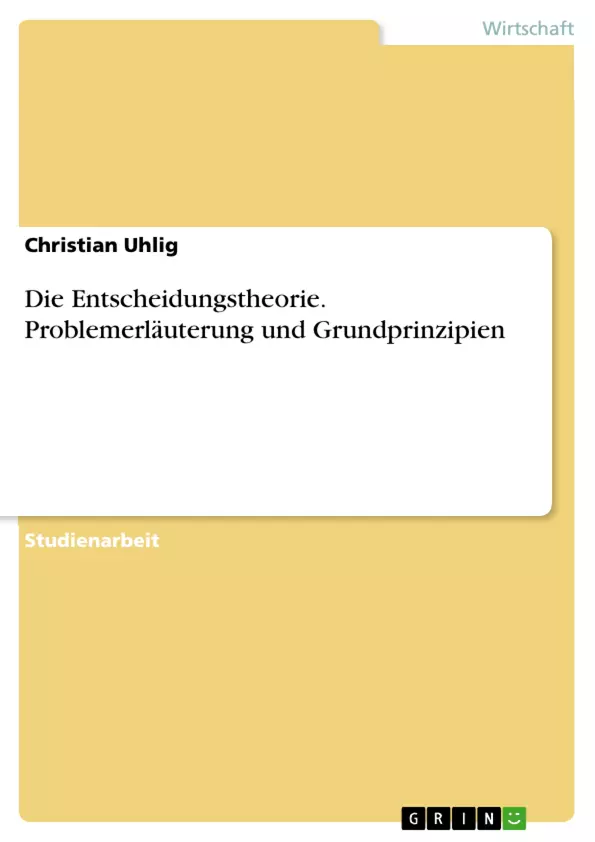„Ich überlege. Mein Bauch entscheidet.“ Max Grundig (1908-89), dt. Industrieller.
Der Patriarch Max Grundig hat dank seines Gespürs in der Zeit des Wirtschaftswunders aus einem kleinen Radiogeschäft einen international tätigen Unterhaltungselektronikkonzern geschaffen. Mitte der siebziger Jahre verließ ihn aber das Glück und der Konzern rutschte unter seiner Führung in die Verlustzone. Vielleicht wäre die moderne Entscheidungstheorie ihm zur damaligen Zeit ein besserer Ratgeber gewesen und die Entwicklung wäre anders verlaufen. Im privaten und beruflichen Leben müssen jeden Tag Entscheidungen getroffen werden, allein oder gemeinsam in Gruppen. Das Problem der Entscheidung ist für alle Individuen von existentieller Bedeutung. Ob ein Manager über die Schließung eines Werkes entscheiden muss oder ein Schüler über die Fortsetzung seiner Schullaufbahn. Beide Entscheidungen beeinflussen die Lebensbedingungen des Entscheidungsträgers und in Konsequenz auch die anderer. Tatsache ist, dass der Mensch Schwierigkeiten mit neuartigen, nicht routinisierten Entscheidungssituationen hat. Psychologen haben festgestellt, dass er bei der Entscheidungsfindung zu systematischen Fehlern neigt. Diese intuitiven Fehler zu minimieren, ist Ziel der Entscheidungstheorie. Das Formulieren und Lösen von Entscheidungen ist zu einem wissenschaftlichen Thema ge-worden. Die präskriptive Entscheidungstheorie soll dabei den Menschen bei komplizierten Entscheidungen unterstützen. Entscheidungsregeln für rationales Handeln - d. h. die theoretisch richtige Entscheidung - werden gesucht. Dagegen untersucht die deskriptive Entscheidungstheorie das tatsächliche menschliche Verhalten und versucht, dieses zu erklären. Sie ist damit eine wichtige entscheidungsunterstützende Theorie, insbesondere bei irrationalem Verhalten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemerläuterung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Praxisbezug
- 2. Grundprinzipien präskriptiver Entscheidungstheorie
- 3. Strukturierung und Modellierung der Entscheidung
- 3.1 Alternativen
- 3.2 Umwelt
- 3.3 Ziel und Präferenzen
- 4. Entscheidung bei Unsicherheit
- 4.1 Maximin-Regel
- 4.2 Maximax-Regel
- 4.3 Savage-Niehans-Regel
- 5. Entscheidung bei Risiko
- 6. Gruppenentscheidungen
- 7. Deskriptive Entscheidungstheorie
- 8. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Entscheidungstheorie, beleuchtet Ansätze zur Verbesserung von Entscheidungssituationen und erklärt, warum Menschen oft nicht rational handeln wie der Homo Oeconomicus. Sie analysiert Entscheidungen in Politik und Wirtschaft und versucht, diese mit Hilfe der Entscheidungstheorie zu erklären und Lösungsansätze zu liefern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung der Entscheidungstheorie in der Betriebswirtschaftslehre.
- Präskriptive vs. deskriptive Entscheidungstheorie
- Rationale Entscheidungsfindung und ihre Grenzen
- Entscheidungsfindung bei Unsicherheit und Risiko
- Gruppenentscheidungen und ihre Herausforderungen
- Anwendung der Entscheidungstheorie in der Praxis (am Beispiel des BVV)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Entscheidungstheorie ein und veranschaulicht die Relevanz von Entscheidungen im privaten und beruflichen Kontext. Sie betont die Schwierigkeiten des Menschen mit nicht-routinisierten Entscheidungen und die Neigung zu systematischen Fehlern. Die Einleitung differenziert zwischen präskriptiver (vorschreibender) und deskriptiver (beschreibender) Entscheidungstheorie und hebt deren Bedeutung für verschiedene Bereiche hervor, insbesondere für die Betriebswirtschaftslehre. Der Praxisbezug wird anhand des BVV Versicherungsvereins des Bankgewerbes verdeutlicht, dessen Entscheidungen weitreichende Folgen haben.
2. Grundprinzipien präskriptiver Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der präskriptiven Entscheidungstheorie, die darauf abzielt, rationale Entscheidungen zu treffen. Es betont den Unterschied zwischen rationalen und erfolgreichen Entscheidungen und die Bedeutung der Erfolgskontrolle, um Schwächen im Entscheidungsprozess aufzudecken und dem Hindsight-Bias entgegenzuwirken. Die Kapitel erläutert die zentralen Fragen, die ein Entscheider im Prozess klären muss, um Rationalität zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Entscheidungstheorie, präskriptive Entscheidungstheorie, deskriptive Entscheidungstheorie, rationale Entscheidung, Homo Oeconomicus, Entscheidungsfindung bei Unsicherheit, Entscheidungsfindung bei Risiko, Gruppenentscheidungen, Praxisbezug, BVV Versicherungsverein.
Häufig gestellte Fragen zur Entscheidungstheorie
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Entscheidungstheorie. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der präskriptiven und deskriptiven Entscheidungstheorie, der rationalen Entscheidungsfindung und deren Grenzen, sowie der Anwendung der Theorie in der Praxis, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre am Beispiel des BVV Versicherungsvereins.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die behandelten Themen umfassen die Grundprinzipien der präskriptiven Entscheidungstheorie, Entscheidungsfindung bei Unsicherheit (Maximin-Regel, Maximax-Regel, Savage-Niehans-Regel) und Risiko, Gruppenentscheidungen, den Unterschied zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie, die Grenzen rationaler Entscheidungsfindung und die Anwendung der Entscheidungstheorie in der Praxis (am Beispiel des BVV).
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, einen Überblick über die Entscheidungstheorie zu geben, Ansätze zur Verbesserung von Entscheidungssituationen zu beleuchten und zu erklären, warum Menschen oft nicht rational handeln. Es analysiert Entscheidungen in Politik und Wirtschaft und versucht, diese mit Hilfe der Entscheidungstheorie zu erklären und Lösungsansätze zu liefern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung der Entscheidungstheorie in der Betriebswirtschaftslehre.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz der Entscheidungstheorie erläutert. Weitere Kapitel befassen sich mit den Grundprinzipien der präskriptiven Entscheidungstheorie, der Strukturierung und Modellierung von Entscheidungen, Entscheidungen bei Unsicherheit und Risiko, Gruppenentscheidungen, der deskriptiven Entscheidungstheorie und einer Schlussbemerkung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Entscheidungstheorie, präskriptive Entscheidungstheorie, deskriptive Entscheidungstheorie, rationale Entscheidung, Homo Oeconomicus, Entscheidungsfindung bei Unsicherheit, Entscheidungsfindung bei Risiko, Gruppenentscheidungen, Praxisbezug, BVV Versicherungsverein.
Wie wird der Praxisbezug hergestellt?
Der Praxisbezug wird anhand des BVV Versicherungsvereins des Bankgewerbes hergestellt. Die weitreichenden Folgen der Entscheidungen des BVV verdeutlichen die Bedeutung und Relevanz der Entscheidungstheorie in der Praxis.
Was ist der Unterschied zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie?
Die präskriptive Entscheidungstheorie gibt vor, wie rationale Entscheidungen getroffen werden *sollten*, während die deskriptive Entscheidungstheorie beschreibt, wie Entscheidungen *tatsächlich* getroffen werden. Das Dokument beleuchtet beide Ansätze und zeigt die Diskrepanz zwischen normativen Modellen und realem Verhalten auf.
Wie wird die rationale Entscheidungsfindung und ihre Grenzen behandelt?
Das Dokument behandelt die rationale Entscheidungsfindung im Kontext der präskriptiven Entscheidungstheorie, hebt aber auch die Grenzen dieser Rationalität hervor und erklärt, warum Menschen oft von diesem Ideal abweichen. Es thematisiert systematische Fehler und die Abweichung vom Modell des Homo Oeconomicus.
- Citar trabajo
- Christian Uhlig (Autor), 2006, Die Entscheidungstheorie. Problemerläuterung und Grundprinzipien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64709